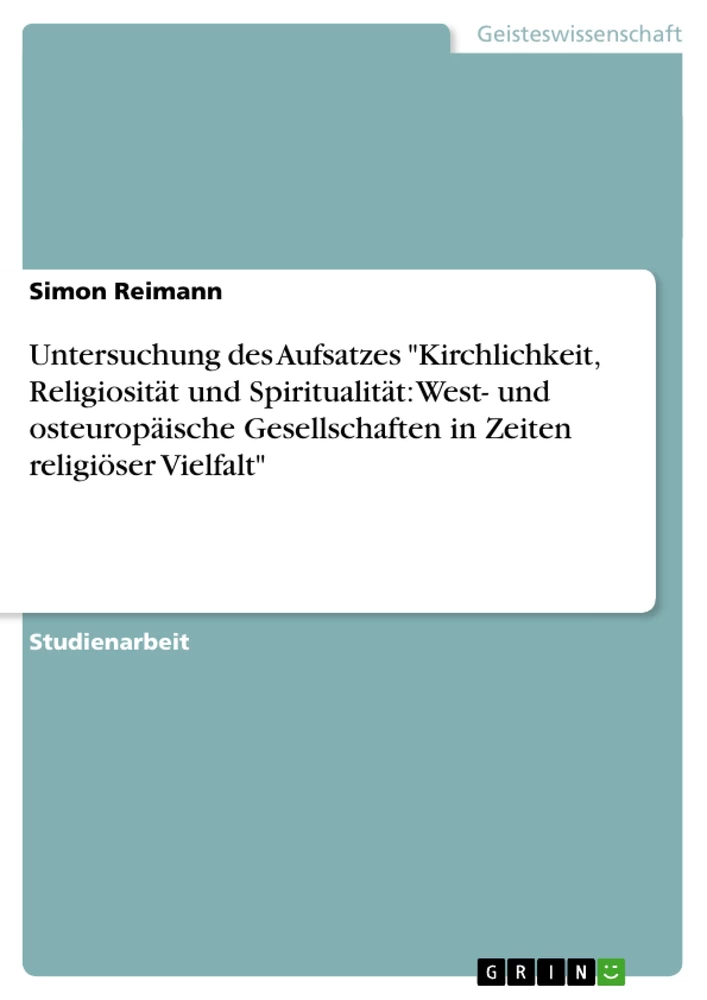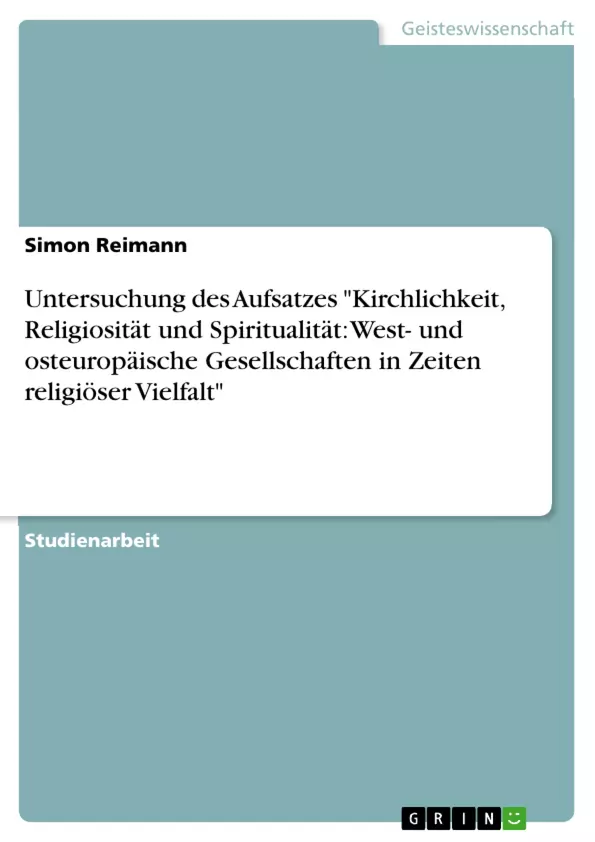Die vorliegende Arbeit ist die Verschriftlichung eines Referats zum Aufsatz „Kirchlichkeit, Religiosität und Spiritualität..." von Olaf Müller und Detlef Pollack, weshalb sie dessen Aufbau folgt. Zuerst soll der vorliegende Text und seine zentralen Thesen kurz
zusammengefasst und wiedergegeben werden, dann werden die zur Diskussion gestellten Fragen behandelt.
Von diesen betrifft die erste die von den Autoren verwandte Methodik und hinterfragt,
ob die zur Untersuchung herangezogenen Kategorien trennscharfe Ergebnisse liefern.
Die zweite Frage befasst sich mit einer im Text festgestellten Problematik: Zwar wurde
in der Auswertung der Daten des Religionsmonitors eine prinzipielle Offenheit
gegenüber anderen Religionen und Weltanschauungen festgestellt, demgegenüber steht
jedoch eine hoch ausgeprägte Assimilationserwartung gegenüber Minderheiten seitens
der Mehrheit.
Für diese Fragen soll eine kurze Darstellung des Problems vorgenommen, sowie ein
Ansatz zur Beschreitung eines möglichen Lösungswegs gegeben werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zusammenfassung und Thesen des Textes
- Zur Methode: Wie trennscharf ist die Unterteilung in die Kategorien kirchengebundene und private sowie konventionelle und alternative Religiosität?
- Zum Inhalt: Wie plausibel ist die Erklärung für die Spannung zwischen vorhandener Offenheit und weit verbreiteten Assimilationserwartungen gegenüber Minderheitsreligionen?
- Schluss
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text analysiert empirische Daten des Religionsmonitors 2008, um die Entwicklung von Kirchlichkeit, Religiosität und Spiritualität in West- und Osteuropa zu untersuchen. Er setzt sich kritisch mit der Säkularisierungs- und Individualisierungsthese auseinander und untersucht, inwiefern diese Thesen durch die Daten bestätigt werden können.
- Religiöse Pluralisierung in Europa
- Verhältnis von kirchengebundener und privater Religiosität
- Bedeutung religiöser Sozialisation für die Ausprägung von Religiosität
- Spannungsfeld zwischen Offenheit gegenüber anderen Religionen und Assimilationserwartungen
- Kritik an der Individualisierungsthese
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Der Text stellt den theoretischen Hintergrund der Säkularisierungs- und Individualisierungsthese dar und beschreibt die Methodik der Untersuchung.
- Zusammenfassung und Thesen des Textes: Die Autoren analysieren die Daten des Religionsmonitors und stellen fest, dass die Zahl der Nicht-Gläubigen in Europa höher ist als die der Gläubigen. Die Selbstverortung als gläubig führt nicht zwingend zur Teilnahme an institutionellen Formen der Religionsausübung.
- Zur Methode: Wie trennscharf ist die Unterteilung in die Kategorien kirchengebundene und private sowie konventionelle und alternative Religiosität?: Die Autoren diskutieren die Eignung der verwendeten Kategorien, um die Ausprägung von Religiosität zu messen. Sie stellen fest, dass konventionelle Religiosität häufig mit kirchengebundener Religiosität zusammenfällt, während alternative Formen der Religiosität eher im privaten Bereich zu finden sind.
- Zum Inhalt: Wie plausibel ist die Erklärung für die Spannung zwischen vorhandener Offenheit und weit verbreiteten Assimilationserwartungen gegenüber Minderheitsreligionen?: Die Autoren analysieren die Daten des Religionsmonitors und stellen fest, dass die Mehrheit der Befragten sich gegenüber anderen Religionen offen zeigt. Allerdings zeigt sich gleichzeitig eine hohe Assimilationserwartung gegenüber Minderheitsreligionen, insbesondere gegenüber dem Islam. Die Autoren diskutieren die möglichen Ursachen für diese Diskrepanz.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Säkularisierung, die Individualisierung, die Religiosität, die Kirchlichkeit, die Spiritualität, die religiöse Pluralisierung, die religiöse Sozialisation, die Assimilation, die Einstellung gegenüber dem Islam und die Bedeutung von Kontingenz im menschlichen Leben.
Häufig gestellte Fragen
Was untersucht der Aufsatz von Müller und Pollack?
Er analysiert die Entwicklung von Kirchlichkeit, Religiosität und Spiritualität in West- und Osteuropa auf Basis des Religionsmonitors 2008.
Was ist die zentrale Erkenntnis zur Zahl der Gläubigen in Europa?
Die Autoren stellen fest, dass die Zahl der Nicht-Gläubigen in Europa mittlerweile höher ist als die der Gläubigen.
Wie unterscheiden sich kirchengebundene und private Religiosität?
Kirchengebundene Religiosität findet in Institutionen statt, während private (oft alternative) Religiosität individuell und außerhalb fester Strukturen ausgeübt wird.
Welches Spannungsfeld wird bezüglich religiöser Minderheiten aufgezeigt?
Es besteht eine Diskrepanz zwischen einer prinzipiellen Offenheit gegenüber anderen Religionen und einer gleichzeitig hohen Erwartung an die Assimilation von Minderheiten (besonders Muslime).
Was besagt die Individualisierungsthese in der Religionssoziologie?
Sie geht davon aus, dass Religion nicht verschwindet, sondern sich privatisiert und individueller gestaltet wird. Die Autoren setzen sich kritisch mit dieser These auseinander.
Welche Rolle spielt die religiöse Sozialisation?
Sie wird als entscheidender Faktor für die Ausprägung und den Erhalt von Religiosität in einer Gesellschaft untersucht.
- Citar trabajo
- M. A. Simon Reimann (Autor), 2013, Untersuchung des Aufsatzes "Kirchlichkeit, Religiosität und Spiritualität: West- und osteuropäische Gesellschaften in Zeiten religiöser Vielfalt", Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/266504