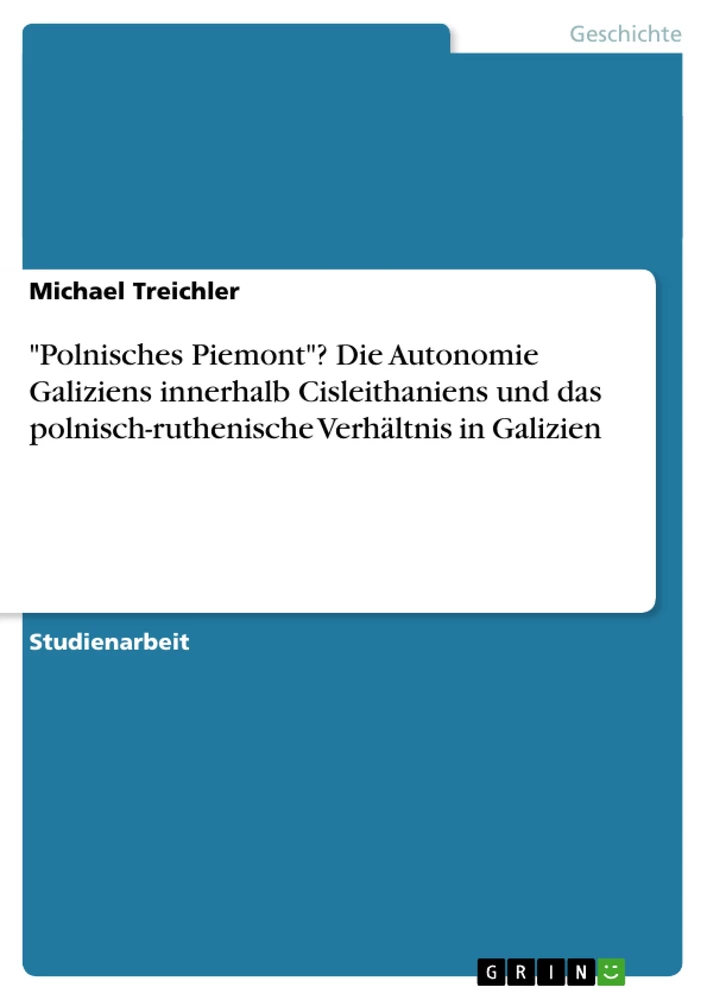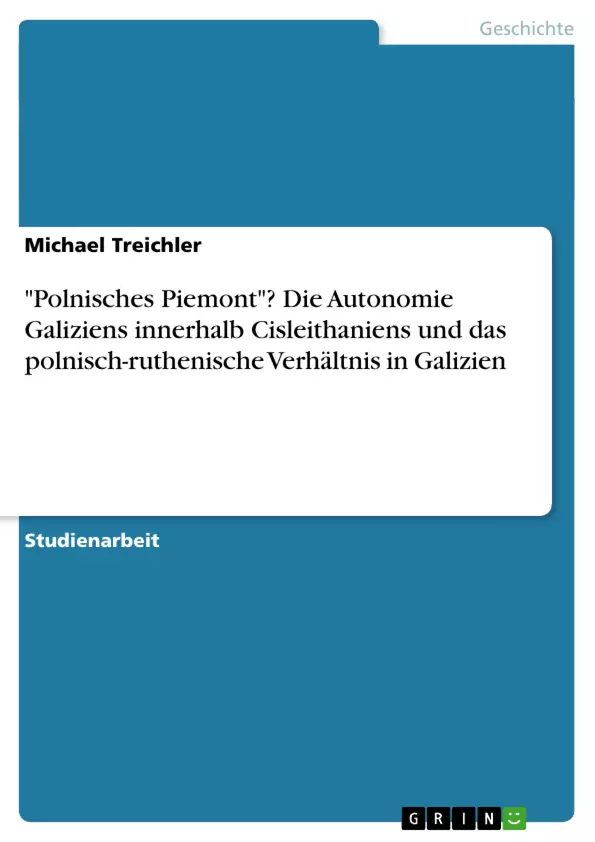Als das Kronland Galizien im Zuge des österreichisch-ungarischen Ausgleichs von 1867 eine weitgehende Autonomie erlangte, markierte diese den Endzustand eines über zwei Jahrzehnte andauernden Prozesses, in dem sich die Beziehungen zwischen der politischen Führung der Provinz und der Wiener Zentralregierung erheblich gewandelt hatten. Die galizischen konservativen Adligen, die noch während der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts das Ziel der polnischen staatlichen Selbstständigkeit auch um den Preis einer Konfrontation mit den habsburgischen Monarchen verfolgt hatten, schwenkten im Laufe der 1860er Jahre auf einen nahezu servilen kaisertreuen Kurs um, durch den sie im Gegenzug von der Regierung Zugeständnisse hinsichtlich einer weitgehenden Selbstverwaltung der Provinz zu erhalten hofften. Mit der Gewährung dieser Konzessionen im Zuge des österreichisch-ungarischen Ausgleichs von 1867 sollten sie schließlich einige ihrer Ziele erreichen und der österreichisch okkupierte Teil Polens von einer ähnlichen Germanisierungs- respektive Russifizierungspolitik verschont bleiben, wie sie in den anderen zwei polnischen Teilungsgebieten vorherrschte.
Im ersten Abschnitt dieser Arbeit wird der von Spannungen zwischen dem galizischen Adel und der Wiener Regierung geprägte Zeitabschnitt der Regierungszeit Metternichs geschildert, der seinen gewaltsamen Höhepunkt im Bauernaufstand des Jahres 1846 in Westgalizien fand. Im zweiten Abschnitt wird daran anschließend der Prozess geschildert, in dessen Verlauf die führenden galizischen Konservativen während der Zeit des Neoabsolutismus und der Verfassungsexperimente die Ausrichtung ihrer Politik vollkommen änderten und schließlich die Gewährung der Autonomierechte erlangen sollten. Abschließend werden die Verhandlungen über die Ausgestaltung dieser Autonomie dargestellt sowie diskutiert, worauf der während dieser Zeit entstandene Vergleich Galiziens als ein Polnisches Piemont basiert. Alle drei Abschnitte werden durch Exkurse über die Entwicklungen ergänzt, die sich im behandelten Zeitabschnitt in den Beziehungen der polnischen Bevölkerungsmehrheit zur ruthenischen Minderheit vollzogen. Weiterhin wird im dritten dieser Exkurse der Prozess geschildert, in denen sich die ruthenischen Kleriker, Politiker und Intellektuellen zunehmend nicht mehr als Teil einer großen russischen Nation, sondern als eigenständiges ukrainisches Volk definierten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Ära Metternich
- Die Autonomie Galiziens
- Die Zeiten des Neoabsolutismus und der Verfassungsexperimente
- Die Erlangung der Autonomie
- Resümee
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entwicklung der Autonomie Galiziens innerhalb Cisleithaniens, mit besonderem Fokus auf das Verhältnis zwischen der polnischen Bevölkerungsmehrheit und der ruthenischen Minderheit in der Provinz. Sie beleuchtet den Prozess der autonomen Entwicklung Galiziens von den Spannungen unter Metternich bis zur Erlangung der Autonomie im Zuge des österreichisch-ungarischen Ausgleichs von 1867.
- Die politische Entwicklung Galiziens im 19. Jahrhundert
- Der Einfluss der österreichischen Zentralregierung auf Galizien
- Die Rolle des polnischen Adels in Galizien
- Die Entwicklung des polnisch-ruthenischen Verhältnisses
- Die Entstehung des Begriffs "Polnisches Piemont" in Bezug auf Galizien
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung skizziert den historischen Kontext und die Zielsetzung der Arbeit. Sie beleuchtet die Bedeutung der Autonomie Galiziens im Rahmen des österreichisch-ungarischen Ausgleichs und die Entwicklung der Beziehungen zwischen der galizischen politischen Führung und der Wiener Zentralregierung.
- Die Ära Metternich: Dieses Kapitel befasst sich mit der Regierungszeit Metternichs und den Spannungen zwischen dem galizischen Adel und der Wiener Regierung. Es beschreibt die Politik des österreichischen Reichs in Galizien und die Rolle des polnischen Adels in der Provinz. Der Höhepunkt dieses Kapitels ist die Darstellung des Bauernaufstands von 1846 in Westgalizien.
- Die Zeiten des Neoabsolutismus und der Verfassungsexperimente: Dieses Kapitel analysiert die Veränderungen in der politischen Ausrichtung des galizischen Adels während der Zeit des Neoabsolutismus und der Verfassungsexperimente. Es beschreibt die Prozesse, die zur Erlangung der Autonomierechte führten, und beleuchtet die politischen Strategien der galizischen Konservativen.
Schlüsselwörter
Diese Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Autonomie, Galizien, österreichisch-ungarischer Ausgleich, polnischer Adel, ruthenische Minderheit, "Polnisches Piemont", Geschichte der Donaumonarchie, Nationalitätenkonflikte, und Sozialreformen. Sie untersucht die Entwicklung der Beziehungen zwischen Polen und Ruthenen im Kontext der österreichischen Herrschaft und analysiert die Bedeutung der Autonomie für die politische und soziale Situation Galiziens.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet der Begriff „Polnisches Piemont“?
Der Begriff vergleicht Galiziens Rolle für die polnische Nationalbewegung mit der Rolle Piemonts für die italienische Einigung, als Zentrum der Autonomie und nationalen Erneuerung.
Wie erlangte Galizien seine Autonomie?
Die Autonomie wurde im Zuge des österreichisch-ungarischen Ausgleichs von 1867 gewährt, nachdem der galizische Adel auf einen kaisertreuen Kurs umgeschwenkt war.
Wie war das Verhältnis zwischen Polen und Ruthenen?
Das Verhältnis war von Spannungen geprägt, da die polnische Mehrheit die politische Führung innehatte, während sich die ruthenische Minderheit zunehmend als eigenständiges ukrainisches Volk definierte.
Was geschah beim Bauernaufstand von 1846?
Der Aufstand in Westgalizien markierte einen blutigen Höhepunkt der Spannungen zwischen dem Adel und der Landbevölkerung, was die Wiener Regierung politisch instrumentalisierte.
Welchen Einfluss hatte Metternich auf Galizien?
Unter Metternich war die Regierungszeit von Misstrauen gegenüber dem polnischen Adel und einer zentralistischen Verwaltung aus Wien geprägt.
- Quote paper
- Michael Treichler (Author), 2004, "Polnisches Piemont"? Die Autonomie Galiziens innerhalb Cisleithaniens und das polnisch-ruthenische Verhältnis in Galizien, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/26654