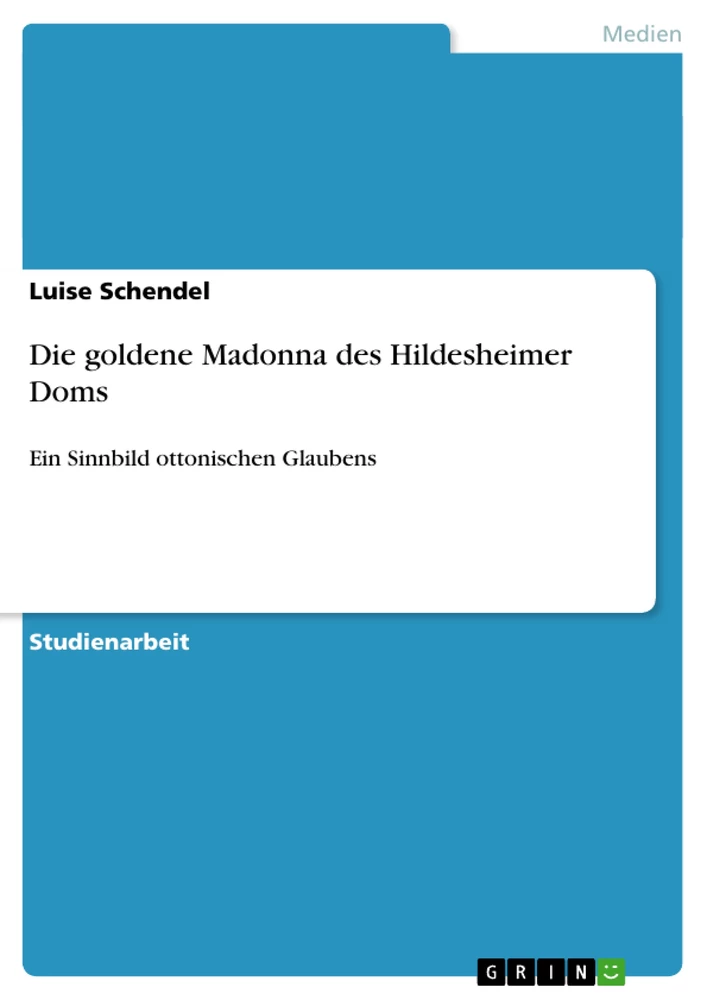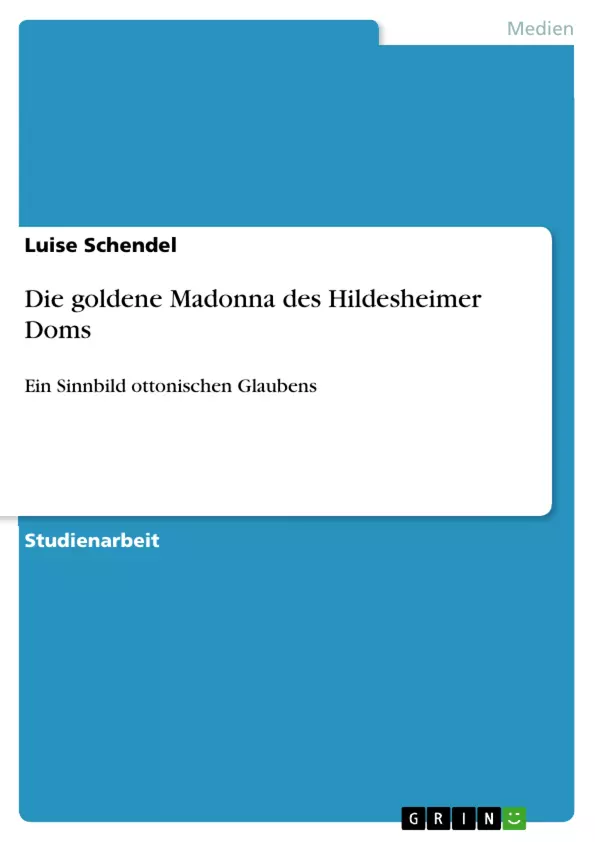Das Zeitalter der Liudolfinger war vor allem durch einen starken christlichen Glauben geprägt, der sich unter anderem in zahllosen kostbaren Kirchengeräten widerspiegelte, von denen heute jedoch nur noch relativ wenige Exemplare erhalten sind. Deren Stifter waren vor allem wohlhabende Mitglieder des Hochadels, wie der ‚Wanderkaiser’ Heinrich II, der zum Beispiel das berühmte Baseler Antependium anfertigen ließ, und Inhaber eines hohen Kirchenamtes. Dabei waren es besonders die Bischöfe wie Bischof Egbert, der 993 n. Chr. starb, oder Bischof Thietmar von Salzburg, der im Jahre 1041 a. D. verblich, die sich als Förderer der kostspieligen Goldschmiedekunst erwiesen . In ihre Reihe tritt auch Bischof Bernward von Hildesheim, auf den ein nicht unerheblicher Teil der prunkvollen ottonischen Kirchenausstattung zurückgeht. Jener war von 993 n. Chr. bis 1022 n. Chr. in seinem Amt, stammte aus einem aristokratischen Haus, war Vertrauensmann des Königs und Mäzen dieser bedeutenden Diözese. Sein Biograph Thangmar rühmte ihn seines frommen Herzens, seines wachen Geistes und seines künstlerischen Verständnisses. So zeigt sich die qualitätvolle Arbeit seiner Stiftungen noch heute zum Beispiel in der berühmten Bernwardsäule oder der bronzenen Bernwardstür Hildesheims. Wesentlich kleiner, dabei aber nicht minder bedeutsam ist daneben die große, wahrscheinlich ebenfalls von Bischof Bernward gestiftete „Goldene Madonna“ des Hildesheimer Doms.
Inhaltsverzeichnis
- Bischof Bernward und die ottonischen Stiftungen
- Die „goldene Madonna“
- Maria und Christus in ihrem formalen Aufbau
- Die Gottesmutter
- Der Sohn Marias
- Die „,goldene Madonna\" und die Plastiken Bernwards
- Die Sitzmadonna in ihrem frühmittelalterlichen Umfeld
- Marienbilder und Monumentalskulptur
- Die goldene Madonna aus Essen
- Die bemalte Madonna aus Paderborn
- Die Entwicklung der plastischen Mariensitzstatuen
- Marienbilder und Monumentalskulptur
- Die Figurengruppe in ihrer Wirkung
- Material und Dualität
- Madonnen und Reliquien
- Maria und Christus in ihrem formalen Aufbau
- Zwischen Jenseits und Diesseits
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text befasst sich mit der „Goldenen Madonna“ des Hildesheimer Doms, einem bedeutenden Kunstwerk der ottonischen Zeit. Er untersucht die Entstehung, die Formgebung, den künstlerischen Kontext und die Bedeutung der Skulptur. Dabei werden die Rolle des Bischofs Bernward als Stifter und die Bedeutung der Madonna im frühmittelalterlichen Marienbild beleuchtet.
- Bischof Bernward als Stifter und Mäzen
- Die „Goldene Madonna“ als Sinnbild ottonischen Glaubens
- Die künstlerische Bedeutung der Skulptur im Kontext der frühmittelalterlichen Kunst
- Die Funktion der Madonna als Kultbild und Reliquienbehälter
- Die „Goldene Madonna“ als Beispiel für die Entwicklung der Marienbildkunst im Mittelalter
Zusammenfassung der Kapitel
1. Bischof Bernward und die ottonischen Stiftungen
Dieses Kapitel beleuchtet das Zeitalter der Liudolfinger und die bedeutende Rolle der christlichen Stiftungen in dieser Zeit. Es wird der Einfluss von wohlhabenden Mitgliedern des Hochadels, wie Kaiser Heinrich II, und Bischöfen, wie Egbert und Thietmar von Salzburg, auf die Entwicklung der Goldschmiedekunst hervorgehoben. Besonderes Augenmerk wird auf Bischof Bernward von Hildesheim gelegt, der als Förderer und Stifter zahlreicher kunstvoller Objekte, wie der Bernwardsäule und der Bernwardstür, bekannt ist.2. Die „goldene Madonna“
Das Kapitel widmet sich der „Goldenen Madonna“ als einem der wichtigsten Werke Bernwards. Es werden die Entstehungszeit, die Materialität und die Form der Skulptur detailliert beschrieben. Der ostchristlich-byzantinische Typus der ‚Nikopoia' und die Bedeutung der Madonna als „sedes sapientiae“ werden erläutert.2.1. Maria und Christus in ihrem formalen Aufbau
Die Figuren der Madonna und des Christuskindes werden in ihrem formalen Aufbau und ihrer Gestaltung analysiert. Die Frontalität der Dargestellten, die spezifischen Merkmale der Gewänder und die Haltung der Figuren werden beleuchtet.2.2. Die Sitzmadonna in ihrem frühmittelalterlichen Umfeld
Der Abschnitt behandelt die „Goldene Madonna“ im Kontext anderer frühmittelalterlicher Marienbilder und Skulpturen. Es werden Vergleiche mit der „goldenen Madonna“ aus Essen und der „bemalten Madonna“ aus Paderborn gezogen. Die Entwicklung der plastischen Mariensitzstatuen wird in ihrer historischen Perspektive betrachtet.2.3. Die Figurengruppe in ihrer Wirkung
Das Kapitel analysiert die ästhetische Wirkung der „Goldenen Madonna“ auf den Betrachter. Die Materialität der Skulptur, die Verbindung von Gold und Holz sowie die Rolle der Madonna als Reliquienbehälter werden im Zusammenhang mit der spirituellen Dimension des Kunstwerks beleuchtet.Schlüsselwörter
Die „Goldene Madonna“ des Hildesheimer Doms, Bischof Bernward, ottonische Zeit, frühmittelalterliche Kunst, Marienbild, „sedes sapientiae“, Nikopoia, Goldschmiedekunst, Stiftungen, Reliquien, Kultbild.- Citar trabajo
- M.A. Luise Schendel (Autor), 2008, Die goldene Madonna des Hildesheimer Doms, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/266623