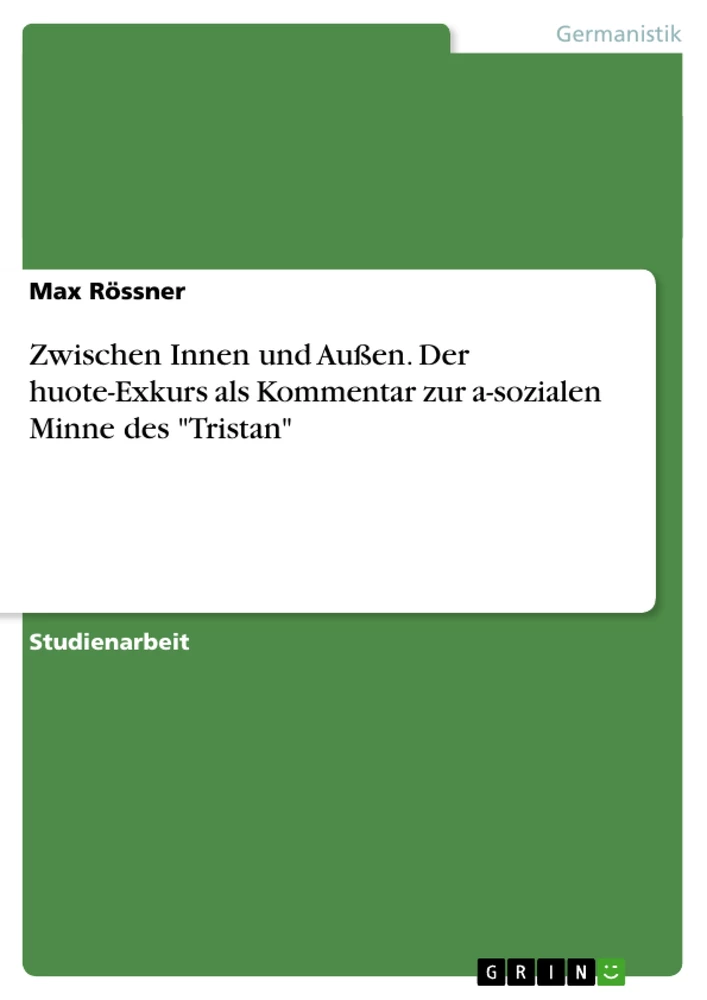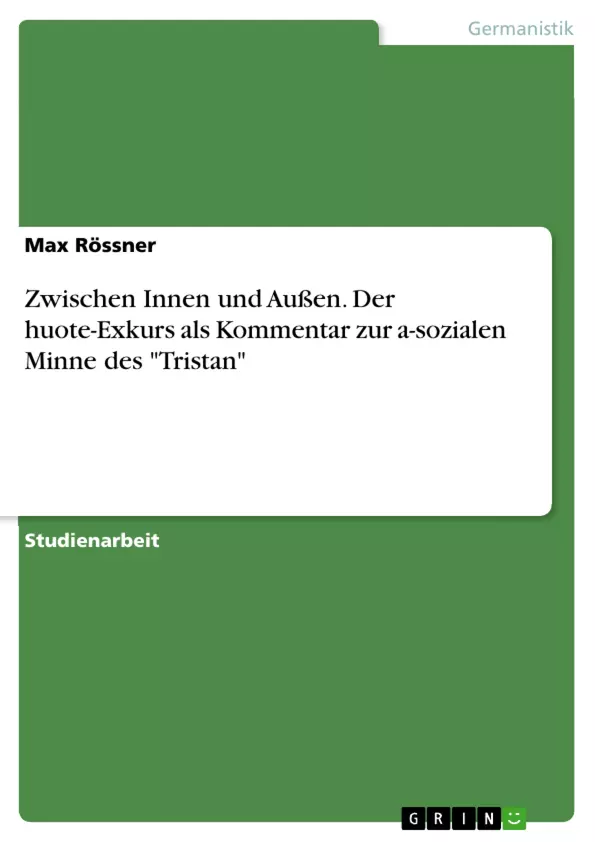Der Exkurs über die huote hat eine bewegte Vergangenheit hinter sich. Von den frühen Rezipienten des Romans noch mehrheitlich als nebensächliche Randnotiz erachtet, erhob sich der huote-Exkurs in der Forschergemeinde Mitte der 60er Jahre zu einer der zentralen Stellen des Gottfriedtextes. Als Auslöser des Sinneswandels sieht etwa Tomas Tomasek das verstärkte Interesse an Gottfrieds individueller Gestaltung, die sich besonders in den komplexen Großexkursen analysieren lässt. Darüber hinaus handelt es sich bei Gottfrieds „[…] intensive[r] Ausgestaltung der Erzählerrolle […]“ um ein alleinstellendes Charakteristikum, das in der zeitgenössischen Literatur ohnegleichen ist und insofern schon im Fokus der Forscher stehen muss.
So einstimmig die Dominanz der Exkurse mittlerweile anerkannt wird, so ambivalent fällt dagegen deren Kontextualisierung und Deutung aus. Besonders der Kommentar zur huote erwies sich im Lauf der letzten rund 50 Jahre als ein derart streitbares Terrain, dass sich Walter Haug zu der pessimistischen Bemerkung hinreißen lässt, es handle sich hierbei um ein „[…] von der Forschung bis zum Überdruss durchgeackertes Feld […]“, in dessen auf- und umgeworfenen Schichten sich die Sekundärliteraten einen ebenso erbitterten wie aussichtslosen Grabenkrieg liefern würden. Haugs Einschätzung mag zwar von seiner eigenen, wiederum sehr umstrittenen Interpretation des Exkurses beeinflusst sein, zutreffend ist hingegen der Befund, dass mittlerweile kaum eine wissenschaftliche Arbeit ohne Verweise auf die huote auskommt. So sieht sich beispielsweise jüngst Anina Barandun in ihrer Untersuchung der „Tristan-Trigonometrie“ zu einer Erläuterung veranlasst, weshalb sie die Exkurse „[…] bewusst ausgeklammert […]“ hat. Damit bestätigt auch sie zumindest ex negativo den wissenschaftlichen Konsens, der auf den huote-Exkurs einen hermeneutischen Brennpunkt legt. Dazu beigetragen hat ohne Zweifel die exponierte Stellung der ausführenden Bemerkung; als letztem und längstem der drei Hauptexkurse wird ihm die schlussendliche Stellungnahme des Autors zu seinen Protagonisten unterstellt. Gottfried hat die Abhandlung unmittelbar vor die Entdeckung der Liebenden gestellt, für die Dauer der Erörterung gefriert die Außenhandlung quasi ein und überlässt fürs erste der Reflexion den Vorrang vor der Katastrophe.
Gliederung
1. Einleitung
2. Das Innenverhältnis des idealen Paares
2.1 Isolde als Vertreterin der Eva- Natur?
2.2 Die Stufungen zum lebenden paradis durch das Individuum
3. Das Außenverhältnis des idealen Paares
3.1 Feudalgesellschaft und Individualethik
3.2 Darüber hinaus oder dahinter zurück?
4. Schlussbetrachtungen
Literaturverzeichnis
1. Einleitung
Der Exkurs über die huote hat eine bewegte Vergangenheit hinter sich. Von den frühen Rezipienten des Romans noch mehrheitlich als nebensächliche Randnotiz erachtet, erhob sich der huote -Exkurs in der Forschergemeinde Mitte der 60er Jahre zu einer der zentralen Stellen des Gottfriedtextes. Als Auslöser des Sinneswandels sieht etwa Tomas Tomasek das verstärkte Interesse an Gottfrieds individueller Gestaltung, die sich besonders in den komplexen Großexkursen analysieren lässt. Darüber hinaus handelt es sich bei Gottfrieds „[…] intensive[r] Ausgestaltung der Erzählerrolle […]“[1] um ein alleinstellendes Charakteristikum, das in der zeitgenössischen Literatur ohnegleichen ist und insofern schon im Fokus der Forscher stehen muss.
So einstimmig die Dominanz der Exkurse mittlerweile anerkannt wird, so ambivalent fällt dagegen deren Kontextualisierung und Deutung aus. Besonders der Kommentar zur huote erwies sich im Lauf der letzten rund 50 Jahre als ein derart streitbares Terrain, dass sich Walter Haug zu der pessimistischen Bemerkung hinreißen lässt, es handle sich hierbei um ein „[…] von der Forschung bis zum Überdruss durchgeackertes Feld […]“[2], in dessen auf- und umgeworfenen Schichten sich die Sekundärliteraten einen ebenso erbitterten wie aussichtslosen Grabenkrieg liefern würden. Haugs Einschätzung mag zwar von seiner eigenen, wiederum sehr umstrittenen Interpretation des Exkurses beeinflusst sein, zutreffend ist hingegen der Befund, dass mittlerweile kaum eine wissenschaftliche Arbeit ohne Verweise auf die huote auskommt. So sieht sich beispielsweise jüngst Anina Barandun in ihrer Untersuchung der „Tristan-Trigonometrie“ zu einer Erläuterung veranlasst, weshalb sie die Exkurse „[…] bewusst ausgeklammert […]“[3] hat. Damit bestätigt auch sie zumindest ex negativo den wissenschaftlichen Konsens, der auf den huote - Exkurs einen hermeneutischen Brennpunkt legt. Dazu beigetragen hat ohne Zweifel die exponierte Stellung der ausführenden Bemerkung; als letztem und längstem der drei Hauptexkurse wird ihm die schlussendliche Stellungnahme des Autors zu seinen Protagonisten unterstellt. Gottfried hat die Abhandlung unmittelbar vor die Entdeckung der Liebenden gestellt, für die Dauer der Erörterung gefriert die Außenhandlung quasi ein und überlässt fürs erste der Reflexion den Vorrang vor der Katastrophe. Ob die narrative Retardierung aber zur Unschärfe des Textes beiträgt oder gar fortlaufendes interpretatorisches Fehlverhalten bewirkt, diese Frage wurde - und wird auch weiterhin - als Kernbestandteil jeder Tristan-Behandlung betrachtet.
Als thematische Annäherung an den viel diskutierten Passus sei Rüdiger Schnell zitiert, der in der huote „[…] das Verhältnis von Individuum und Gesellschaft […]“[4] behandelt sieht, und mit dieser Verortung zumindest noch den Großteil der mediävistischen Kollegen hinter sich weiß. Kaum ein Interpret hegt grundsätzliche Zweifel daran, dass der Abschnitt der Verbindung des einzelnen Menschen mit der ihn umgebenden Gemeinschaft gewidmet ist. Doch schon die Art des Verhältnisses und vielmehr noch die konkrete Bestimmung der von Gottfried intendierten Individuen und der Gesellschaft liegt im Zwielicht der Streitbarkeit.
Ziel dieser Arbeit ist es deshalb, die glückliche Minne des Exkurses – als Innenperspektive des idealen Paares- und den gelingenden Ausgleich mit der Umgebung – als Außenperspektive des Paares- vor dem Hintergrund der spannungsvollen, verbotenen Liebe Tristans und Isoldes zu analysieren. Unterstellt wird folglich, dass sowohl die Handlung wie auch der huote -Exkurs eine klare Vorstellung von den Minnepartnern und eine von diesen aus nach außen gerichtete, gesellschaftliche Dimension aufweisen. Besondere Aufmerksamkeit verdient dabei der Versuch eines Brückenschlages vom huote -Exkurs aus zu den umliegenden Handlungselementen, um gerade nicht, wie Walter Haug es tut, eine Inkommensurabilität im Ganzen, also „[…] zwei völlig verschiedene Ebenen […]“[5] des Romans anzunehmen. Die offene Auseinandersetzung mit gegenströmigen Vorschlägen soll dennoch gesucht und auf Verflechtungsmöglichkeiten hin sondiert werden.
2. Das Innenverhältnis des idealen Paares
Der Exkurs benennt zunächst die gängige, nichts desto trotz verwerfliche Praxis der Überwachung der Frau. Wie König Marke Isolde nachspioniert, um ihrem Treiben in seiner (scheinbaren) Abwesenheit auf die Schliche zu kommen, so verhielten sich auch andere Männer. Gottfried untersucht die darauf folgenden Konsequenzen, er kommt in seiner „[…] anthropologisch- psychologische[n] Reflexion […]“[6] –wie Huber zusammenfasst- zu dem Schluss, dass jede Überwachung ihr Ziel verfehle. Die untreue Frau wird stets Wege zur Übertretung des Erlaubten finden, die treue Frau wird den überwachenden Mann mit Geringschätzung strafen, „[…] der ist ir gehaz.“[7] Gottfried gibt als liebesstiftende Alternative dagegen wechselseitiges Vertrauen und partnerschaftliche Hilfe an. Die ideale Minne wird somit über die Abwesenheit von Zwängen bestimmt. Weder lässt sich die Minne „[…] mit übelichen dingen […]“[8] einfordern noch kann so ihr Weiterbestehen gesichert werden. Ungeachtet der ehelichen, also gesellschaftlich normierten Pflichten, entschuldigt Gottfried an dieser Stelle seine Protagonistin, die unter Markes Fehlverhalten leiden muss.
Auch Dagmar Mikasch-Köthner sieht hier die „[…] in einem Innenbereich Vollkommenheit erreichende Tristan-Isolde-Liebe […]“[9]
nicht gefährdet, selbst wenn diese –wie später noch zu zeigen sein wird- unter gesellschaftlicher Betrachtung ganz anders bewertet wird. Gottfrieds Minnekonzept, das Tristan und Isolde bereits im Prolog als vorbildlich Liebende zeichnete, wird auch durch den ersten Absatz des Exkurses nicht in Frage gestellt. Die Funktion dieser Zeilen scheint lediglich die Stärkung von Isoldes individueller Tristanliebe, die durch Markes Hinterstellungen noch gefestigter wirkt. Weitaus schwieriger, weil missverständlicher ist der folgende Abschnitt, in dem Gottfried die Eva- Natur der Frauen in den Blick nimmt und damit auch Isolde tangiert.
[...]
[1] Tomasek, Tomas: Gottfried von Straßburg. 1. Auflage. Stuttgart: Reclam 2007. (S. 309).
[2] Haug, Walter: Erzählung und Reflexion in Gottfrieds „Tristan“; in: Huber, Christoph; Millet, Victor (Hrsg.): Der „Tristan“ Gottfrieds von Straßburg: Symposion Santiago de Compostela, 5. Bis 8. April 2000. 1. Auflage. Tübingen: Niemeyer 2002. (S. 284).
[3] Barandun, Anina: Die Tristan- Trigonometrie des Gottfried von Strassburg: Zwei Liebende und ein Dritter. 1. Auflage. Tübinger [u.a.]: Francke 2009. (S. 213).
[4] Schnell, Rüdiger: Suche nach Wahrheit: Gottfrieds „Tristan und Isold“ als erkenntniskritischer Roman. 1. Auflage. Tübingen: Niemeyer 1992. (S. 38).
[5] Haug, Walter (S. 292).
[6] Huber, Christoph: Gottfried von Straßburg: Tristan. 3. , neu bearb. und erw. Auflage. Berlin: Schmidt 2013 (= Klassiker- Lektüren; Bd. 3). (S. 135).
[7] Krohn, Rüdiger (Hrsg.): Gottfried von Straßburg: Tristan. Bd.1/Bd.2. 10. Auflage. Stuttgart: Reclam Verlag 2010. (S. 476; V. 17878).
[8] Ebd. (S. 478; V. 17920).
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Inhalt dieser Gliederung zum Thema Tristan und Isolde?
Die Gliederung umfasst eine Einleitung, die Analyse des Innenverhältnisses des idealen Paares (Isolde als Vertreterin der Eva-Natur und die Stufungen zum lebenden paradis), die Untersuchung des Außenverhältnisses (Feudalgesellschaft und Individualethik, sowie die Frage, ob die Beziehung darüber hinausgeht oder dahinter zurückbleibt), Schlussbetrachtungen und ein Literaturverzeichnis.
Was ist der Fokus der Einleitung?
Die Einleitung behandelt den huote-Exkurs, seine bewegte Vergangenheit in der Forschung, die unterschiedlichen Deutungen und seine Bedeutung als thematische Annäherung an das Verhältnis von Individuum und Gesellschaft. Ziel der Arbeit ist es, die glückliche Minne und den gelingenden Ausgleich mit der Umgebung vor dem Hintergrund der verbotenen Liebe von Tristan und Isolde zu analysieren.
Was wird im Abschnitt über das Innenverhältnis des idealen Paares untersucht?
Dieser Abschnitt analysiert die gängige Praxis der Überwachung der Frau, wie sie sich in König Markes Verhalten widerspiegelt, und die daraus resultierenden Konsequenzen. Gottfried plädiert für wechselseitiges Vertrauen und partnerschaftliche Hilfe als Grundlage für eine ideale Minne. Es wird auch Isoldes Rolle und Gottfrieds Sicht auf die "Eva-Natur" der Frauen angesprochen.
Was ist die Bedeutung des huote-Exkurses laut Rüdiger Schnell?
Rüdiger Schnell sieht im huote-Exkurs die Behandlung des Verhältnisses von Individuum und Gesellschaft.
Was ist das Ziel der Arbeit bezüglich des huote-Exkurses?
Ziel ist es, einen Brückenschlag vom huote-Exkurs zu den umliegenden Handlungselementen zu schaffen und nicht eine Inkommensurabilität im Ganzen anzunehmen.
Wie wird die Tristan-Isolde-Liebe im Kontext der Gesellschaft betrachtet?
Die Tristan-Isolde-Liebe erreicht im Innenbereich Vollkommenheit, wird aber unter gesellschaftlicher Betrachtung anders bewertet. Die Liebe wird durch Markes Hinterstellungen eher gefestigt.
- Citar trabajo
- Max Rössner (Autor), 2013, Zwischen Innen und Außen. Der huote-Exkurs als Kommentar zur a-sozialen Minne des "Tristan", Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/266683