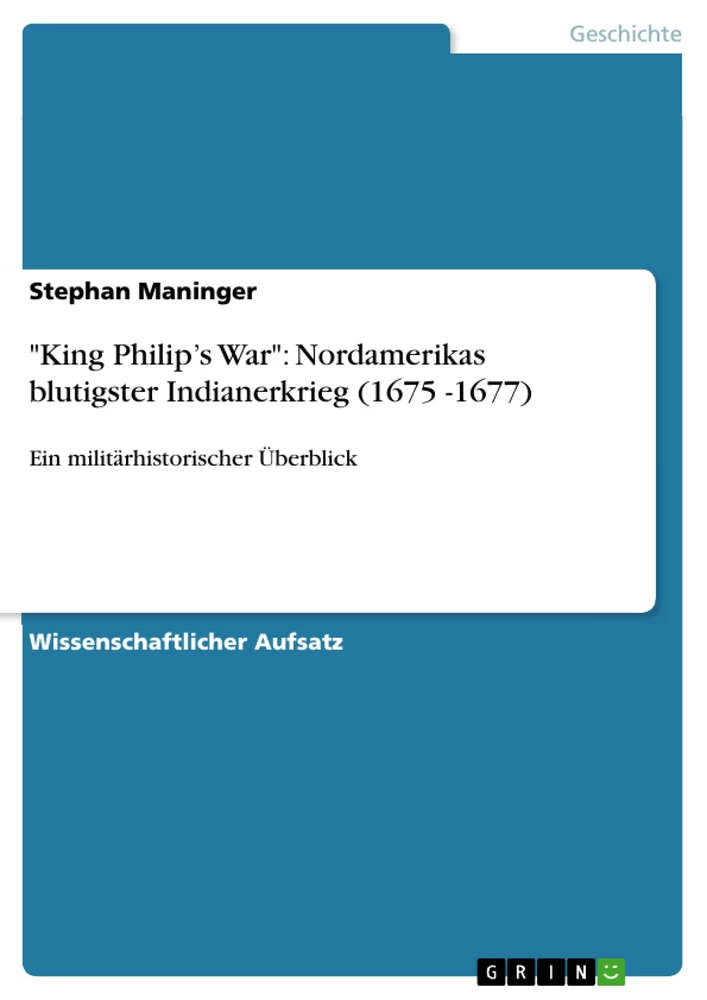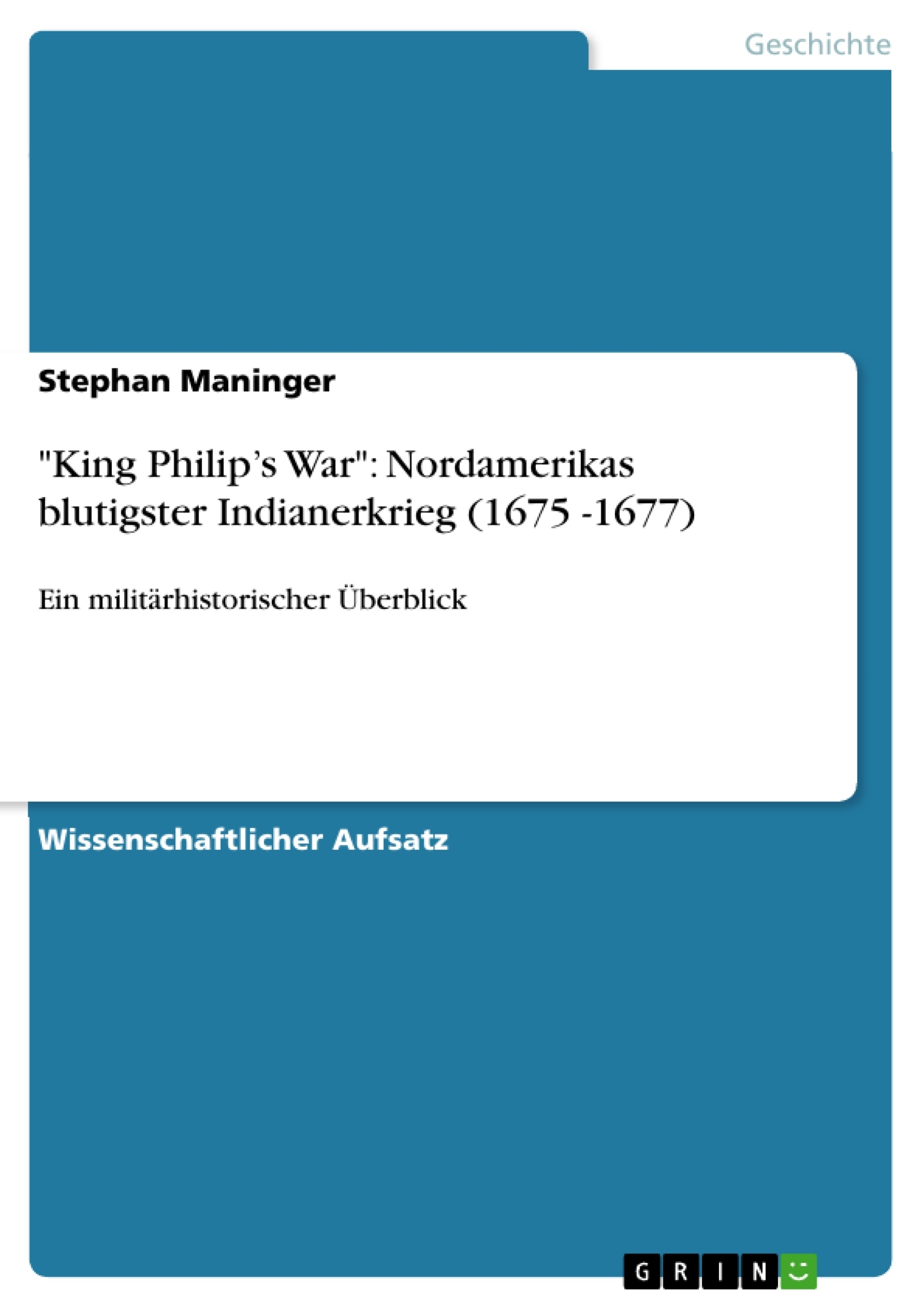Bei dessen Ausbruch im Sommer 1675 konnte niemand voraussehen, dass dies der blutigste Krieg in der gesamten Besiedlungsgeschichte jener Gebiete werden würde, die später als die Vereinigten Staaten von Amerika bekannt wurden. Die Folgen des als „King Philip‘s War“ bekannten Konfliktes waren für beide Seiten gravierend. Die Ureinwohner im heutigen Neuengland verloren den Rest ihrer Unabhängigkeit und wurden dezimiert. Die beteiligten „Vereinigten Kolonien“, 1636 gegründet und bestehend aus den Kolonien Plymouth, Massachusetts Bay, Connecticut und Rhode Island waren bankrott und erhielten wenige Jahre später eine direkte Kolonialverwaltung. Der folgende Beitrag beschäftigt sich mit den Ursachen und dem Verlauf dieser blutigen Auseinandersetzung im 17. Jahrhundert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Kontrahenten und das Land
- Die Ureinwohner
- Die Kolonien
- Das Land
- Ursachen des Krieges
- Der Weg in den Krieg
- Der Sommerfeldzug
- Metacoms Flucht
- Neuengland in der Defensive
- Der Winterfeldzug
- Die Sumpffestung
- „Philips" Wendepunkt
- Der Tiefpunkt
- Die militärische Wende
- Die Offensive
- Die Jagd nach „Philip"
- Abschließende Operationen
- Zwischen den Fronten zerrieben
- Die Bilanz
- Quellenangaben und Anmerkungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text bietet einen militärhistorischen Überblick über den „King Philip's War", der zwischen 1675 und 1677 in Nordamerika stattfand. Er beleuchtet die Ursachen, den Verlauf und die Folgen dieses Konflikts, der als einer der blutigsten Indianerkriege in der Geschichte der Vereinigten Staaten gilt.
- Die kulturellen und politischen Unterschiede zwischen den Ureinwohnern und den europäischen Kolonisten
- Die Rolle der Kriegsführung in der indianischen Gesellschaft
- Die militärischen Strategien und Taktiken beider Seiten
- Die Auswirkungen des Krieges auf die indianische Bevölkerung und die Kolonisten
- Die Folgen des Krieges für die Beziehungen zwischen den Ureinwohnern und den Kolonisten
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Krieg in den Kontext der Besiedlungsgeschichte Nordamerikas und beschreibt die dramatischen Ereignisse, die zum Tod von Metacom, dem Anführer der Wampanoag, führten.
Das zweite Kapitel beleuchtet die Kontrahenten des Krieges, die Ureinwohner und die europäischen Kolonisten. Es beschreibt die politischen und sozialen Strukturen der verschiedenen Stämme und die Herausforderungen, die sich für die Kolonisten aus der Eroberung des Landes ergaben.
Das dritte Kapitel analysiert die Ursachen des Krieges, die sich aus dem zunehmenden Bevölkerungsdruck, der Landfrage und der Veränderung der interkulturellen Beziehungen zwischen den Ureinwohnern und den Kolonisten ergaben.
Das vierte Kapitel beschreibt den Weg in den Krieg, die Eskalation der Spannungen und die Ereignisse, die den Ausbruch der Feindseligkeiten auslösten.
Das fünfte Kapitel beschreibt den Sommerfeldzug, die militärischen Aktionen der Kolonisten und die Flucht von Metacom.
Das sechste Kapitel beschreibt den Winterfeldzug, die Offensive der Kolonisten gegen die Narragansetts und die militärischen Rückschläge für Metacom.
Das siebte Kapitel beschreibt die militärische Wende im Krieg, die Offensive der Kolonisten, die Jagd nach Metacom und das Ende des Kampfes.
Das achte Kapitel beleuchtet die Folgen des Krieges für die Beziehungen zwischen den Ureinwohnern und den Kolonisten, die Rolle der christlichen Indianer und die Auswirkungen des Krieges auf die interkulturellen Beziehungen.
Das neunte Kapitel bietet eine Bilanz des Krieges, die die Verluste auf beiden Seiten, die Auswirkungen auf die indianische Bevölkerung und die Folgen für die Kolonisten zusammenfasst.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den „King Philip's War", die Ureinwohner Nordamerikas, die europäischen Kolonisten, die Kriegsführung, die kulturellen und politischen Unterschiede, die militärischen Strategien und Taktiken, die Auswirkungen des Krieges und die Beziehungen zwischen den Ureinwohnern und den Kolonisten.
- Citar trabajo
- Dr. Stephan Maninger (Autor), 2014, "King Philip’s War": Nordamerikas blutigster Indianerkrieg (1675 -1677), Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/266781