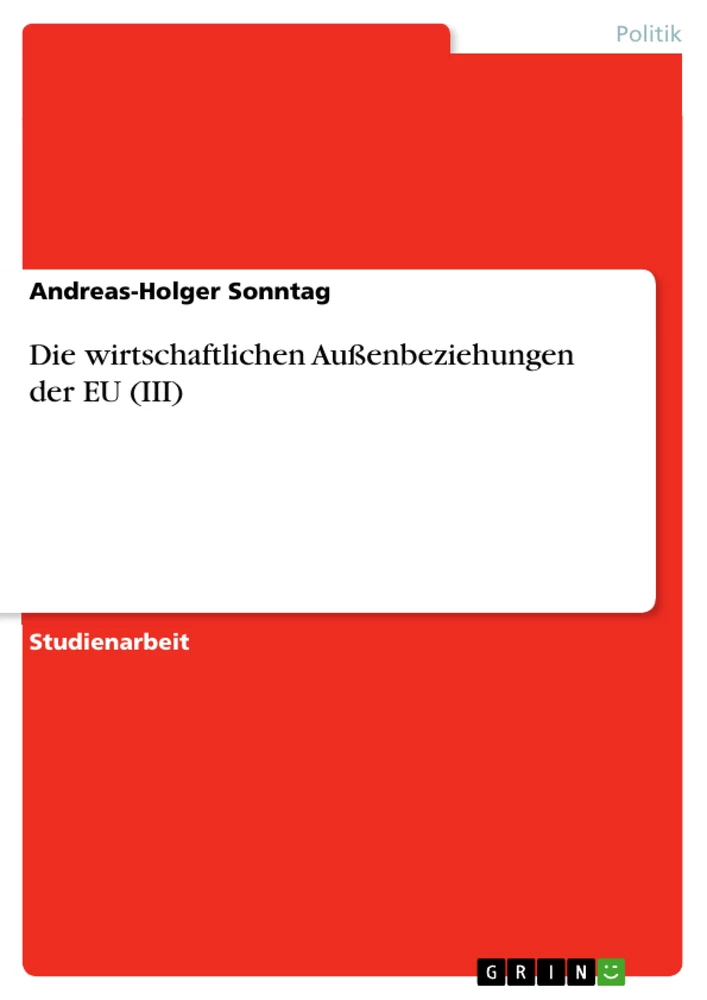"Die grundsätzliche Herausforderung, der sich die internationale Gemeinschaft stellen muss heutzutage, ist, dafür zu sorgen, dass die Globalisierung eine positive Kraft für die gesamte Menschheit darstellt. Denn auch wenn die Globalisierung grundsätzlich beachtliche Chancen bietet, sind derzeit die Lasten, die sie fordert, ungleich verteilt. Die EU verschreibt sich daher im Bereich der Entwicklung der Logik einer besseren Beherrschung der Globalisierung und erstrebt eine Optimalisierung ihrer Vorteile und eine gleichmäßigere Verteilung der Früchte der Globalisierung an, um global zu Frieden und Stabilität beizutragen“. Mit dieser Erklärung unterstrichen der Rat, das Europäische Parlament und die Kommission den Stellenwert der EU-Entwicklungspolitik für die gesamte Europäische Union.
Im Vergleich zur anderen Ressorts der EU-Kommission wie beispielsweise der Außen- und Sicherheitspolitik oder der Binnenmarkt- und Dienstleistungspolitik war die EU-Entwicklungspolitik in den letzten Jahren recht selten Gegenstand des öffentlichen Interesses. Obgleich der finanzielle Rahmen des Entwicklungshaushalts sich auf rund 8 Mrd. Euro beziffert.
Dieses Öffentlichkeitsdefizit änderte sich mit der Ankündigung der EU-Kommission den neuen mehrjährigen Finanzrahmen für die EU-Entwicklungspolitik nahezu konstant zu halten – trotz sinkendem Gesamt-budget innerhalb der Europäischen Staatengemeinschaft. Damit beläuft sich der neue Entwicklungsetat der EU für die Jahre 2014-2020 auf 58,7 Mrd. Euro und ist damit knapp 400 Millionen Euro höher als in den Jahren zwischen 2007 und 2013.
Gut 45 Mrd. Euro hat die Kommission in der ablaufenden Siebenjahresperiode für Entwicklungspolitik ausgegeben und rangiert damit hinter den Vereinigten Staaten und knapp vor Japan als zweitgrößten Geber der Welt. Rechnet man die bilateralen Programme der Mitgliedstaaten mit, bringt die EU drei Fünftel aller Entwicklungshilfe auf.
Um nun die Historie der Entwicklungspolitik, welche eng mit der Europäischen Integration verknüpft ist, klarer darzustellen sowie das Verhältnis zu den AKP-Staaten besser fassen zu können und idealerweise genaue Informationen über die zukünftigen Veränderungen bereitzustellen, habe ich mich in meiner kurzen Seminararbeit eingehend mit der Thematik beschäftigt, deren Ergebnisse Sie mit dieser Arbeit in Händen halten.
Inhaltsverzeichnis
- Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- Einleitung
- Aufbau der Arbeit
- Historische Aufarbeitung des kolonialen Erbes
- Ziele der globalen entwicklungspolitischen Rolle
- Handel und regionale Integration
- Umwelt und nachhaltige Bewirtschaftung der natürlichen Ressourcen
- Infrastruktur, Kommunikation und Verkehr
- Wasser und Energie
- ländliche Entwicklung, Raumplanung, Landwirtschaft und Ernährungssicherheit
- Staatsführung, Demokratie, Menschenrechte und Unterstützung wirtschaftlicher und institutioneller Reformen
- Konfliktprävention und fragile Staaten
- menschliche Entwicklung
- sozialer Zusammenhalt und Beschäftigung
- Die AKP-EU Beziehungen — von Yaounde über Lomé bis Cotonou
- Resümee
- Literaturverzeichnis
- Anhang
- AKP-Länder
- Die drei Säulen der Europäischen Union (sog. Tempelkonstruktion)
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit befasst sich mit den wirtschaftlichen Außenbeziehungen der EU, insbesondere im Kontext der Entwicklungspolitik gegenüber den AKP-Staaten. Ziel der Arbeit ist es, die historische Entwicklung der EU-Entwicklungspolitik aufzuzeigen, die Ziele und Prinzipien der Zusammenarbeit zu erläutern und die Veränderungen der Beziehungen zwischen der EU und den AKP-Staaten von den Yaoundé-Abkommen über die Lomé-Verträge bis hin zum Cotonou-Abkommen zu analysieren.
- Die historische Entwicklung der EU-Entwicklungspolitik
- Die Ziele und Prinzipien der EU-Entwicklungspolitik
- Die AKP-EU Beziehungen im Wandel
- Die Bedeutung von Menschenrechten und Demokratie in der Entwicklungszusammenarbeit
- Die Herausforderungen der EU-Entwicklungspolitik im 21. Jahrhundert
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die den Stellenwert der EU-Entwicklungspolitik für die Europäische Union hervorhebt und das Öffentlichkeitsdefizit der Entwicklungspolitik in den letzten Jahren beleuchtet. Sie führt außerdem in die Thematik der Seminararbeit ein und erläutert den Aufbau der Arbeit.
Das dritte Kapitel befasst sich mit der historischen Aufarbeitung des kolonialen Erbes. Es zeigt die enge Verknüpfung der EU-Entwicklungspolitik mit den Anfängen des europäischen Integrationsprozesses und der Nachkriegsgeschichte Europas auf. Die europäischen Entwicklungsmaßnahmen begannen 1963 mit den Yaoundé-Abkommen, die den Aufbau einer Freihandelszone zwischen der damaligen Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und den ehemaligen Kolonien einiger Mitgliedsländer vorsahen. Nach dem Beitritt Großbritanniens in die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (1973) erweiterte sich der Kreis der Kooperationsländer und die Art der Entwicklungszusammenarbeit. Ab 1975 wurden die Vorhaben als Lomé-Abkommen in Abständen von fünf bzw. zehn Jahren regelmäßig fortgeführt. Die Lomé-Abkommen wurden von 2000 an durch das Cotonou-Abkommen abgelöst, das eine längere Laufzeit und die Überprüfung der Vertragsbedingungen alle fünf Jahre vorsieht.
Das vierte Kapitel beschreibt die Inhalte und Ziele der EU-Entwicklungspolitik. Es zeigt, dass die Europäische Entwicklungshilfe sich seit ihrem Beginn im Jahre 1958 stark gewandelt hat. Dies lag zum einen an der neuen weltpolitischen Lage nach dem Zusammenbruch des Eisernen Vorhangs und zum anderen daran, dass sich die EU stärker an den Zielen der Vereinten Nationen auszurichten scheint. Der Schwerpunkt der EU-Entwicklungspolitik liegt in den letzten Jahren zunehmend auf Konfliktprävention und -bearbeitung. Die EU verfügt seit dem Jahr 2005 über ein umfassendes Rahmendokument für die europäische Entwicklungspolitik, den „Konsens über Entwicklung", in dem die gemeinsamen Ziele, Werte und Grundsätze dargelegt werden. Das Kapitel geht außerdem auf die Bedeutung von Menschenrechten und Demokratie in der Entwicklungszusammenarbeit ein und erläutert die Instrumente der Demokratieförderung, wie die politische Konditionalität und die Positivmaßnahmen.
Das fünfte Kapitel befasst sich mit den Beziehungen der AKP-Staaten und der EU. Es betrachtet zunächst das Yaoundé-Abkommen, dann die Grundprinzipien der Lomé-Verträge und stellt abschließend beim Cotonou-Abkommen die neuesten Veränderungen gegenüber. Das Kapitel erläutert die wichtigsten Elemente der Lomé-Abkommen, wie das System zur Stabilisierung der Exporterlöse (STABEX), die Handelspolitik und die finanzielle Zusammenarbeit. Es zeigt außerdem die Herausforderungen der AKP-EU Beziehungen im Kontext der Globalisierung und der WTO-Kompatibilität auf.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die EU-Entwicklungspolitik, die AKP-Staaten, die Yaoundé-Abkommen, die Lomé-Verträge, das Cotonou-Abkommen, die Handelspolitik, die finanzielle Zusammenarbeit, die Menschenrechte, die Demokratie und die Herausforderungen der Entwicklungszusammenarbeit im 21. Jahrhundert.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die AKP-Staaten?
AKP steht für Afrika, Karibik und Pazifik. Es handelt sich um eine Gruppe von Staaten, die eine besondere partnerschaftliche Beziehung zur EU unterhalten, die historisch aus der Kolonialzeit gewachsen ist.
Was ist das Cotonou-Abkommen?
Es ist das zentrale Partnerschaftsabkommen zwischen der EU und den AKP-Staaten (seit 2000), das auf den Säulen politische Dimension, wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklungszusammenarbeit basiert.
Welche Ziele verfolgt die EU-Entwicklungspolitik?
Zu den Hauptzielen gehören die Armutsbekämpfung, nachhaltige Entwicklung, Förderung von Menschenrechten und Demokratie sowie die Integration der AKP-Staaten in den Welthandel.
Wie hat sich die Entwicklungshilfe finanziell verändert?
Trotz sinkender Gesamtbudgets blieb der Etat für Entwicklungspolitik (z.B. 58,7 Mrd. Euro für 2014-2020) nahezu konstant, was den hohen Stellenwert dieses Ressorts unterstreicht.
Was bedeutet 'politische Konditionalität'?
Es bedeutet, dass die Gewährung von Entwicklungshilfe an Bedingungen geknüpft ist, wie etwa die Einhaltung von Menschenrechten und demokratischen Grundsätzen in den Partnerländern.
- Arbeit zitieren
- Andreas-Holger Sonntag (Autor:in), 2013, Die wirtschaftlichen Außenbeziehungen der EU (III), München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/266868