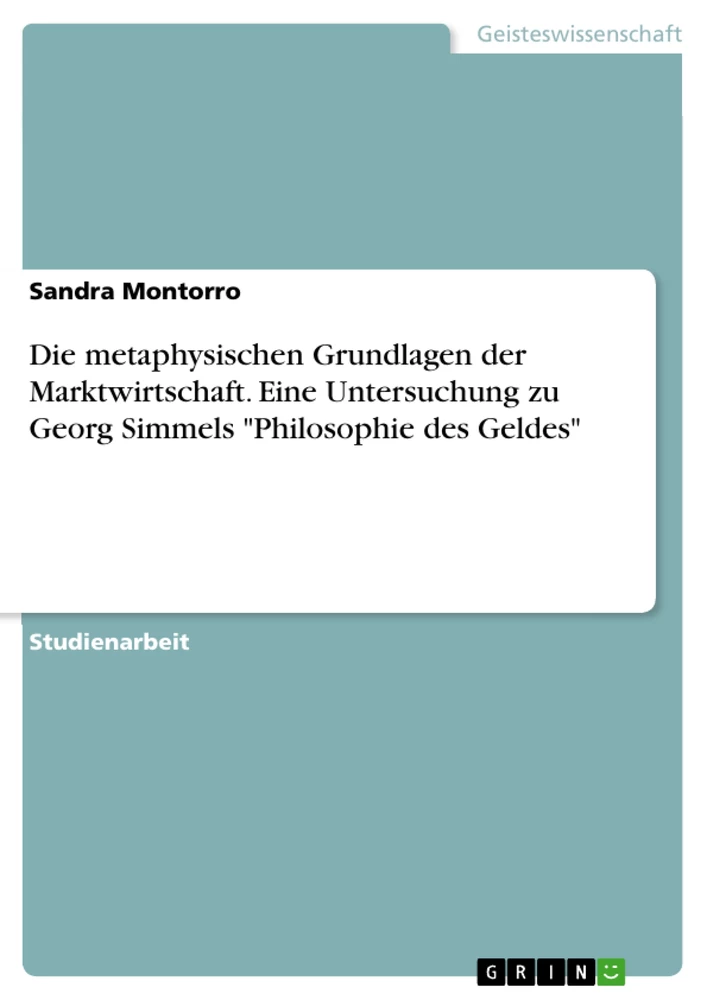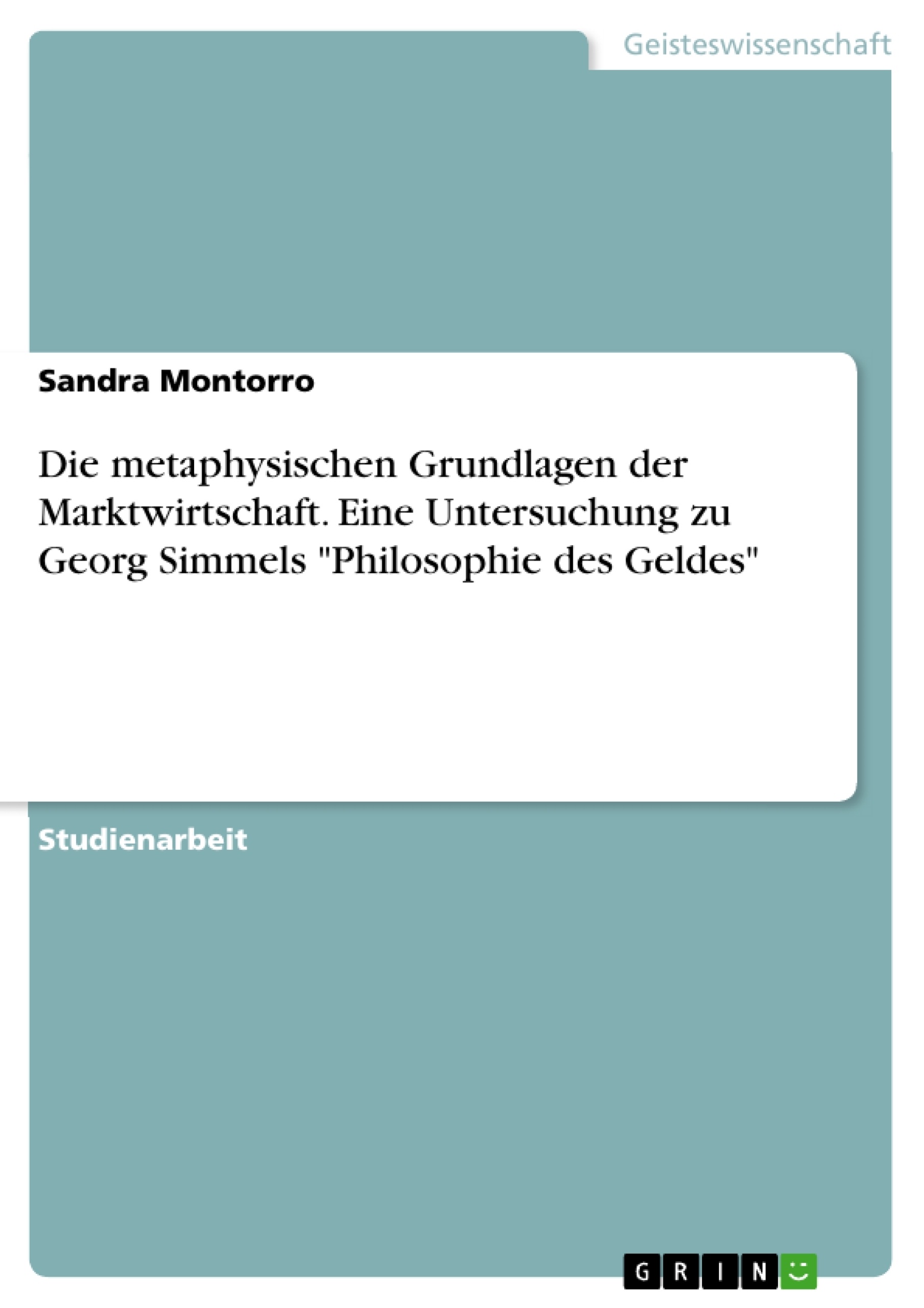In der Vorrede zu seiner „Philosophie des Geldes“ aus dem Jahr 1900 stellt Georg Simmel klar, dass das Ziel seiner Arbeit keineswegs in der Förderung nationalökonomischer Erkenntnisse liegt. Vielmehr sieht er in der kapitalistisch ausgerichteten Gesellschaftsordnung seiner Zeit die Widerspiegelung eines von mehreren rivalisierenden „Weltbilder[n], das ich für den angemessensten Ausdruck der gegenwärtigen Wissensinhalte und Gefühlsrichtungen halte“ . Das Ansinnen des Soziologen Simmel besteht demzufolge vorrangig darin, das vorherrschende Weltbild und die Werthaltung seiner Zeitgenossen zu untersuchen und darzustellen. Dabei bezieht er klar Stellung gegen die marxistische Werttheorie. Der Unterschied seines Ansatzes zu dem von Marx soll aus diesem Grund verdeutlicht werden. In der kritischen Betrachtung der modernen Gesellschaft finden sich durchaus auch Übereinstimmungen zwischen den beiden Wissenschaftlern. Es stellt sich die Frage, ob Simmel, wenn er von der Vernachlässigung der Kultivierung der Persönlichkeit spricht nicht die gleichen Entwicklungen bezeichnet wie Marx, der die Entfremdung als großes Problem der Moderne wahrnimmt.
Simmel wählt philosophische Untersuchungsmethoden. Dies begründet er damit, dass sich diese Disziplin zum einen eine besonders differenzierte Definition der Grundbegriffe zur Aufgabe gemacht hat. Zum anderen basiert jedes Weltbild auf metaphysischen Grundlagen, deren Erforschung den Einzelwissenschaften verwehrt bleibt, „weil sie keinen Schritt ohne Beweis, also ohne Voraussetzung sachlicher und methodischer Natur, tun“.
Der Untersuchungsgegenstand des Geldes eignet sich in besonderem Maße, um Simmels Vorhaben gerecht zu werden, da die Funktion des Geldes darin besteht, den Wert der Gegenstände – scheinbar objektiv – zu fixieren. Inwieweit dies tatsächlich der Fall ist, soll in dieser Arbeit geklärt werden.
Doch zunächst müssen die Grundbegriffe erläutert werden. Es soll dargestellt werden, wie Weltbild und Wertbegriff zusammenhängen. Darüber hinaus muss auf den Unterschied zwischen objektiven, subjektiven und ideellen Werten eingegangen werden. Da es bei einem Weltbild um das Fürwahrhalten geht, ist es sinnvoll die in der „Philosophie des Geldes“ vertretene Wahrheitstheorie zu betrachten.
In einem zweiten Schritt sollen die Voraussetzungen für die Entstehung der Marktwirtschaft erläutert werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Definition des Begriffs Weltbild
- Die Bedeutung des Wertes für das Weltbild
- Entstehung von Werten
- Objektivierung von Werten
- Der ideelle Wert
- Weltbild und Wahrheit
- Die Bedeutung des Wertes für das Weltbild
- Voraussetzungen für ökonomische Prozesse
- Intellektualisierung der Gesellschaft
- Die kulturelle Errungenschaft des Tauschs
- Einführung des Geldes als Wertäquivalent
- Die Rückwirkungen der Marktwirtschaft auf das Weltbild
- Geld als Endzweck
- Auswirkungen auf die persönliche Freiheit
- Vernachlässigung der Kultivierung der Persönlichkeit
- Fazit und Kritik
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit befasst sich mit Georg Simmels „Philosophie des Geldes" und untersucht die metaphysischen Grundlagen der Marktwirtschaft und deren Auswirkungen auf das Welt- und Menschenbild. Die Arbeit analysiert Simmels Ansatz im Kontext der kapitalistischen Gesellschaftsordnung seiner Zeit und setzt sich kritisch mit der marxistischen Werttheorie auseinander.
- Die Bedeutung des Wertbegriffs für das Weltbild
- Die Entstehung von Werten und die Unterscheidung zwischen objektiven, subjektiven und ideellen Werten
- Die Voraussetzungen für die Entstehung der Marktwirtschaft, insbesondere die Intellektualisierung der Gesellschaft, die kulturelle Errungenschaft des Tauschs und die Einführung des Geldes als Wertäquivalent
- Die Rückwirkungen der Marktwirtschaft auf das Welt- und Menschenbild, einschließlich der Rolle des Geldes als Endzweck, der Auswirkungen auf die persönliche Freiheit und der Vernachlässigung der Kultivierung der Persönlichkeit
- Eine kritische Betrachtung von Simmels teleologischem Geschichtsverständnis und dessen Implikationen für die moderne Gesellschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in die Thematik ein und stellt die Zielsetzung der Arbeit dar. Es wird erläutert, dass Simmels „Philosophie des Geldes" nicht primär nationalökonomische Erkenntnisse liefern soll, sondern die vorherrschende Werthaltung und das Weltbild seiner Zeitgenossen untersucht.
Das zweite Kapitel definiert den Begriff „Weltbild" und verdeutlicht die Bedeutung des Wertbegriffs für die menschliche Weltwahrnehmung. Simmels Werttheorie wird vorgestellt und in Bezug auf die Ansätze von Kant und Marx diskutiert. Es wird argumentiert, dass der Wert nicht nur objektiv oder subjektiv, sondern auch ideell sein kann und eine eigene Kategorie darstellt.
Das dritte Kapitel untersucht die Voraussetzungen für die Entstehung der Marktwirtschaft. Simmel argumentiert, dass die Intellektualisierung der Gesellschaft, die kulturelle Errungenschaft des Tauschs und die Einführung des Geldes als Wertäquivalent die entscheidenden Faktoren für die Entwicklung des Kapitalismus sind.
Das vierte Kapitel analysiert die Rückwirkungen der Marktwirtschaft auf das Welt- und Menschenbild. Es wird gezeigt, wie das Geld als Endzweck fungiert und die persönliche Freiheit beeinflusst. Simmels Analyse der Vernachlässigung der Kultivierung der Persönlichkeit wird vorgestellt und in Bezug auf Marx' Entfremdungstheorie diskutiert.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Marktwirtschaft, das Weltbild, das Menschenbild, Georg Simmel, Philosophie des Geldes, Wert, Intellektualisierung, Tausch, Geld, Freiheit, Entfremdung, Kultivierung der Persönlichkeit, Teleologie, Kapitalismus, Marx, Kant.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptthema von Simmels "Philosophie des Geldes"?
Simmel untersucht das vorherrschende Weltbild und die Werthaltungen seiner Zeit, wobei er Geld als zentrales Medium der Wertfixierung analysiert.
Wie unterscheidet sich Simmels Ansatz von Karl Marx?
Während Marx die ökonomische Entfremdung betont, fokussiert Simmel auf die metaphysischen Grundlagen und die Vernachlässigung der Kultivierung der Persönlichkeit.
Was sind laut Simmel Voraussetzungen für die Marktwirtschaft?
Dazu gehören die Intellektualisierung der Gesellschaft, die kulturelle Errungenschaft des Tauschs und die Etablierung des Geldes als Wertäquivalent.
Wie wirkt sich Geld auf die persönliche Freiheit aus?
Geld ermöglicht einerseits eine größere Distanz und Freiheit, führt aber laut Simmel auch dazu, dass es zum reinen Endzweck wird und die Persönlichkeit verflacht.
Was ist der Unterschied zwischen objektiven und subjektiven Werten?
Simmel analysiert, wie subjektive Bedürfnisse durch das Geld in scheinbar objektive Werte transformiert werden, die unabhängig vom Individuum existieren.
- Citation du texte
- Sandra Montorro (Auteur), 2012, Die metaphysischen Grundlagen der Marktwirtschaft. Eine Untersuchung zu Georg Simmels "Philosophie des Geldes", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/266924