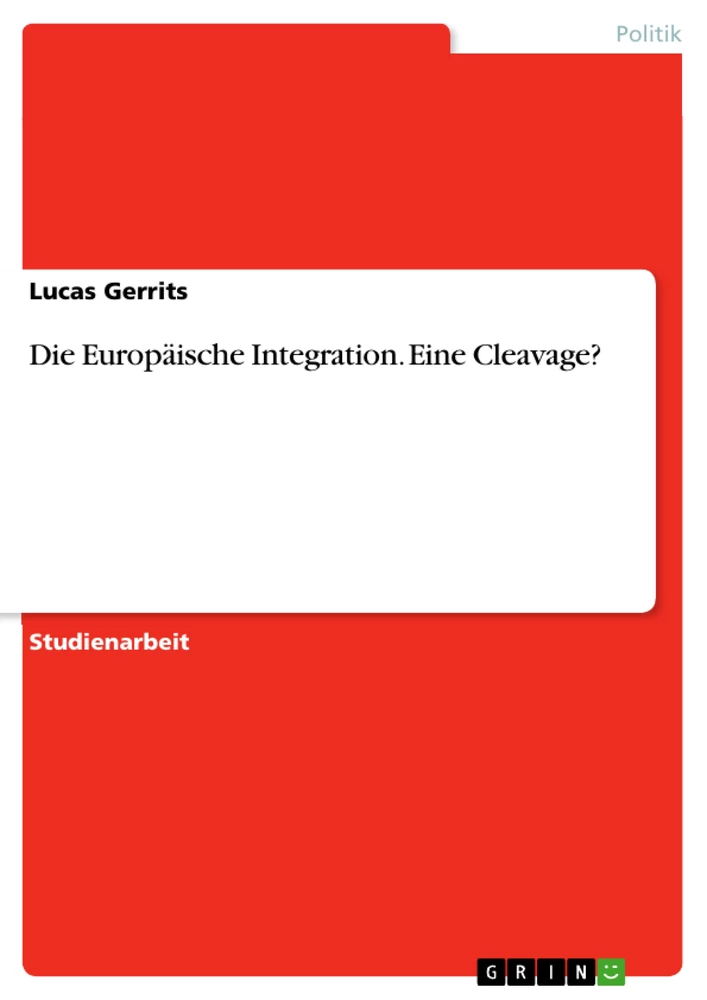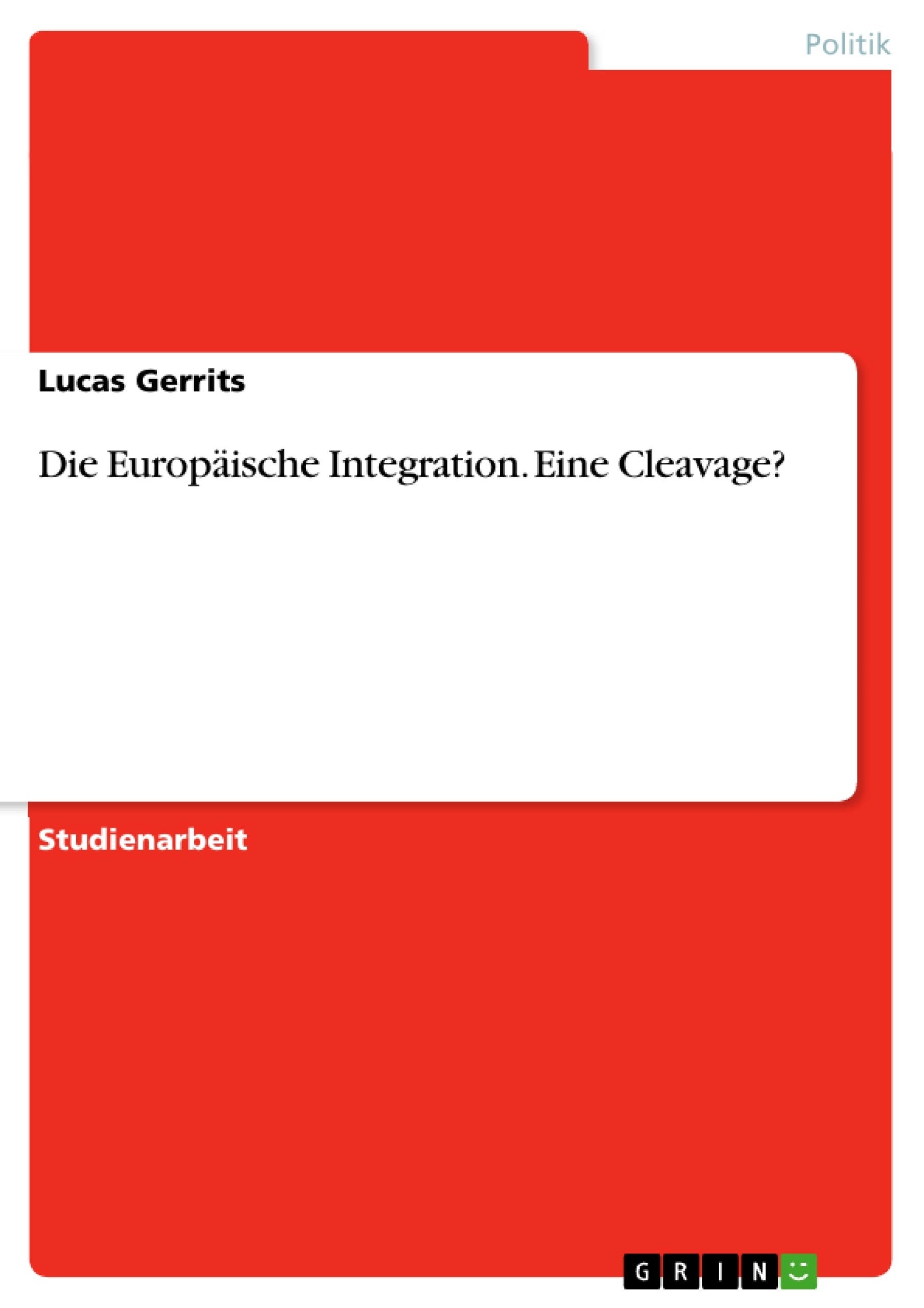Die Europäische Integration hat die Politik und Gesellschaft der daran beteiligten Länder maßgeblich gewandelt. Kompetenzen der Nationalstaaten wurden auf die europäische, supranationale Ebene verlagert, wodurch sich ihr Handlungsrahmen geändert hat. Er hat die politischen Parteien vor neue Aufgaben gestellt und sich auf ihre Programme ausgewirkt. In jüngsten Nationalwahlen haben rechtspopulistische und euroskeptische Parteien wie die „Wahren Finnen“ in Finnland, die FPÖ in Österreich oder die „Partei für die Freiheit“ in den Niederlanden große Erfolge einfahren können. Dabei erhielten sie auch aufgrund ihrer expliziten Positionen gegen den Europäischen Integrationsprozess hohen Zulauf. Vor allem durch die gegenwärtigen Eurokrise hat sich der politische Konflikt innerhalb der Nationalstaaten verschärft. Während einige PolitikerInnen und Parteien mehr Kompetenzen für die Europäische Union (EU) fordern, um die Probleme der Wirtschafts- und Finanzkrise zu lösen, wollen andere dies zum Schutz der nationalstaatlichen Souveränität verhindern und die Befugnisse der EU zurückdrängen. Diese Debatte und die daraus resultierenden Handlungen der politischen Akteure kann die Zukunft des Euros, den Verbleib des Staatenverbundes EU und damit das Leben der zukünftigen Generationen bestimmen. Ob es sich bei der Europäischen Integration um einen tiefgreifenden gesellschaftlichen Konflikt handelt, welcher sich auf die europäischen Parteiensysteme ausgewirkt hat...
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Cleavage-Theorie
- Die Cleavage-Theorie von Lipset und Rokkan
- Definitionen und notwendige Elemente einer Cleavage
- Die Europäische Integration und ihre Folgen
- Charakterisierung der Europäischen Integration anhand eines historischen Umrisses
- Konflikte durch die Europäische Integration
- Analyse anhand der notwendigen Elemente von Bartolini und Mair und der Auswirkung auf die politische Ordnung
- Das empirische Element: Die Sozialstruktur — Der Versuch einer Herleitung anhand der Einstellungen zum Europäischen Integrationsprozess
- Das normative Element: Die Gruppenidentität
- Das organisatorische/Verhaltens-Element: Der organisatorische Ausdruck
- Die Auswirkung auf die politische Ordnung und die europäischen Parteiensysteme
- Fazit und Ausblick
- Abkürzungsverzeichnis
- Literaturverzeichnis
- Monographien
- Zeitschriftenaufsätze
- Beiträge in herausgegebenen Büchern
- Arbeitspapiere
- Internetseiten
- Offizielles Dokument
- Datensatz
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit untersucht, ob die Europäische Integration als ein tiefgreifender gesellschaftlicher Konflikt betrachtet werden kann, der sich auf die europäischen Parteiensysteme ausgewirkt hat. Hierzu wird zunächst die Cleavage-Theorie von Lipset und Rokkan sowie der Prozess der Europäischen Integration und dessen Folgen beleuchtet. Anschließend wird anhand der drei notwendigen Elemente von Bartolini und Mair analysiert, ob es sich bei der Europäischen Integration um eine Cleavage handelt oder um einen von vielen politischen Konflikten.
- Die Entstehung und Entwicklung der Cleavage-Theorie
- Die Europäische Integration als politischer und gesellschaftlicher Prozess
- Die Auswirkungen der Europäischen Integration auf die politische Ordnung
- Die Rolle von Parteiensystemen im Kontext der Europäischen Integration
- Die Analyse der Europäischen Integration anhand der drei notwendigen Elemente von Bartolini und Mair
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Hausarbeit ein und stellt die Forschungsfrage nach der Relevanz der Europäischen Integration als Cleavage für die europäischen Parteiensysteme. Kapitel 2 beleuchtet die Cleavage-Theorie von Lipset und Rokkan, die die Entstehung von Parteiensystemen auf gesellschaftliche Spannungslinien zurückführt. Es werden die vier grundlegenden Cleavages erläutert und ihre Bedeutung für die Entwicklung von Parteiensystemen in Europa dargestellt. Anschließend werden Definitionen und notwendige Elemente einer Cleavage diskutiert, wobei der Fokus auf die drei notwendigen Elemente von Bartolini und Mair liegt. Kapitel 3 beleuchtet den Prozess der Europäischen Integration und seine Folgen für die Politik und Gesellschaft der beteiligten Länder. Es wird ein historischer Überblick über die Entwicklung der Europäischen Integration gegeben und die wichtigsten Stationen und Meilensteine dargestellt. Anschließend werden die Konflikte und Spannungen analysiert, die aus der Europäischen Integration entstanden sind.
Kapitel 4 analysiert die Europäische Integration anhand der drei notwendigen Elemente von Bartolini und Mair, um zu beurteilen, ob es sich um eine Cleavage handelt. Das empirische Element wird anhand der Einstellungen zum Europäischen Integrationsprozess untersucht, wobei die Theorien der „utilitarian self-interest" und der „national identity perspectives" betrachtet werden. Das normative Element wird anhand der Gruppenidentität der „Gewinner" und „Verlierer" der Europäischen Integration analysiert. Das organisatorische/Verhaltens-Element wird anhand des organisatorischen Ausdrucks der Europäischen Integration in Form von politischen Parteien betrachtet. Kapitel 5 fasst die Ergebnisse der Analyse zusammen und zieht ein Fazit. Es wird diskutiert, ob die Europäische Integration als Cleavage betrachtet werden kann und welche zukünftigen Entwicklungen zu erwarten sind.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Cleavage-Theorie, die Europäische Integration, Parteiensysteme, politische Ordnung, Sozialstruktur, Gruppenidentität, organisatorischer Ausdruck, „Gewinner" und „Verlierer" der Europäischen Integration. Der Text analysiert die Europäische Integration anhand der drei notwendigen Elemente von Bartolini und Mair, um zu beurteilen, ob es sich um eine Cleavage handelt und welche Auswirkungen sie auf die europäischen Parteiensysteme hat.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Cleavage-Theorie?
Die Theorie von Lipset und Rokkan besagt, dass Parteisysteme auf tiefgreifenden gesellschaftlichen Spannungslinien (Cleavages) basieren, wie z. B. Arbeit vs. Kapital oder Staat vs. Kirche.
Kann die Europäische Integration als neue Cleavage gewertet werden?
Die Arbeit untersucht, ob der Konflikt zwischen Befürwortern und Gegnern der EU die notwendigen Elemente (Sozialstruktur, Identität, Organisation) einer echten Cleavage erfüllt.
Wer sind die „Gewinner“ und „Verlierer“ der Integration?
„Gewinner“ sind oft hochqualifizierte, mobilere Schichten, während „Verlierer“ sich durch Souveränitätsverlust und wirtschaftlichen Wettbewerbsdruck bedroht fühlen, was sich in Wahlerfolgen euroskeptischer Parteien zeigt.
Welche Auswirkungen hat die Eurokrise auf diesen Konflikt?
Die Krise hat den politischen Konflikt verschärft: Während einige mehr EU-Kompetenzen fordern, wollen rechtspopulistische Parteien die nationalstaatliche Souveränität zurückdrängen.
Welche Kriterien nutzen Bartolini und Mair zur Definition einer Cleavage?
Sie definieren drei Elemente: ein empirisches (Sozialstruktur), ein normatives (Gruppenidentität) und ein organisatorisches (politischer Ausdruck durch Parteien).
- Citation du texte
- Lucas Gerrits (Auteur), 2011, Die Europäische Integration. Eine Cleavage?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/266952