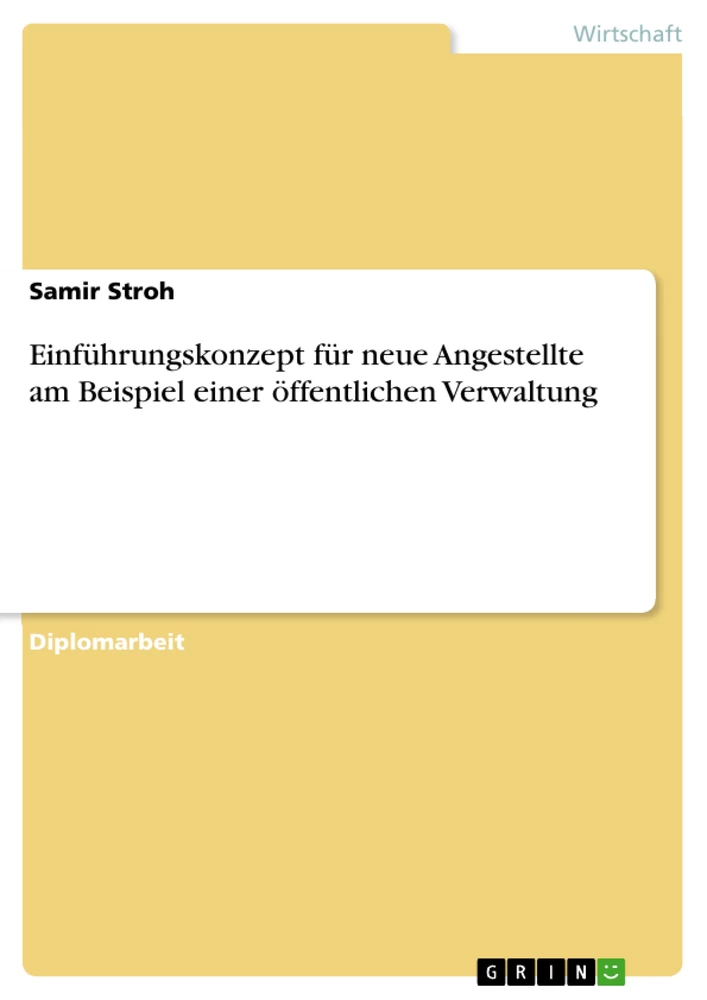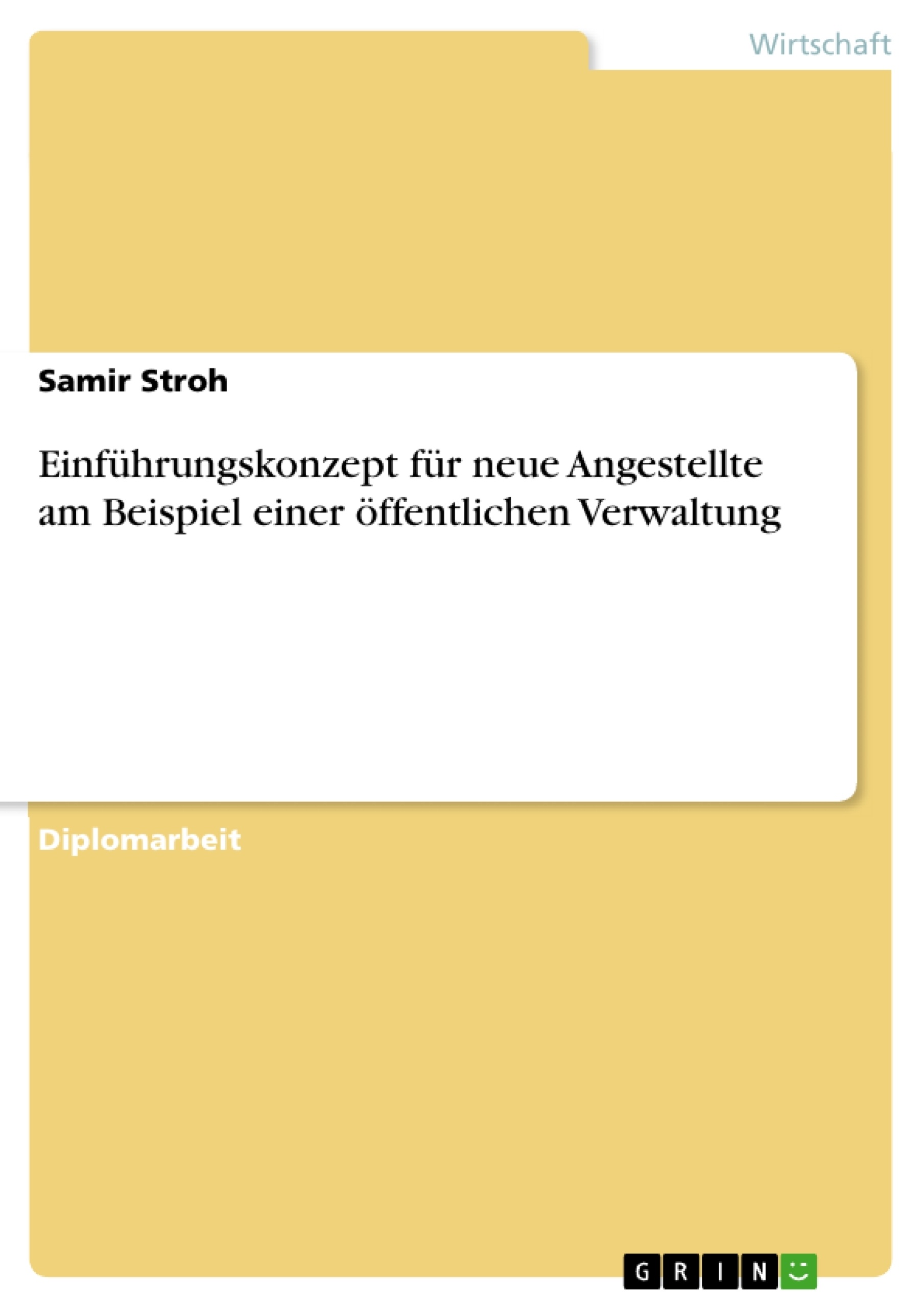Die Auswahl und Einarbeitung von qualifiziertem Personal ist mit hohen Kosten und viel Aufwand verbunden.
Die Einarbeitung der neuen Mitarbeiter geschieht häufig unsystematisch und ist sehr stark von der jeweiligen Abteilungsleitung abhängig.
Gerade die Einführung und die ersten Tage eines neuen Mitarbeiters in einem Unternehmen haben einen wesentlichen Einfluss auf den Erfolg oder Misserfolg seiner zukünftigen Arbeit, die Länge seiner Beschäftigung und seine Identifikation mit dem Unternehmen.
Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, ein Einführungskonzept zu erarbeiten.
Dabei wird zuerst der IST-Zustand mittels eines Umfragebogens erhoben. Bei diesem Umfragebogen haben die Mitarbeiter die Möglichkeit, sich anonym zu ihrem Start zu äussern.
Die Auswertung dieses Fragebogens bildet die Basis für die anschliessende GAP-Analyse. Mit diesem Instrument aus dem strategischen Controlling wird der Soll-Zielwert definiert und mit dem IST-Zustand abgeglichen.
Das Ergebnis der GAP-Analyse wird für die Modellierung des Einarbeitungsprozesses verwendet. Der Einarbeitungsprozess wird in drei Teilprozesse unterteilt:
Teilprozess 1 Von der Vertragsunterschrift bis zum ersten Arbeitstag
Teilprozess 2 Der erste Arbeitstag
Teilprozess 3 Vom zweiten Tag bis zum Ablauf der Probezeit
Als weiteres Ergebnis dieser Diplomarbeit entsteht ein Dossier (Einführungsprozess neuer Mitarbeiter), welches allen Abteilungsleitern abgegeben wird. Dieses bildet das Gerüst und die Wegleitung für den neuen, systematischen und zielgerichteten Einführungsprozess.
Inhaltsverzeichnis
- Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis / Hinweis auf Verzicht der doppelten Ansprache
- Tabellen- und Abbildungsverzeichnis
- Zusammenfassung
- Ausgangslage und Problemstellung
- Ausgangslage
- Problemstellung
- Zielsetzung der Arbeit und Abgrenzungen
- Zielsetzung der Arbeit (nach dem Prinzip SMART)
- Abgrenzungen
- Methodisches Vorgehen
- Fragebogen, Erhebung des IST-Zustandes
- GAP-Analyse
- Modellierung des Hauptprozesses, unterteilt in drei Teilprozesse
- Vorbereitung der Entscheidungsgrundlagen für den Gemeinderat
- Umsetzung
- Fragebogen, Erhebung des IST-Zustandes
- Erstellung des Fragebogens
- Auswertung des Fragebogens
- GAP-Analyse
- Definition GAP-Analyse
- Durchführung der GAP-Analyse
- Zielerreichung (Schliessung der Ziellücke)
- Modellierung des Hauptprozesses, unterteilt in drei Teilprozesse
- Vorgehensweise
- Teilprozess 1: Von der Vertragsunterschrift bis zum ersten Arbeitstag
- Teilprozess 2: Der erste Arbeitstag
- Teilprozess 3: Vom zweiten Tag bis zum Ablauf der Probezeit
- Erläuterung zum Hauptprozess und den Teilprozessen
- Vorbereitung der Entscheidungsgrundlagen für den Gemeinderat
- Fragebogen, Erhebung des IST-Zustandes
- Ausblick
- Selbständigkeitserklärung
- Literatur-, Quellen- und Internetverzeichnis
- Literatur- und Quellenverzeichnis
- Internetverzeichnis
- Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit befasst sich mit der Entwicklung eines Einführungskonzeptes für neue Angestellte der Gemeindeverwaltung Birsfelden. Die Arbeit untersucht die aktuelle Situation der Einarbeitung neuer Mitarbeiter und identifiziert die bestehenden Defizite. Ziel ist es, einen strukturierten und systematischen Einführungsprozess zu schaffen, welcher die Integration neuer Angestellten in die Gemeindeverwaltung Birsfelden erleichtert und optimiert.
- Analyse der aktuellen Einarbeitungsprozesse
- Identifizierung von Defiziten und Verbesserungspotenzial
- Entwicklung eines Einführungskonzeptes nach dem Prinzip SMART
- Modellierung des Einarbeitungsprozesses in drei Teilprozesse
- Vorbereitung der Entscheidungsgrundlagen für den Gemeinderat
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Beschreibung der Gemeinde Birsfelden und der persönlichen Situation des Autors, der die Notwendigkeit eines Einführungskonzeptes aus eigener Erfahrung heraus erkannte. Anschliessend wird die Problemstellung aufgezeigt: Die Gemeindeverwaltung Birsfelden verfügt weder über ein Einführungskonzept noch über einen einheitlichen Einführungsprozess. Dies führt zu einer unsystematischen Einarbeitung neuer Mitarbeiter und kann zu Verunsicherung und mangelnder Integration führen.
Im Kapitel "Zielsetzung der Arbeit und Abgrenzungen" wird das Ziel der Diplomarbeit definiert: Die Entwicklung eines nachhaltigen Einführungskonzeptes für neue Angestellte der Gemeindeverwaltung Birsfelden. Die Zielsetzung wird nach dem Prinzip SMART formuliert und in ein Haupt- und ein Sub-Ziel unterteilt. Die Arbeit grenzt sich dabei von Einarbeitungskonzepten für Lehrlinge, Kaderangestellte und Reinigungspersonal ab.
Das Kapitel "Methodisches Vorgehen" beschreibt die angewandten Methoden zur Erhebung des IST-Zustandes und zur Entwicklung des Einführungskonzeptes. Es werden ein Fragebogen zur anonymen Befragung aller Angestellten und eine GAP-Analyse zur Ermittlung der Differenz zwischen IST- und Soll-Zustand eingesetzt. Die Modellierung des Einarbeitungsprozesses erfolgt in drei Teilprozesse, die jeweils mit einer Checkliste versehen werden.
Das Kapitel "Umsetzung" zeigt die Ergebnisse der durchgeführten Umfrage und der GAP-Analyse auf. Die Ergebnisse der Umfrage zeigen, dass trotz fehlenden Einführungskonzeptes viele Punkte zur Zufriedenheit der neuen Angestellten erledigt werden, es aber in sämtlichen Punkten Verbesserungspotenzial gibt. Die GAP-Analyse zeigt die Differenz zwischen der aktuellen Entwicklung und dem gewünschten Zielzustand auf. Die Ziellücke soll durch die Umsetzung des neuen Einführungskonzeptes geschlossen werden.
Das Kapitel "Ausblick" befasst sich mit den nächsten Schritten nach der Fertigstellung der Diplomarbeit. Es werden die notwendigen Schritte zur Umsetzung des neuen Einführungskonzeptes, wie die Beschlussfassung durch den Gemeinderat, die Schulung der Abteilungsleiter und die Überprüfung der GAP-Analyse in einem zeitlichen Abstand, beschrieben.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen das Einführungskonzept, die Einarbeitung neuer Mitarbeiter, die Gemeindeverwaltung Birsfelden, die GAP-Analyse, das Prinzip SMART, die Checkliste und die Prozessmodellierung. Die Arbeit befasst sich mit der Entwicklung eines systematischen und strukturierten Einführungsprozesses, der die Integration neuer Mitarbeiter in die Gemeindeverwaltung Birsfelden erleichtert und optimiert. Die Arbeit zeigt die Notwendigkeit eines solchen Konzeptes auf, um eine effiziente und effektive Einarbeitung neuer Mitarbeiter zu gewährleisten.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist ein Einführungskonzept für neue Mitarbeiter wichtig?
Die ersten Tage beeinflussen maßgeblich den Erfolg, die Identifikation mit dem Unternehmen und die langfristige Beschäftigungsdauer eines Mitarbeiters.
In welche Teilprozesse wird die Einarbeitung unterteilt?
1. Von der Vertragsunterschrift bis zum 1. Tag, 2. Der erste Arbeitstag, 3. Vom zweiten Tag bis zum Ende der Probezeit.
Was ist eine GAP-Analyse?
Ein Instrument aus dem Controlling, das den IST-Zustand mit dem SOLL-Zielwert abgleicht, um Ziellücken bei der Einarbeitung zu schließen.
Wie wurde der IST-Zustand in Birsfelden erhoben?
Mittels eines anonymen Fragebogens konnten sich die Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung zu ihren Erfahrungen beim Start äußern.
Was ist das Ergebnis der Diplomarbeit?
Es entstand ein Dossier als Wegleitung für alle Abteilungsleiter, um einen systematischen und zielgerichteten Einführungsprozess zu gewährleisten.
Was bedeutet das Prinzip SMART in diesem Kontext?
Die Ziele des Einführungskonzepts wurden spezifisch, messbar, akzeptiert, realistisch und terminiert formuliert.
- Quote paper
- Samir Stroh (Author), 2011, Einführungskonzept für neue Angestellte am Beispiel einer öffentlichen Verwaltung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/266958