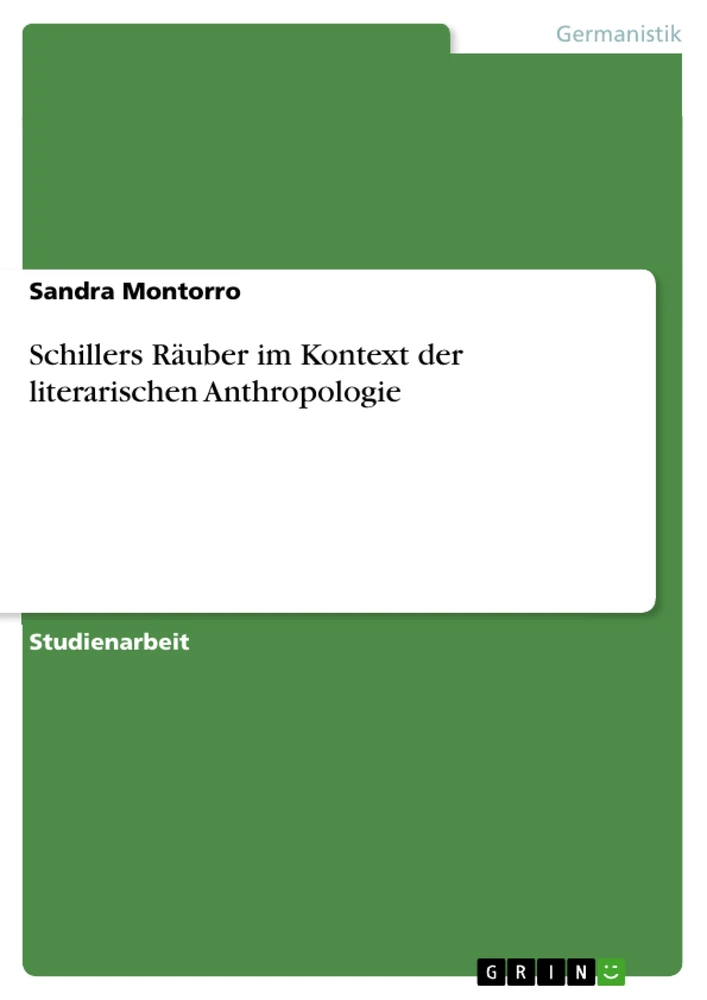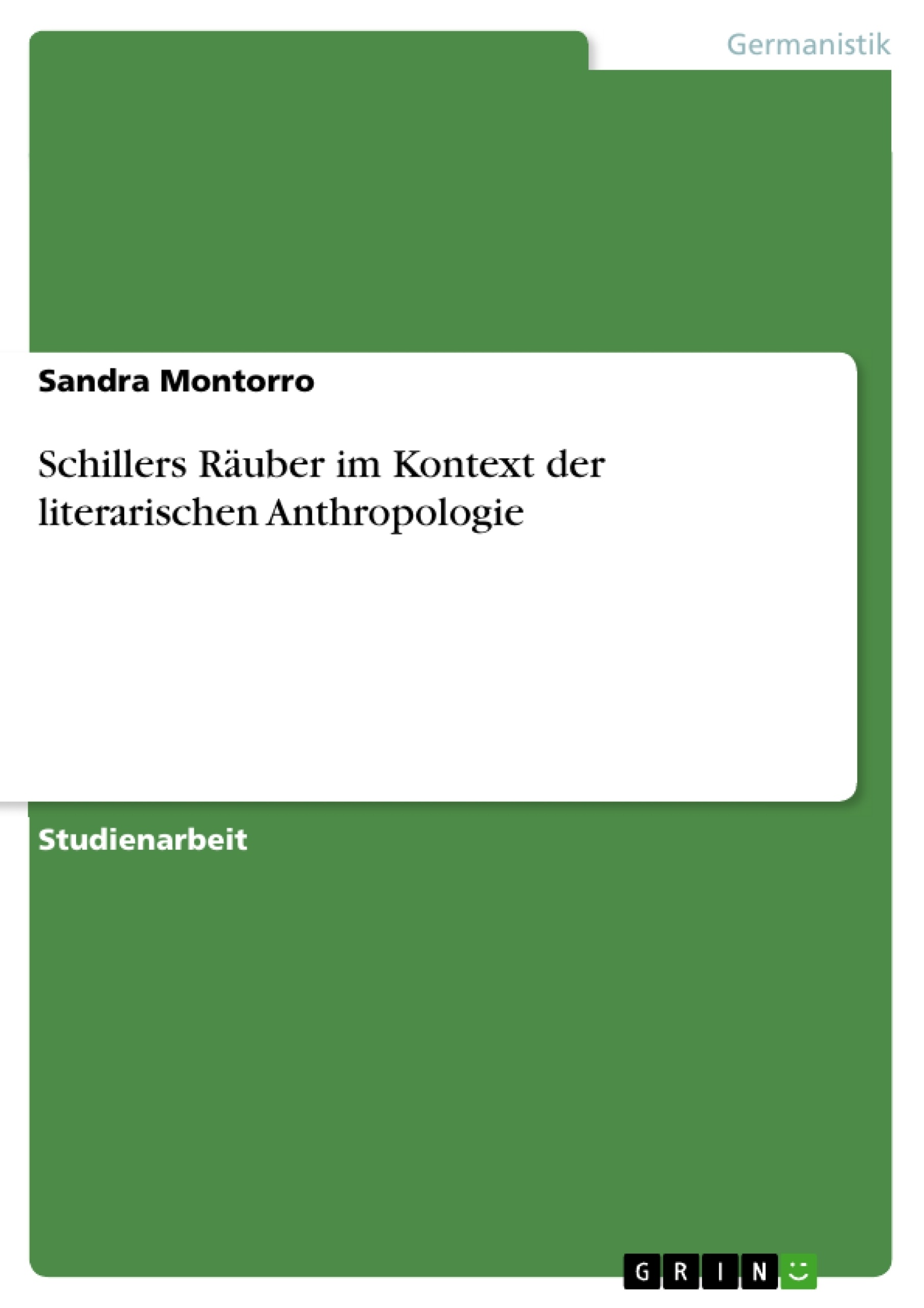In der Vorrede des Schauspiels „Die Räuber“ wird deutlich, dass Schiller mit diesem Text nicht allein das Ziel verfolgt, sein Publikum zu unterhalten. Er versteht sich vielmehr als „Menschenmaler“, der bestrebt ist, eine „Kopie der wirklichen Welt zu schaffen“ und die menschliche „Seele gleichsam bei ihren geheimsten Operationen [zu] ertappen“.
Der Autor steht zum Zeitpunkt der Niederschrift des Stücks am Ende seines Medizin-studiums an der herzoglichen Militärakademie in Stuttgart. In dieser Hausarbeit soll gezeigt werden, dass sich Schillers Überzeugungen als Anthropologe und philosophischer Arzt in seinen Figuren widerspiegeln. Hierzu bietet es sich an, Vergleiche zu seiner ersten und seiner dritten Dissertation („Philosophie der Physiologie“ und „Versuch über den Zusammenhang der thierischen Natur des Menschen mit seiner geistigen“ ) zu ziehen.
Besonders an der Figur des Franz scheint sich die Abwendung von Descartes Leib-Seele-Verständnis am Ende des 18. Jahrhunderts und die Entstehung einer psycho-somatischen Medizin ablesen zu lassen. Zudem stellt sich die Frage, ob Schiller am Negativbeispiel des Franz seine Ablehnung des Materialismus begründen will, an dem er Franz scheitern lässt.
Schiller geht in seinem Schauspiel immer wieder auf den maßgeblichen Einfluss der äußeren Umstände ein, die das Subjekt zwischen tierischer und göttlicher Bestim-mung schwanken lassen. Dies gilt sowohl für Franz als auch ganz besonders für sei-nen Bruder Karl, dessen Position zwischen „Vieh und Engel“ eines der Hauptmotive des Textes ist. Somit soll auch gezeigt werden, dass das Schauspiel den von Ale-xander Košenina beschriebenen Wandel vom Tat- zum Täterstrafrecht , der sich während der Entstehungszeit vollzog, erkennen lässt. Aus diesem Grund scheint es sinnvoll, die historischen Quellen, auf die sich der Autor des Stücks bezieht, zu untersuchen.
In „Die Räuber“ ist außerdem der Einfluss der Physiognomik als Teil der damaligen anthropologischen Lehre zu bemerken. Der von Wolfgang Riedel festgelegte Stand-punkt Schillers zwischen Lavater und Lichtenberg soll näher betrachtet werden.
Insgesamt soll herausgestellt werden, dass Schillers Schauspiel den Menschen in seiner Gesamtheit zu erfassen sucht und folglich ein Musterbeispiel für die literarische Anthropologie ist.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Leib-Seele-Verhältnis
- Probleme des cartesianischen Substanzdualismus
- Der influxus physicus
- Franz als Negativbeispiel eines Materialisten nach dem Vorbild La Mettries?
- Kriminalität
- Wandel vom Tat- zum Täterstrafrecht: Suche nach dem „Stempel des göttlichen Ebenbilds“ selbst bei dem „Lasterhaftesten“
- Karl als Opfer „Unglückliche[r] Konjunkturen“
- Franz',,große Rechte, über die Natur ungehalten zu sein“
- Historische Studien: Authentische Kriminalfälle als Grundlage des literarischen Schaffens
- Wandel vom Tat- zum Täterstrafrecht: Suche nach dem „Stempel des göttlichen Ebenbilds“ selbst bei dem „Lasterhaftesten“
- Physiognomik
- Schiller zwischen Lavater und Lichtenberg
- Physiognomie in „Die Räuber“
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht Schillers Schauspiel „Die Räuber“ aus der Perspektive der literarischen Anthropologie. Der Fokus liegt auf der Darstellung der menschlichen Natur in den Figuren und deren Auseinandersetzung mit der Frage nach dem Verhältnis von Körper und Geist, Kriminalität und Schuld sowie der Rolle der Physiognomik.
- Das Leib-Seele-Verhältnis in „Die Räuber“ im Kontext des cartesianischen Substanzdualismus und der sich entwickelnden psychosomatischen Medizin
- Die Rolle der Kriminalität in „Die Räuber“ und der Wandel vom Tat- zum Täterstrafrecht
- Die Bedeutung der Physiognomik in „Die Räuber“ und Schillers Position zwischen Lavater und Lichtenberg
- Die Bedeutung der äußeren Umstände für die menschliche Entwicklung und die Figur des Karl als Beispiel für die „Zwischenwelt“ von „Vieh und Engel“
- Schillers „Menschenmalerei“ und seine Darstellung der menschlichen „Seele gleichsam bei ihren geheimsten Operationen [zu] ertappen“
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Hausarbeit ein und erläutert die Zielsetzung sowie die Relevanz der anthropologischen Perspektive für die Analyse von Schillers „Die Räuber“.
Das erste Kapitel befasst sich mit dem Leib-Seele-Verhältnis in der Figur des Franz. Es wird die Abkehr von Descartes' dualistischer Sichtweise auf Körper und Geist im späten 18. Jahrhundert beleuchtet und Schillers Position als philosophischer Arzt diskutiert. Zudem wird die Frage nach Franz' möglicher Rolle als Negativbeispiel eines Materialisten erörtert.
Das zweite Kapitel analysiert die Kriminalität in „Die Räuber“ und die sich verändernden Perspektiven auf die Schuldfrage im 18. Jahrhundert. Der Wandel vom Tat- zum Täterstrafrecht wird anhand der Figuren Karl und Franz erläutert. Die historische Relevanz der Kriminalfälle für Schillers Schaffen wird ebenfalls beleuchtet.
Das dritte Kapitel untersucht den Einfluss der Physiognomik auf Schillers Werk. Die Position des Autors zwischen Lavater und Lichtenberg wird dargestellt und die Bedeutung der Physiognomik in „Die Räuber“ analysiert.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter der Arbeit sind: „Die Räuber“, Friedrich Schiller, Leib-Seele-Verhältnis, Substanzdualismus, Descartes, Anthropologie, Kriminalität, Täterstrafrecht, Physiognomik, Lavater, Lichtenberg, Menschenmalerei.
- Citation du texte
- Sandra Montorro (Auteur), 2010, Schillers Räuber im Kontext der literarischen Anthropologie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/267021