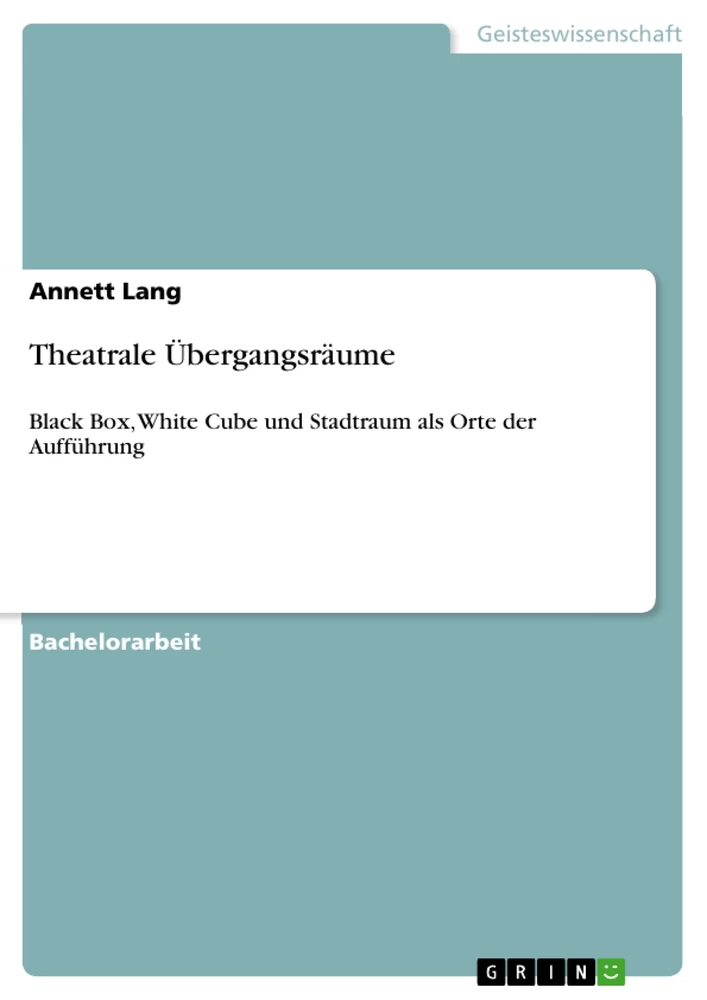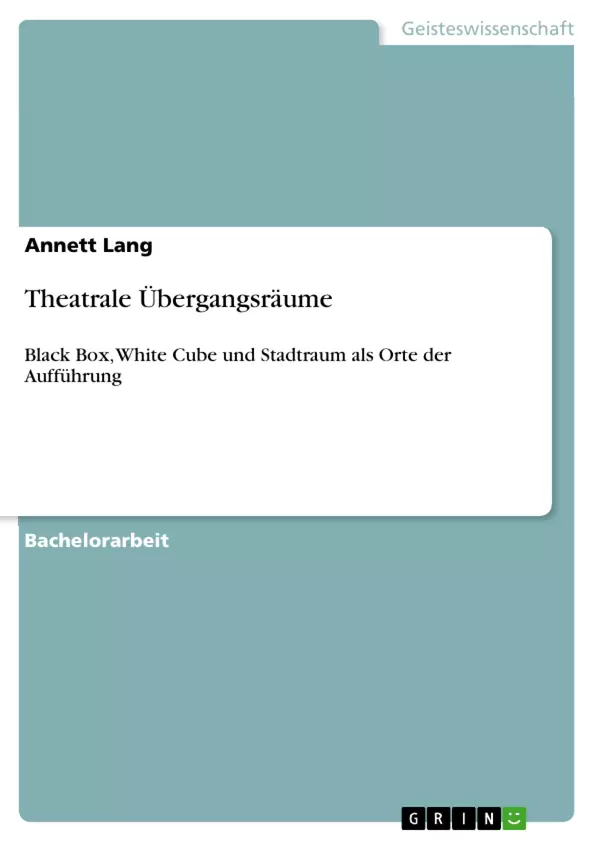Der Theaterraum ist per se ein vielgestaltiger. Das zeigt sich an der Vielzahl möglicher
Spielorte genauso wie in der einzelnen Aufführungssituation, wo sich der Ort, den wir
als Zuschauer im Blick haben, an einem Abend mehrfach verwandeln kann. Es zeigt
sich umgekehrt aber auch, indem wir uns gewahr werden, dass sich unser Ort – jener
der Zuschauenden also – gewandelt hat: Sei es, weil wir, der Aufführung folgend,
entweder den Platz gewechselt haben, oder aber vorübergehend selber zu einem andern
geworden sind1. Manchmal bewegt man sich im Geiste irgendwohin. Manchmal wissen
gar nicht alle Beteiligten, dass sie gerade ein Stück aufführen. Und manchmal ist es
ziemlich schwierig zu entscheiden, ob das Wahrgenommene als Teil der Aufführung gedacht
ist, oder ob es sich durch die eigene Vorstellung in die Aufführung hereingeschlichen
hat. Der Ort für das Theater kann ein monumentales Gebäude sein, über dessen
Eingang ein eingemeißelter Vers von küssenden Musen berichtet2 und ist gleichzeitig so
flüchtig, dass er mit dem Ende der Aufführung bereits wieder verschwunden ist.
Über ein Vorhandenes zu schreiben, das doch permanent entwischt, ist nicht einfach.
Ich habe oben versucht, das ‚Haptische’ und das Flüchtige, zwei wesentliche Aspekte
des Theatralen, einander gegenüberzustellen: Das Theater als Begriff hat eine materielle
und eine ideelle Seite: Wir verstehen unter ‚Theater’ den Bau, den Spielort, aber auch
einen theatralen Vorgang, eine Aufführung. Die vorliegende Arbeit fragt nach Bedingungen
der Möglichkeit theatraler Raumkonstitution. Es ist dabei von zentralem Interesse,
zu untersuchen, ob und wie ein ‚wirklicher Ort’3 (um mit Foucault zu sprechen) und
der ‚Möglichkeitsraum’4 (um Winnicott dazuzunehmen) im Zusammenspiel diesen
Raum konstituieren. Das Theater vereint in sich, oder besser: verhandelt konstant die
vielfältigsten raumzeitlichen Grenzziehungsvorgänge und Rahmensetzungen: Zum
einen muss Theater, um wahrgenommen werden zu können, sich in irgendeiner Weise
vom Umraum abheben. Zum anderen gibt es mehr oder weniger stabile Grenzen zwischen
dem Raum für die Zuschauer und jenem für die Akteure. Es gibt individuelle Liminalitätserfahrungen5 und kollektive Transformationsvorgänge, die ebenso mit Grenzen bzw. deren Überschreitung zu tun haben wie der Schritt in den abgedunkelten
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Potentialität und Liminalität
- D. W. Winnicott: Transitional Space / Potential Space / Intermediate Area
- Grenzziehungen
- Rahmung: Grenze, Schwelle, Brücke
- Michel Foucault: Die Heterotopie als wirklicher Ort
- Michel de Certeau: Räume und Orte
- Theatrale Raumkonstitution
- Das „theatralische Raumerlebnis"
- Gespielter und bespielter Raum als Orte der Aufführung
- Theater minus Text? Anmerkungen zum Begriff der Theatralität
- Ordnungsraum und Handlungsraum: Black Box, White Cube und Stadtraum als Orte der Aufführung
- Black Box: Der Schwarzraum in der Kunst und als theatraler Raum
- Ivana Müller: While We Are Holding it Together (2006)
- Stillstand und Bewegung
- „I imagine___": Die Vor-Stellung im Hier und Jetzt
- Entgrenzte Subjekte
- White Cube: Die Idee des neutralen Raumes
- Tino Sehgal: This is so Contemporary (2005)
- Archiv und Performativität: Werk ohne Artefakt
- Subversive Nutzung der Konvention?
- Stadtraum: Funktion versus Bedeutung
- Rimini Protokoll: Sonde Hannover (2002)
- Der öffentliche Raum und die Aufführung
- Ko-Präsenz und ,Theaterpakt'
- Aufmerksamkeit: Zur Performativität von Wahrnehmung
- Black Box: Der Schwarzraum in der Kunst und als theatraler Raum
- Schlussbetrachtung
- Bibliografie
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Frage, wie sich „theatrale Räume" konstituieren. Sie untersucht, welche räumlichen Bedingungen für die Entstehung theatraler Situationen notwendig sind und wie diese die Definition des Aufführungsbegriffs beeinflussen. Dabei werden theoretische Konzepte von Raum und Grenze, insbesondere von D. W. Winnicott, Michel Foucault und Michel de Certeau, auf die spezifischen Bedingungen der Aufführungspraxis angewendet.
- Der theatrale Raum als Übergangsraum
- Die Bedeutung von Grenzen und Rahmungen für die Entstehung theatraler Situationen
- Die Rolle von Text und Performativität in der Raumkonstitution
- Die Analyse von drei unterschiedlichen „theatralen" Räumen: Black Box, White Cube und Stadtraum
- Die Performativität von Wahrnehmung und die Frage nach der Ko-Präsenz von Akteuren und Zuschauern
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der theatralen Raumkonstitution ein und stellt die zentralen Fragestellungen der Arbeit vor. Sie beleuchtet die Vielgestaltigkeit des Theaterraums und die Bedeutung von Grenzziehungen für die Entstehung theatraler Situationen.
Das erste Kapitel befasst sich mit dem Konzept des Übergangsraumes, das D. W. Winnicott im Rahmen seiner Forschung zu Spiel und Kreativität entwickelt hat. Es wird untersucht, inwiefern dieses Konzept Entsprechungen in tatsächlich vorhandenen „theatralen" Räumen findet und welche Bedeutung es für die Perzeption und Produktion theatraler Ereignisse hat. Zudem werden Überlegungen zur Problematik der Grenze und der Rahmung angestellt.
Das zweite Kapitel widmet sich der spezifisch theatralen Raumbildung. Es wird der Begriff der „Theatralität" umrissen und anhand von konkreten Beispielen untersucht, welche Räume sich weshalb in „theatrale" Räume verwandeln. Die Überlegungen dazu werden entlang zweier Hauptthesen entwickelt: Der theatrale Raum ist ein Übergangsraum par excellence und die Grenze des theatralen Raumes ist für die Entstehung der theatralen Situation konstitutiv.
Das dritte Kapitel analysiert drei „theatral besetzte" Räume: die Black Box, den White Cube und den Stadtraum. Es werden die jeweiligen Grenzziehungsmaßnahmen dieser Räume untersucht und die Frage gestellt, wie im jeweiligen Rahmen „Theatralität" definiert und eine Aufführung bzw. „theatrale Situation" realisiert wurde.
Im vierten Kapitel werden die Ergebnisse der Analyse der drei „theatralen" Räume zusammengefasst und in Bezug auf die zentrale Fragestellung der Arbeit diskutiert. Es wird gezeigt, dass die Prinzipien des theatralen Raumes der Definition des Übergangsraumes von Winnicott weitgehend entsprechen und dass Grenzziehungen und Rahmungen für die Beschreibung theatraler Räume von großer Bedeutung sind.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den theatralen Raum, die Raumkonstitution, Grenzziehungen, Rahmung, Übergangsraum, Liminalität, Theatralität, Performativität, Black Box, White Cube, Stadtraum, Aufführung, Ko-Präsenz, Wahrnehmung und Bedeutungsproduktion.
Häufig gestellte Fragen
Was ist ein "theatraler Übergangsraum"?
Basierend auf D.W. Winnicott ist es ein Raum zwischen Realität und Phantasie (Möglichkeitsraum), in dem die Aufführung stattfindet und eine Transformation der Beteiligten möglich ist.
Welche Rolle spielen Grenzen für das Theater?
Grenzen und Rahmungen sind konstitutiv für das Theater. Sie heben den Spielraum vom Umraum ab und definieren die Beziehung zwischen Akteuren und Zuschauern.
Was unterscheidet 'Black Box' und 'White Cube' als Aufführungsorte?
Die Black Box ist der klassische dunkle Theaterraum, der die Konzentration auf das Geschehen fokussiert. Der White Cube stammt aus der Kunstwelt und suggeriert Neutralität, wird aber oft subversiv für performative Zwecke genutzt.
Kann der Stadtraum ein theatraler Raum sein?
Ja, durch gezielte Rahmung und den 'Theaterpakt' zwischen Akteuren und Zuschauern kann sich öffentlicher Raum in einen Aufführungsort verwandeln, wie etwa bei Projekten von Rimini Protokoll.
Was versteht Michel Foucault unter einer Heterotopie?
Foucault beschreibt Heterotopien als "wirkliche Orte", die wie Gegenplatzierungen zu normalen gesellschaftlichen Räumen fungieren – das Theater ist ein klassisches Beispiel dafür.
- Citar trabajo
- Annett Lang (Autor), 2010, Theatrale Übergangsräume, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/267028