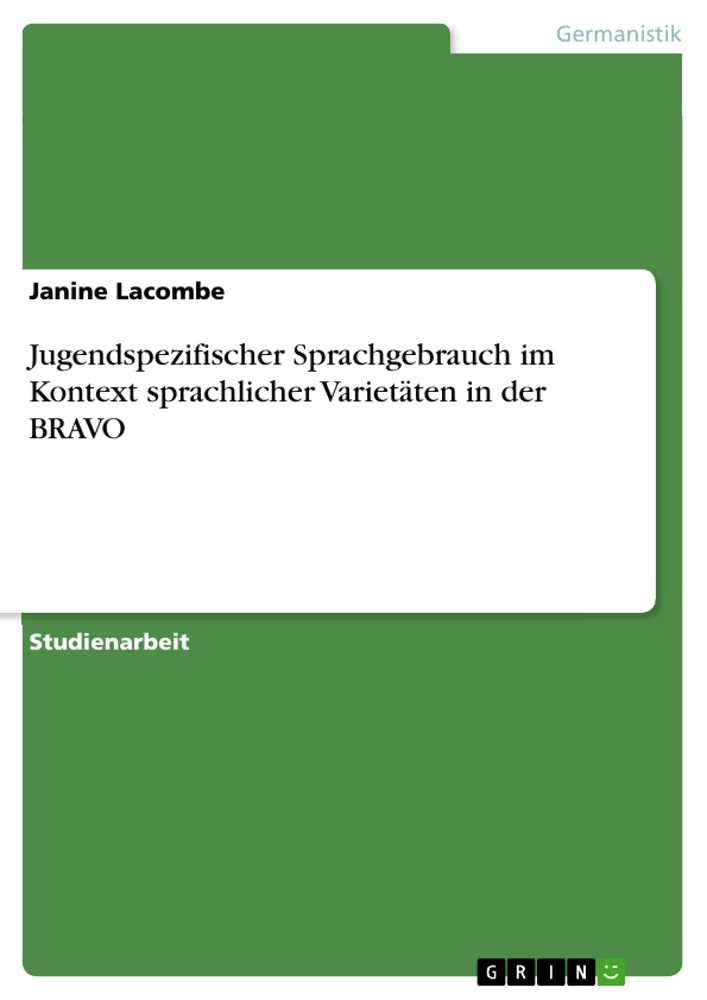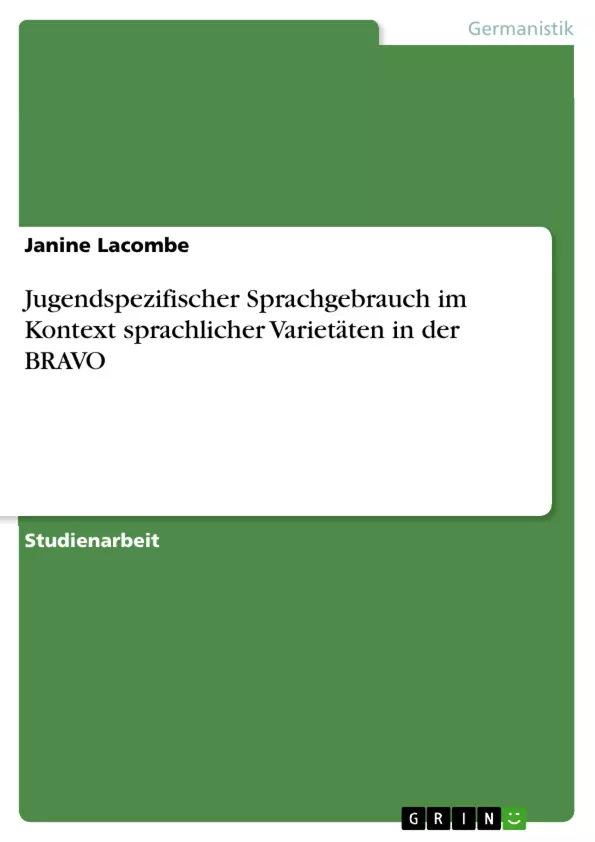Spricht man von „Jugendsprache“, so scheint deren Definition dezidiert zu sein. Diese Beschreibung jugendspezifischen Sprachgebrauchs impliziert, dass es sich um eine eigene Sprache handelt, die von allen Jugendlichen gesprochen wird, vergleichbar mit anderen Sondersprachen. Diese und ähnliche Fehldeutungen erschweren eine konkrete Begriffsbestimmung des Terminus. Peter SCHLOBINSKI insistiert auf der Notwendigkeit, die Jugend als heterogene Gruppe zu betrachten, die nicht durch die „eine“ Jugendsprache, sondern durch Variation gekennzeichnet ist. Diese Aussage soll für den weiteren Verlauf dieser Arbeit richtungsweisend sein und die Basis für die folgenden Beiträge konstituieren.
Die als Anhang erwähnten Quellenartikel sind in dieser Veröffentlichung nicht enhalten!
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begründung und Relevanz des Themas
- Allgemeine Vorgehensweise
- Theoretischer Rahmen — Jugendsprache im Kontext sprachlicher Varietäten
- Die Lebensphase Jugend und Jugendkultur
- Die Jugendsprachen
- Die sprachliche Varietät
- Historische Entwicklung jugendspezifischen Sprachgebrauchs
- Abgrenzung der Jugendsprachen zur Standardsprache
- Die Jugendsprachforschung — Ein Überblick.
- Exemplarische Analyse
- Der Untersuchungsgegenstand — Vorstellung und Begründung
- Betrachtung des bildlichen und sprachlichen Erscheinungsbildes von Jugendzeitschriften
- Die „Bravo"
- Das Analysemodell der integrativen Textanalyse nach Klaus Brinker
- Schwerpunkte und Zielerhebung der Untersuchungen
- Die exemplarische Analyse
- Funktionale Dimension
- Strukturell-thematische Dimension
- Strukturell-grammatische Dimension
- Auswertung der Analyse
- Der Untersuchungsgegenstand — Vorstellung und Begründung
- Abschließende Bemerkungen
- Quellen- und Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Phänomen der Jugendsprache und analysiert, inwieweit sich jugendspezifische Sprechweisen als eigenständige sprachliche Varietät definieren lassen. Der Fokus liegt dabei auf der Untersuchung von Jugendsprachen im Kontext sprachlicher Varietäten, ihrer historischen Entwicklung und ihrer Abgrenzung zur Standardsprache. Die Arbeit beleuchtet zudem die Jugendsprachforschung und ihre Entwicklung von der Homogenitätsannahme hin zu differenzierten Modellen der Analyse. Schließlich wird anhand einer exemplarischen Analyse von Artikeln aus der Jugendzeitschrift „Bravo" untersucht, wie jugendspezifische Sprechweisen in einem schriftlichen Medium repräsentiert werden und welche Funktionen diese im Kontext der Zielgruppe erfüllen.
- Definition und Abgrenzung von Jugendsprache
- Jugendsprache im Kontext sprachlicher Varietäten
- Historische Entwicklung von Jugendsprachen
- Die Jugendsprachforschung und ihre Entwicklung
- Exemplarische Analyse von Jugendsprachen in der Zeitschrift „Bravo"
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung liefert eine Begründung für die Relevanz des Themas Jugendsprache und skizziert die allgemeine Vorgehensweise der Arbeit.
Das zweite Kapitel erläutert den theoretischen Rahmen der Arbeit und definiert den Begriff der Jugendsprache im Kontext sprachlicher Varietäten. Es werden die Lebensphase Jugend und Jugendkultur, die verschiedenen Ebenen der sozialen Gruppe „Jugend" und die unterschiedlichen Funktionen von Jugendsprachen beschrieben. Des Weiteren wird die Abgrenzung von Jugendsprachen zur Standardsprache erörtert und ein historischer Überblick über die Entwicklung jugendspezifischen Sprachgebrauchs gegeben. Schließlich wird die Jugendsprachforschung und ihre Entwicklung von der Homogenitätsannahme hin zu differenzierten Modellen der Analyse beleuchtet.
Im dritten Kapitel wird eine exemplarische Analyse von vier ausgewählten Artikeln aus der Jugendzeitschrift „Bravo" durchgeführt. Die Analyse erfolgt nach dem Prinzip der integrativen Textanalyse von Klaus Brinker und untersucht die funktionale und strukturelle Dimension der Texte. Dabei werden die Themenentfaltung, die verwendeten sprachlichen Mittel und die grammatische Struktur der Texte analysiert. Die Auswertung der Analyse zeigt, wie jugendspezifische Sprechweisen in der „Bravo" repräsentiert werden und welche Funktionen diese im Kontext der Zielgruppe erfüllen.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den Begriff der Jugendsprache, ihre Definition und Abgrenzung zur Standardsprache, die verschiedenen Ebenen der sozialen Gruppe „Jugend", die Funktionen von Jugendsprachen, die historische Entwicklung von Jugendsprachen, die Jugendsprachforschung und ihre Entwicklung, sowie die exemplarische Analyse von Jugendsprachen in der Zeitschrift „Bravo".
Häufig gestellte Fragen
Gibt es "die eine" Jugendsprache?
Nein, die Forschung betont, dass Jugend eine heterogene Gruppe ist und Jugendsprache durch Variation und verschiedene Varietäten gekennzeichnet ist.
Welches Medium wird in der Arbeit exemplarisch analysiert?
Die Arbeit untersucht den jugendspezifischen Sprachgebrauch anhand von Artikeln aus der Jugendzeitschrift "BRAVO".
Welche Funktionen erfüllt Jugendsprache?
Sie dient unter anderem der Identitätsstiftung, der Abgrenzung gegenüber Erwachsenen und der emotionalen Ausdrucksfähigkeit innerhalb der Peer-Group.
Wie grenzt sich Jugendsprache von der Standardsprache ab?
Dies geschieht durch spezifische Lexik, grammatische Besonderheiten und eine oft spielerische oder provokante Ausdrucksweise.
Welches Analysemodell wird für die Textuntersuchung verwendet?
Die Untersuchung nutzt das Modell der integrativen Textanalyse nach Klaus Brinker.
- Quote paper
- Janine Lacombe (Author), 2011, Jugendspezifischer Sprachgebrauch im Kontext sprachlicher Varietäten in der BRAVO, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/267178