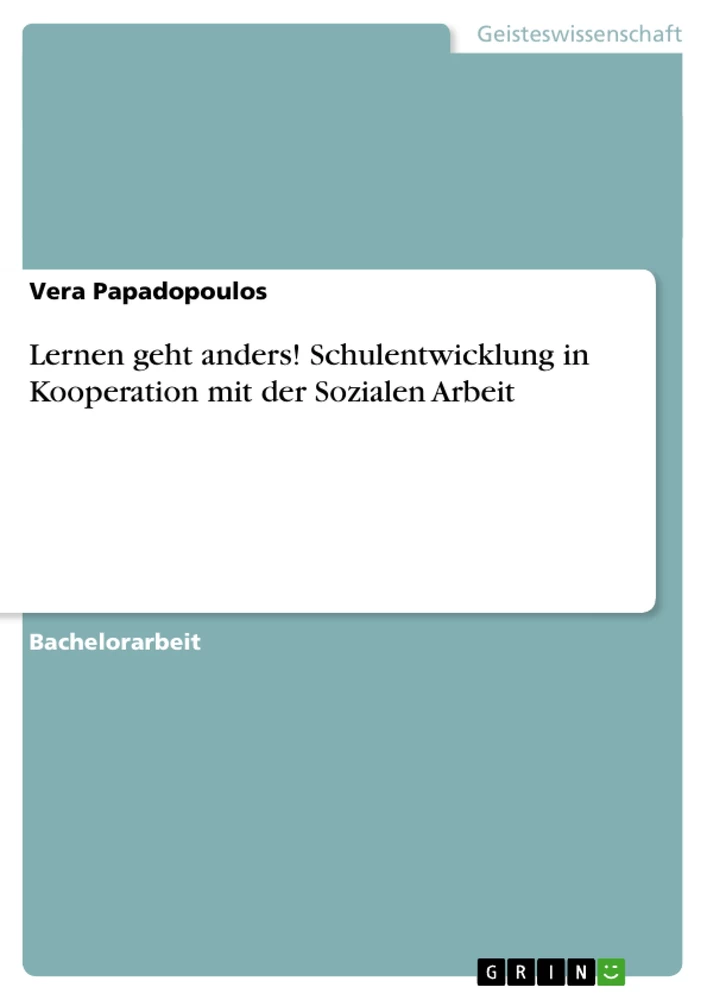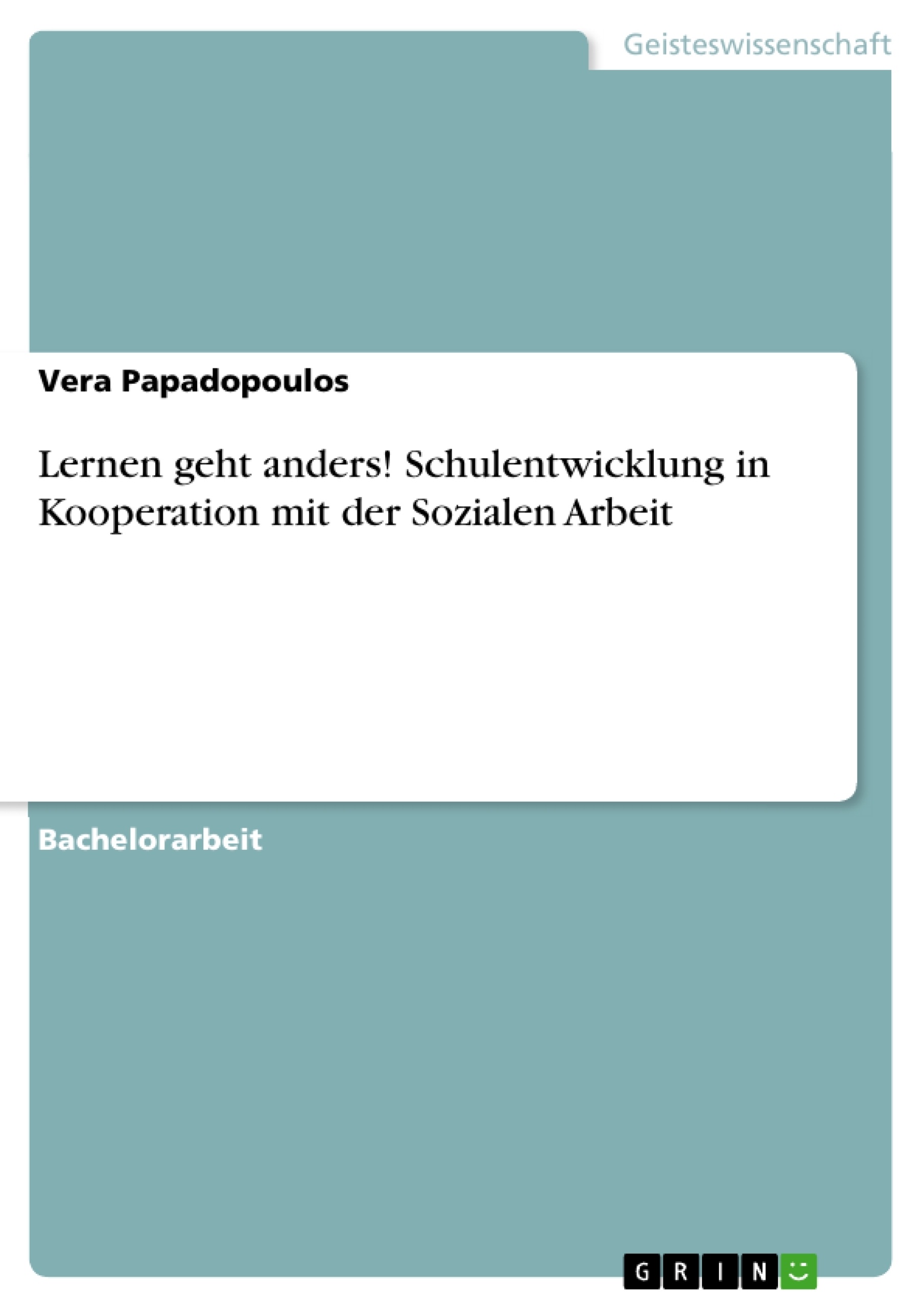„Die Schule erreicht ihre Ziele nicht, die Schule erreicht ihre Schüler nicht“ (von Hentig 1999:24). Seit Jahrzehnten steht das deutsche Schul- und Bildungssystem im Mittelpunkt öffentlicher Kritik. Von drohendem „Schul- Infarkt“ und „Bulimielernen“ ist die Rede, von „Trichterpädagogik“ (Oevermann 2004:29), Schule wird als Dressureinrichtung und SchülerInnen als gehorsame PflichterfüllerInnen betitelt und sogar der Bedarf einer Bildungsrevolution wird ausgerufen (vgl. Precht 2012). Im Gegensatz zu der „Bildungsmisere“ steht die Zunahme höherer Bildungsabschlüsse (vgl. Braun 2006:27). Es besteht eine Kluft zwischen Bildungsarmut und Bildungs“reichtum“ und damit eine massive Chancenungerechtigkeit, welche vom derzeitigen Bildungssystem ausgeht.
Der Erziehungswissenschaftler Thomas Rauschenbach (2009:13) bezeichnet Bildung als „wesentliche Überlebensressource des 21. Jahrhunderts“, der Schweitzer Kinderarzt Remo Largo (2010:156) als „eine der großen sozialen Fragen des 21. Jahrhunderts“. Bildung ist zur zentralen Chancenzuteilungsinstanz geworden, sie ebnet den Weg in eine erfolgreiche Zukunft oder versperrt ihn (vgl. Rauschenbach 2009:12).
Jugendhilfe und Schulsozialarbeit mit ihren unverzichtbaren pädagogisch- sozialen Instrumenten des sozialen Lernens und den Methoden der Problembearbeitung werden zunehmend bedeutende Gestaltungsakteure hinsichtlich des Aufwachsens von Kindern und Jugendlichen (vgl. ebd.: 35f). Kritisiert wird das Schattendasein der Kinder- und Jugendhilfe am Rande von Bildungs-, Gesundheits- und Sozialpolitik, Böhnisch und Schröer bezeichnen die Jugendhilfe sogar als „Trittbrettfahrerin auf dem immer schneller werdenden Bildungszug“ (Böhnisch 2011:51). Es gilt kritisch zu überprüfen, wie viel Relevanz der Sozialen Arbeit/ Schulsozialarbeit im Kontext von Schule und Bildung durch die Bildungspolitik eingeräumt wird und ob eine Bildungspartnerschaft mit der Sozialen Arbeit ernsthaft angestrebt wird.
Diese Bachelorarbeit setzt sich mit der Frage auseinander, ob die Jugendhilfe in Bezug auf eine innovative Bildungs- und Schulentwicklung zu Recht als „Aufsteiger der Saison“ (Rauschenbach 2009:34) bezeichnet werden kann. [...]
Inhaltsverzeichnis
- IE-inleitung
- 2 Bildung und Lernen
- 2.1. Begriffs- und Zielbestimmung von Bildung und Lernen
- 2.2. Bildung als Erfolgs- und Risikofaktor
- 2.3. Ganzheitliche Bildung und der erweiterte Bildungsbegriff
- 3 Schule
- 3.1. Auftrag und Ziel der schulischen Bildung
- 3.2. Besondere Herausforderungen an Schule
- 3.3. Heterogenität und Inklusion
- 3.4. Der aktuelle Bildungsdiskurs- Schule und Bildung in der Kritik
- 4 Schulsozialarbeit
- 4.1. Rechtsgrundlagen, Grundsätze und Handlungsprinzipien
- 4.2. Aufgaben und besondere Herausforderungen der Schulsozialarbeit
- 4.3. Spannungsfeld Schule und Schulsozialarbeit
- 5 Schulentwicklung in Kooperation mit Schulsozialarbeit
- 5.1. Prämissen für ein erfolgreiches Lernen
- 5.2. Etablierung von Bildungs- und Erziehungspartnerschaften
- 5.3. Bildung von Kommunalen Bildungs- und Erziehungslandschaften
- 6. Zusammenfassung und Ausblick
- 7. Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Bachelorarbeit befasst sich mit der Frage, inwiefern die Jugendhilfe/ Schulsozialarbeit eine zentrale Rolle in der innovativen Bildungs- und Schulentwicklung spielt. Sie analysiert das Spannungsfeld zwischen Schule und Sozialer Arbeit und beleuchtet die Möglichkeiten einer chancengerechteren, ganzheitlichen und nachhaltigen Lernkultur durch eine enge Kooperation beider Bereiche.
- Die Bedeutung von Bildung im 21. Jahrhundert als zentrale Chancenzuteilungsinstanz
- Die Herausforderungen und Missstände des deutschen Schulsystems im Hinblick auf Inklusion und Chancengleichheit
- Die Rolle der Schulsozialarbeit als Vermittlungsinstanz zwischen Schule und Lebenswelt der SchülerInnen
- Das Konzept der Lebensweltorientierung als Grundlage für eine gelingende Schulentwicklung
- Die Bildung von Kommunalen Bildungs- und Erziehungslandschaften als zukunftsweisende Strategie für eine ganzheitliche Bildung
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel der Arbeit beleuchtet die Bedeutung von Bildung und Lernen im 21. Jahrhundert. Es werden verschiedene Bildungstheorien und deren unterschiedliche Interpretationen des Begriffs Bildung vorgestellt. Zudem wird die Entwicklung des Lernbegriffs von der reinen Wissensvermittlung hin zu einem ganzheitlichen und kompetenzorientierten Lernverständnis erläutert.
Im zweiten Kapitel wird die Rolle von Bildung als Erfolgs- und Risikofaktor analysiert. Es werden die Herausforderungen des deutschen Schulsystems im Hinblick auf Chancengleichheit und die Folgen von Bildungsarmut für Kinder und Jugendliche aus benachteiligten Familien aufgezeigt. Die Arbeit stellt dar, dass das deutsche Schulsystem auf AdressatInnen aus mittleren und hohen gesellschaftlichen Schichten fokussiert ist und nicht in der Lage ist, Chancengleichheit herzustellen. Die Bedeutung der Sozialen Arbeit im Kontext von Schule und Bildung wird als essenziell für den Abbau von Benachteiligungen und die Schaffung chancengerechterer Bedingungen hervorgehoben.
Das dritte Kapitel widmet sich der Institution Schule und deren Auftrag und Zielen. Es werden die besonderen Herausforderungen für die Lehrerschaft und die Institution Schule im Kontext von psychosozialen Hilfen und der zunehmenden Heterogenität der Schülerschaft beleuchtet. Die Arbeit setzt sich mit dem Inklusionsbegriff auseinander und zeigt die Schwierigkeiten bei der Umsetzung von Inklusion in der schulischen Praxis auf. Die Bedeutung der Schulsozialarbeit als „Dolmetscher" für die Lebenswelten der SchülerInnen und als Vermittler zwischen Schule und Familie wird betont.
Das vierte Kapitel beschäftigt sich mit dem Handlungsfeld Schulsozialarbeit. Es werden die Rechtsgrundlagen, Grundsätze und Handlungsprinzipien der Schulsozialarbeit erläutert. Die Arbeit beschreibt die vielfältigen Aufgaben der Schulsozialarbeit und die besonderen Herausforderungen, denen sich sozialpädagogische Fachkräfte an Schule gegenübersehen. Zudem wird das Spannungsfeld zwischen Schule und Schulsozialarbeit als Folge unterschiedlicher Systeme und gesellschaftlicher Aufträge thematisiert.
Das fünfte Kapitel stellt die Möglichkeiten der Schulentwicklung in Kooperation mit der Schulsozialarbeit dar. Es wird das Konzept der Lebensweltorientierung als Grundlage für ein erfolgreiches Lernen vertieft und an Beispielen verdeutlicht, wie dieses Konzept in die Praxis umgesetzt werden kann. Die Bedeutung von Bildungs- und Erziehungspartnerschaften zwischen Schule und Familie wird hervorgehoben und die Herausforderungen bei der Etablierung einer gemeinsamen Verantwortung für das Wohl des Kindes aufgezeigt. Die Arbeit befasst sich mit der Bildung von Kommunalen Bildungs- und Erziehungslandschaften als zukunftsweisende Strategie für eine ganzheitliche Bildung und betont die zentrale Rolle der Schulsozialarbeit als Bindeglied zwischen Schule, Familie und Jugendhilfe.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Schulentwicklung, die Kooperation von Schule und Sozialer Arbeit, die Schulsozialarbeit, die Lebensweltorientierung, die Inklusion, die Heterogenität, die Chancengleichheit und die Bildung von Kommunalen Bildungs- und Erziehungslandschaften. Die Arbeit analysiert die Herausforderungen des deutschen Schulsystems im Hinblick auf die individuellen Bedürfnisse der SchülerInnen und die Notwendigkeit einer ganzheitlichen und chancengerechten Bildung. Ein besonderer Fokus liegt auf der Bedeutung der Schulsozialarbeit als Vermittlungsinstanz zwischen Schule und Lebenswelt der SchülerInnen und als wichtige Stütze für eine gelingende Inklusion.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das zentrale Thema dieser Bachelorarbeit?
Die Arbeit untersucht die Kooperation zwischen Schule und Schulsozialarbeit sowie deren Bedeutung für eine innovative Schulentwicklung und mehr Chancengerechtigkeit.
Warum wird das deutsche Schulsystem in der Arbeit kritisiert?
Kritisiert werden unter anderem die Kluft zwischen Bildungsarmut und Bildungsreichtum, mangelnde Chancengleichheit sowie veraltete pädagogische Ansätze wie das sogenannte „Bulimielernen“.
Welche Rolle spielt die Schulsozialarbeit laut dem Text?
Sie fungiert als Vermittlungsinstanz zwischen der Institution Schule und der Lebenswelt der SchülerInnen und unterstützt Prozesse des sozialen Lernens.
Was versteht man unter dem Konzept der Lebensweltorientierung?
Dieses Konzept dient als Grundlage für gelingendes Lernen, indem es die individuellen Hintergründe und sozialen Realitäten der Kinder und Jugendlichen in den Schulalltag einbezieht.
Was sind Kommunale Bildungs- und Erziehungslandschaften?
Es handelt sich um eine zukunftsweisende Strategie zur Vernetzung von Schule, Familie und Jugendhilfe, um eine ganzheitliche Bildung vor Ort zu gewährleisten.
- Arbeit zitieren
- Vera Papadopoulos (Autor:in), 2013, Lernen geht anders! Schulentwicklung in Kooperation mit der Sozialen Arbeit, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/267271