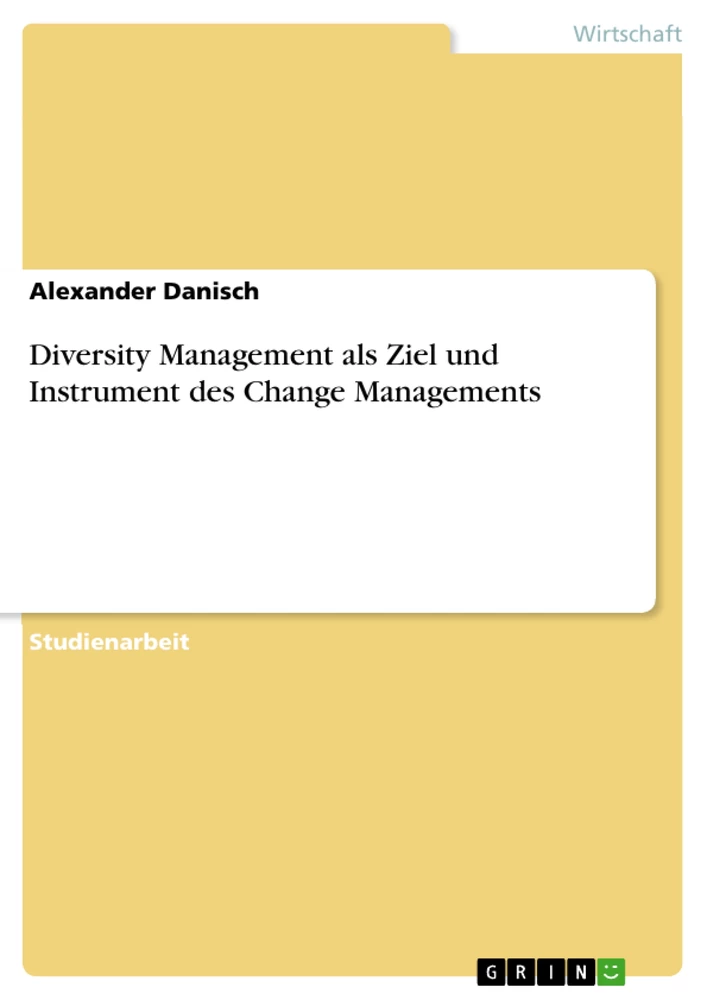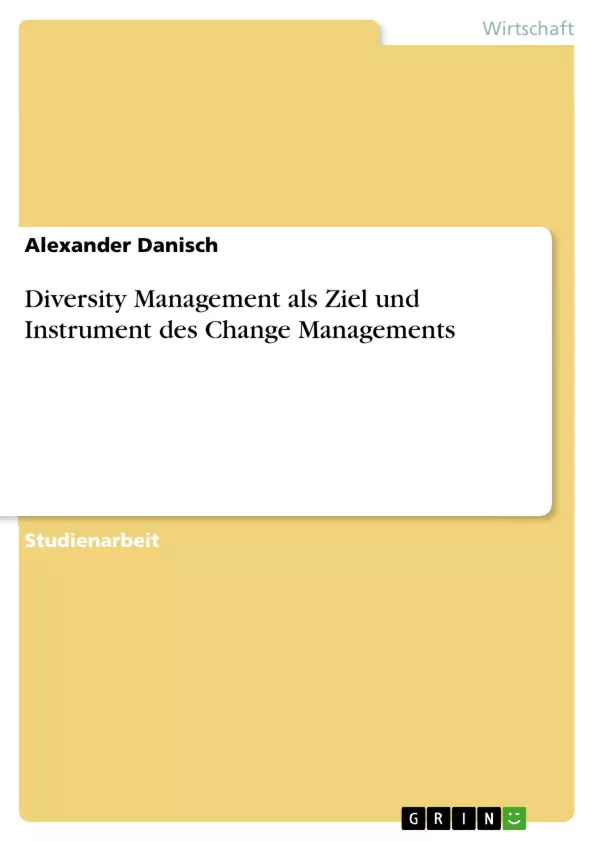Die Fähigkeit zur Anpassung an gegebene Veränderungen in Gesellschaft und Wirtschaft
und die damit verbundene Flexibilität waren schon immer existentielle Unternehmenseigenschaften,
welche für ihr zukünftiges Bestehen von Bedeutung waren.
Durch die steigende Vielfalt der sich gleichzeitig vollziehenden Veränderungen und
dem Druck, welcher auf den Entscheidungsträgern lastet, hat diese Relevanz in den
letzten zwei bis drei Jahrzehnten zugenommen. Dynamische Märkte und der Prozess
der Globalisierung stellen Unternehmen vor eine Vielzahl komplexer Herausforderungen,
auf welche es flexibel zu reagieren gilt. Eine große Verantwortung in diesem
Spannungsfeld trägt das Personalmanagement, welches seine Praktiken vorausschauend
verwenden soll, um Ressourcen und Möglichkeiten frühzeitig zu erkennen und
langfristig zu nutzen. Eines dieser Instrumente stellt das Change Management dar,
dessen Aufgabe in der Bewältigung von Veränderungsprozessen besteht, die sich
durch ihre Schwierigkeit, Signifikanz und Komplexität unterscheiden. Innerhalb der
verschiedenen Möglichkeiten einen internen Unternehmenswandel durchzuführen,
stellt das Diversity Management eine personalwirtschaftliche Betrachtungsweise dar,
die es nicht nur ermöglicht, die individuelle Verschiedenheit der Mitarbeiter zu tolerieren,
sondern darüber hinaus ihre Vielfalt im Sinne der positiven Wertschätzung für
Unternehmenserfolg nutzbar zu machen.
Inwiefern das Diversity Management eine Komponente des Change Managements
ist, soll in dieser Abhandlung dargestellt werden. Weiterhin finden die
Chancen, welche das Diversity Management durch seine Kerndimensionen mit sich
bringen kann, Berücksichtigung. Zu diesem Zweck sollen zu Beginn die Prinzipien
und grundsätzlichen Auffassungen des Change und Diversity Managements vorgestellt
werden, ohne dabei bereits auf Spezifikationen oder Besonderheiten einzugehen,
um einen allgemeinen Überblick über die Themen zu geben. Des Weiteren sollen
diese beiden Teile im vierten Kapitel insofern verknüpft werden, dass eine Kontextualisierung
des Diversity Managements in das übergeordnete Feld des Change
Managements vorgenommen wird. Das Fazit baut auf den vorhergehenden Erkenntnissen
auf, um eine abschließende Bewertung des Diversity Managements als Teil
des Change Managements darzustellen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Change Management
- Begriffsbestimmung: Change Management
- Anwendungsgebiete der Veränderung
- Veränderungsstrategien
- Interventionsstrategien
- Diversity Management
- Begriffsbestimmung: Diversity Management
- Rechtfertigung für die Implementierung von Diversity Management
- Ökonomische Gründe
- Rechtliche Gründe
- Ethisch-moralische Gründe
- Dimensionen und Ebenen des Diversity Managements
- Ebenen von Diversity
- Dimensionen von Diversity
- Fazit: Diversity Management als Ziel und Instrument des Change Managements
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Verbindung zwischen Change Management und Diversity Management. Sie analysiert, inwiefern Diversity Management als Instrument des Change Managements eingesetzt werden kann und welche Chancen sich durch die Integration von Diversität in Unternehmen ergeben. Dabei werden die Kerndimensionen des Diversity Managements sowie die rechtlichen, ökonomischen und ethisch-moralischen Begründungen für dessen Implementierung beleuchtet.
- Begriffsbestimmung und Anwendungsgebiete von Change Management
- Begriffsbestimmung und Rechtfertigung von Diversity Management
- Dimensionen und Ebenen des Diversity Managements
- Verknüpfung von Change Management und Diversity Management
- Chancen und Herausforderungen der Integration von Diversität in Unternehmen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik des Change Managements und Diversity Managements ein und erläutert die Relevanz dieser Konzepte für Unternehmen in einer dynamischen und globalisierten Welt. Das Kapitel beleuchtet die Bedeutung der Anpassungsfähigkeit von Unternehmen an Veränderungen und die Rolle des Personalmanagements bei der Bewältigung dieser Herausforderungen.
Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit dem Change Management. Es definiert zentrale Begriffe wie ,internen Wandel' und ,Veränderungsprozess' und stellt verschiedene Kategorisierungen von Veränderungsprozessen vor. Darüber hinaus werden Veränderungs- und Interventionsstrategien des Change Managements erläutert.
Das dritte Kapitel widmet sich dem Diversity Management. Es definiert den Begriff ,Diversity' und erläutert die verschiedenen Perspektiven auf Vielfalt. Zudem werden die ökonomischen, rechtlichen und ethisch-moralischen Gründe für die Implementierung von Diversity Management beleuchtet. Abschließend werden die Dimensionen und Ebenen des Diversity Managements vorgestellt.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Change Management, Diversity Management, interne Veränderungsprozesse, Diversität, Chancengleichheit, Wettbewerbsvorteil, ökonomische Gründe, rechtliche Gründe, ethisch-moralische Gründe, Dimensionen von Diversity, Ebenen von Diversity, Integration, Inklusion, Unternehmenserfolg, Personalmanagement, Globalisierung, Dynamik, Flexibilität, Anpassungsfähigkeit.
Häufig gestellte Fragen
Wie hängen Diversity Management und Change Management zusammen?
Diversity Management wird als Instrument des Change Managements betrachtet, um den kulturellen Wandel in Unternehmen zu gestalten und die Vielfalt der Mitarbeiter für den Unternehmenserfolg zu nutzen.
Was sind die ökonomischen Gründe für Diversity Management?
Dazu gehören die Erschließung neuer Märkte, eine höhere Innovationskraft durch vielfältige Teams und die Steigerung der Arbeitgeberattraktivität im Wettbewerb um Fachkräfte.
Welche Dimensionen umfasst Diversity?
Man unterscheidet Kerndimensionen wie Alter, Geschlecht, Ethnizität, Religion, sexuelle Orientierung und Behinderung sowie sekundäre Dimensionen wie Ausbildung oder Familienstand.
Warum ist Anpassungsfähigkeit für Unternehmen heute so wichtig?
Dynamische Märkte und die Globalisierung fordern von Unternehmen hohe Flexibilität, um auf komplexe Veränderungen vorausschauend reagieren zu können.
Was ist das Ziel von Diversity Management im Personalwesen?
Es geht nicht nur um die Toleranz von Verschiedenheit, sondern um die aktive Wertschätzung und Einbindung individueller Potenziale zur Steigerung der Effektivität.
Welche rechtlichen Gründe sprechen für Diversity Management?
In Deutschland ist vor allem das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) maßgeblich, das Diskriminierung am Arbeitsplatz verhindern soll.
- Citar trabajo
- Master of Arts Alexander Danisch (Autor), 2012, Diversity Management als Ziel und Instrument des Change Managements, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/267294