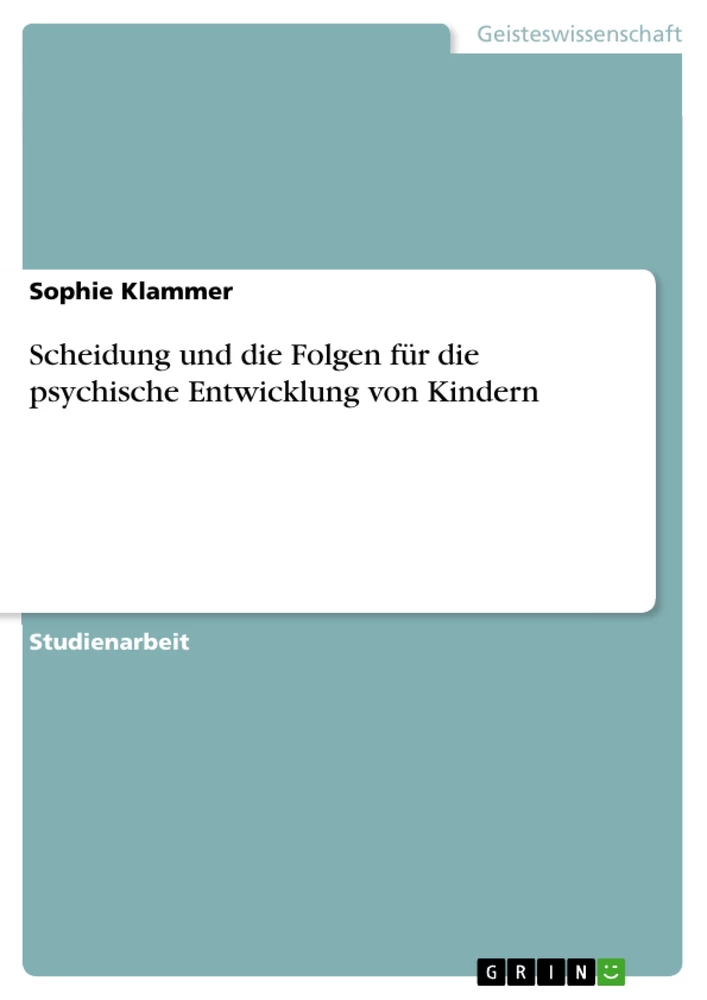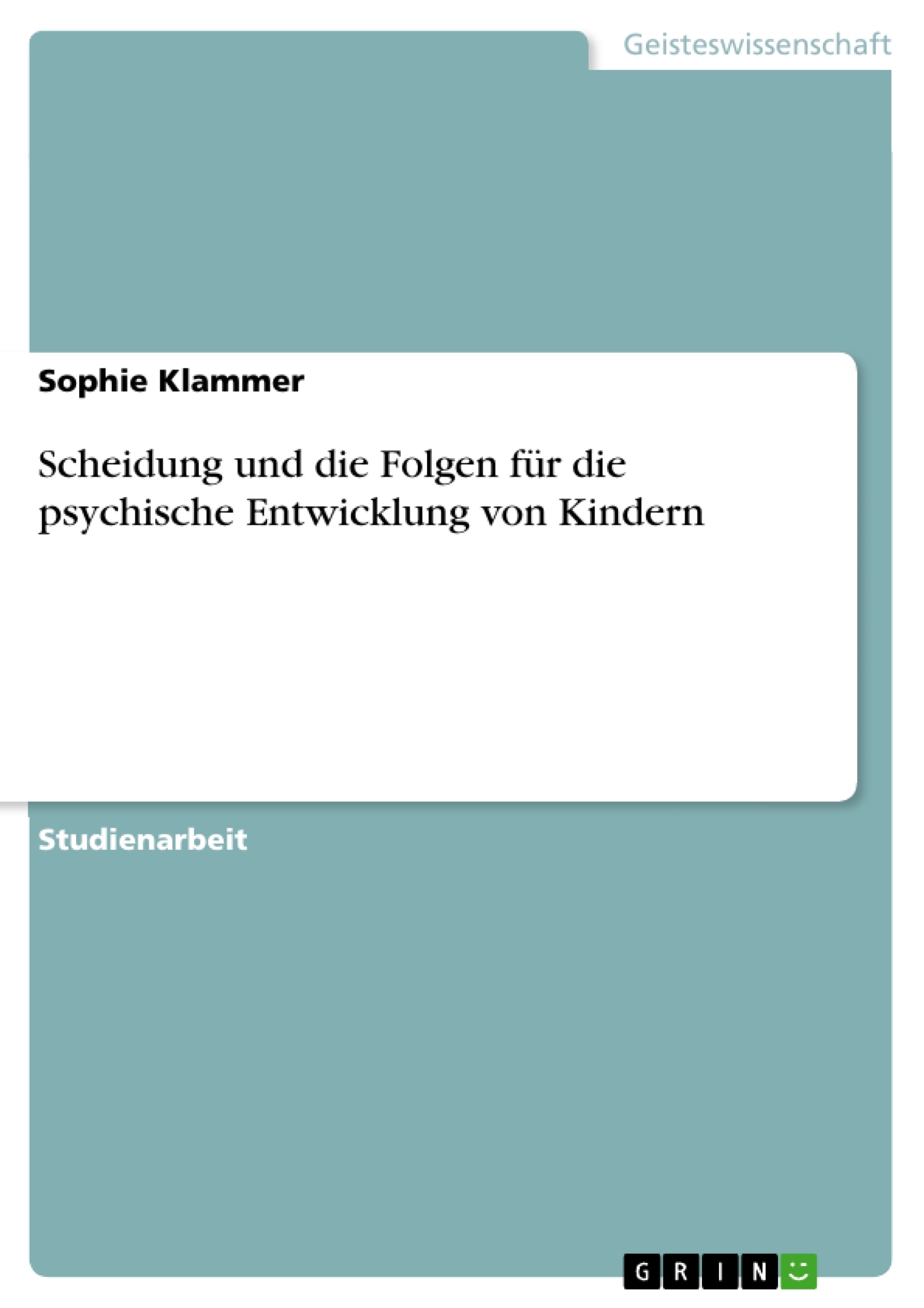Die nachfolgende Arbeit befasst sich mit den Folgen, die eine elterliche Scheidung auf die psychische Entwicklung des Kindes hat und dem Umgang der Kinder mit der Adoleszenz als Krise.
Die Auswahl des Themas orientiert sich an dem im Sommersemester 2013 besuchten Seminar über “Adoleszenz und junges Erwachsenenalter”. Im Zuge des Seminars fand eine Beschäftigung mit unterschiedlichen Aspekten innerhalb der Bewältigung der Adoleszenz statt. Da das Thema Scheidung noch nicht zur Sprache kam, wird sich damit in dieser Arbeit näher befasst. Außerdem scheint mir das Thema Scheidung und die Folgen für die psychische Entwicklung von Kindern in der gegenwärtigen Zeit zunehmend an Bedeutung zu gewinnen. Immerhin wird in Österreich etwa jede dritte Ehe geschieden - am häufigsten zwischen dem vierten und neunten Ehejahrjahr, also in einer Zeit in der die Kinder aus der Ehe noch relativ jung sind. (vgl.: Österreisches staatliches Zentralamt 1996, S. 509, 514 zit. nach:Niese 1998, S. 5) Somit werden auch Pädagogen mit den durch die Scheidung belasteten Kindern konfrontiert und müssen mögliche Wege finden jene in dieser ereignisreichen Zeit adäquat zu unterstützen. Zur Beantwortung meiner Frage möchte ich mich zuerst der Scheidung als Trennungsphänomen mit unterschiedlichen Phasen widmen. Weiterhin werden die Konsequenzen erläutert, die sich aus dem Verlassen eines Elternteils aus der Familie für die psychische Entwicklung des Kleinkindes ergeben. Danach wird die Adoleszenz als Reinszenierung dieser ungelösten Probleme in der Kindheit genauer betrachtet. Schlussfolgernd wird versucht mit dieser Phase den Umgang der Scheidungskinder im Gegensatz zu Nicht-Scheidungskindern darzustellen. Dazu möchte ich mich ausschließlich auf den Aspekt des Mangels an Selbstvertrauen und der Konsequenz, die sich im sexuellen Verhalten während der Frühadoleszenz zeigt, konzentrieren.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Veränderungen durch die Scheidung
- Die Scheidung
- Fundament der Adoleszenz bzw. die Bedeutung des Vaters in der Kindheit
- Die psychosoziale und pschosexuelle Entwicklung des Kleinkindes
- Beeinträchtigung der Individuation und der Objektbeziehungen
- Folgen einer unvollständigen Triangulierung infolge der Scheidung
- Adoleszenz
- Pädagogische Konsequenz
- Im Bezug auf die Eltern
- Im Bezug auf die Kinder
- Fazit
- Quellenverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Auswirkungen einer elterlichen Scheidung auf die psychische Entwicklung von Kindern, insbesondere im Hinblick auf die Bewältigung der Adoleszenz. Der Fokus liegt dabei auf Mädchen im Alter zwischen 3 und 5 Jahren, die den Verlust des Vaters als erstes Liebesobjekt erleben. Die Arbeit analysiert, wie die fehlende Triangulierung durch den Vater die Individuation und Objektbeziehungen des Kindes beeinflusst und welche Konsequenzen dies für das spätere sexuelle Verhalten in der Frühadoleszenz haben kann.
- Die Bedeutung der Triangulierung und Individuation in der frühen Kindheit
- Die Folgen einer unvollständigen Triangulierung infolge der Scheidung
- Die Adoleszenz als Reinszenierung kindlicher Erlebnisse
- Die Auswirkungen der Scheidung auf das Selbstbild und die Beziehungen zu Männern
- Pädagogische Konsequenzen und Unterstützungsmöglichkeiten für Scheidungskinder
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Scheidung und deren Auswirkungen auf die psychische Entwicklung von Kindern ein. Der Fokus liegt auf der Adoleszenz als einer Phase, in der kindliche Erlebnisse und ungelöste Probleme wieder aufgegriffen werden.
Das zweite Kapitel beleuchtet die Scheidung als einen phasenhaften Prozess, der sich in die Vorscheidungs- bzw. Ambivalenzphase, die Scheidungsphase und die Nachscheidungsphase gliedert. Es werden die Herausforderungen und Belastungen für die Kinder in jeder Phase beschrieben, insbesondere die Auswirkungen auf ihre psychische Entwicklung und ihre Fähigkeit, die Trennung zu verarbeiten.
Das dritte Kapitel befasst sich mit der Bedeutung des Vaters in der frühen Kindheit für die psychosoziale und psychosexuelle Entwicklung des Kindes. Es wird erläutert, wie die Triangulierung zwischen Vater, Mutter und Kind eine wichtige Rolle für die Individuation und die Bildung von Objektbeziehungen spielt.
Das vierte Kapitel untersucht die Folgen einer unvollständigen Triangulierung infolge der Scheidung. Es wird beschrieben, wie der fehlende Vater die Beziehung des Kindes zur Mutter negativ beeinflussen kann und welche Auswirkungen dies auf das Selbstbild und die Objektbeziehungen des Kindes hat.
Das fünfte Kapitel beleuchtet die Adoleszenz als eine Phase, in der die Folgen der Scheidung in Form von Verhaltensauffälligkeiten und Problemen im Umgang mit Liebesbeziehungen zum Vorschein kommen können.
Das sechste Kapitel befasst sich mit den pädagogischen Konsequenzen der Scheidung und den Möglichkeiten, Kinder in dieser schwierigen Phase zu unterstützen. Es werden konkrete Maßnahmen für die Arbeit mit Eltern und Kindern in Scheidungsfamilien vorgestellt.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die elterliche Scheidung, die psychische Entwicklung von Kindern, die Adoleszenz, die Triangulierung, die Individuation, Objektbeziehungen, das Selbstbild, das sexuelle Verhalten und die pädagogische Unterstützung von Scheidungskindern. Die Arbeit beleuchtet die Auswirkungen der Scheidung auf die Entwicklung von Mädchen im Alter zwischen 3 und 5 Jahren und die Herausforderungen, die sich in der Adoleszenz für diese ergeben.
Häufig gestellte Fragen
Welche Auswirkungen hat eine Scheidung auf die psychische Entwicklung von Kleinkindern?
Besonders bei Kindern im Alter von 3 bis 5 Jahren kann der Verlust eines Elternteils (oft des Vaters) die Individuation und die Entwicklung gesunder Objektbeziehungen beeinträchtigen.
Was bedeutet „unvollständige Triangulierung“ infolge einer Scheidung?
Triangulierung beschreibt die Dreiecksbeziehung zwischen Mutter, Vater und Kind. Fehlt der Vater, kann dies die Loslösung des Kindes von der Mutter erschweren und die psychosoziale Entwicklung stören.
Warum gilt die Adoleszenz als kritische Phase für Scheidungskinder?
In der Adoleszenz werden ungelöste Probleme aus der Kindheit oft reinszeniert. Scheidungskinder zeigen hier häufiger Mangel an Selbstvertrauen und Auffälligkeiten im Beziehungs- oder Sexualverhalten.
Wie unterscheidet sich das sexuelle Verhalten von Scheidungskindern in der Frühadoleszenz?
Die Arbeit untersucht, dass der frühe Verlust des Vaters als erstes Liebesobjekt bei Mädchen zu Unsicherheiten führen kann, die sich in einem spezifischen Umgang mit Sexualität und Partnerwahl äußern.
Welche pädagogischen Konsequenzen ergeben sich aus einer Scheidung?
Pädagogen müssen belastete Kinder adäquat unterstützen und auch die Eltern in ihrer Erziehungsrolle stärken, um die negativen Folgen der Trennung abzufedern.
Welche Phasen kennzeichnen den Scheidungsprozess für das Kind?
Man unterscheidet die Vorscheidungsphase (Ambivalenz), die eigentliche Scheidungsphase und die Nachscheidungsphase, wobei jede Phase unterschiedliche psychische Belastungen mit sich bringt.
- Quote paper
- Sophie Klammer (Author), 2013, Scheidung und die Folgen für die psychische Entwicklung von Kindern, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/267390