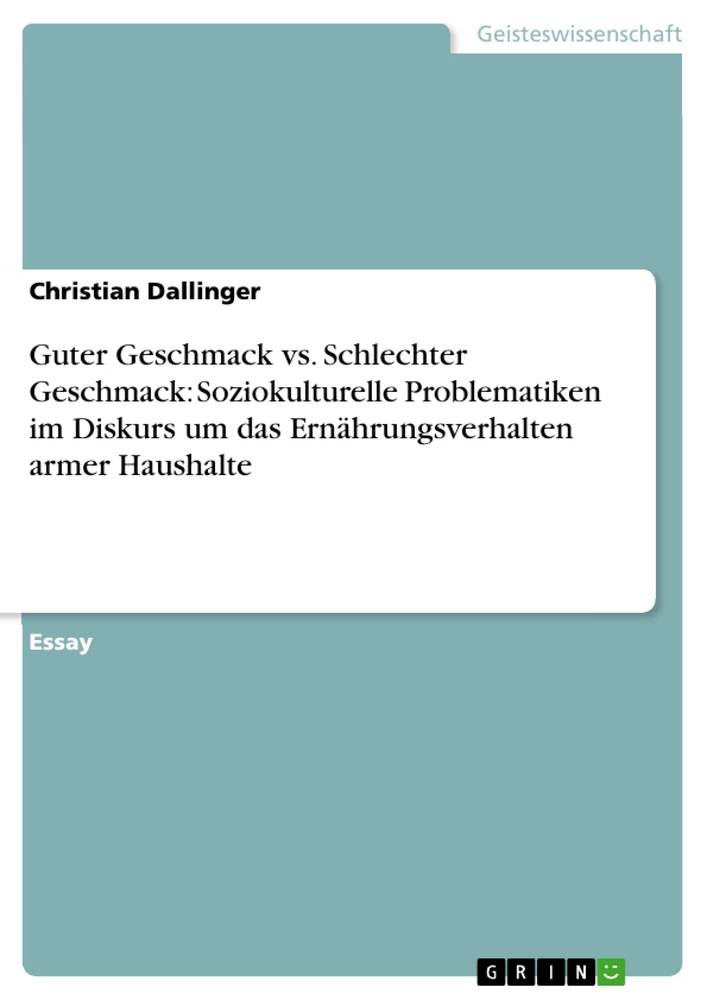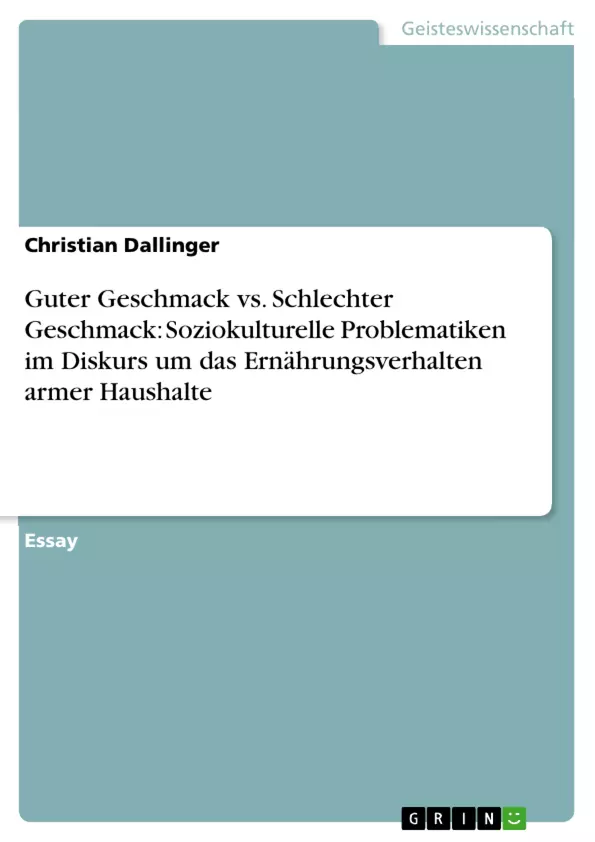Da die soziokulturelle Dimension in den meisten Ernährungsstudien im deutschsprachigen Raum kaum zur Kenntnis genommen wird, können auch verhaltensrelevante Bedingungen nicht genügend beachtet werden und dementsprechend Verhaltensweisen auch kaum von Verhaltensresultaten unterschieden werden. In dieser Hinsicht bleibt der überwiegende Teil der sich primär auf Gesundheitsförderung bezogenen Studien mehr Verhaltens – als verhältnisorientiert. Letztlich führt daher eine Ursachenanalyse immer wieder nicht weit über das wohlbekannte „zu fett, zu süß, zu salzig“ hinaus. Nicht unerwähnt bleiben darf dabei auch noch, dass hierbei auch kein erkennbarer Brückenschlag zwischen dem eindeutig vorhandenen schlechteren Ernährungs- und Gesundheitsstatus der unteren sozialen Klassen und ihren jeweiligen Lebensumständen erfolgt.
Meine Arbeit wird sich demgemäß damit beschäftigen einem eher vernachlässigten verhältnisorientierten Zugang zum Thema Armut und Ernährung mehr Geltung zu verschaffen, indem ich mich etwas eingängiger mit dem soziologischen Lebensstilkonzept auseinandersetze. Insbesondere wird diesbezüglich auf das Habituskonzept Bourdieus und auf sein Verständnis von Geschmack als einer Repräsentation von Lebensstilen und sozialer Distinktion direkt Bezug genommen. Somit wird gleich im Anschluss auf Bourdieus Habitus- und Lebensstilkonzept gefolgt von einer etwas intensiveren Auseinandersetzung mit dem Begriff des Geschmacks bei Bourdieu und dessen Bedeutung als Instrument sozialer Distinktion. Im Anschluss soll der naturgemäße Lebensstil, der seit einiger Zeit die Definitionsmacht über guten und schlechten bzw. legitimen und illegitimen Geschmack hat, vorgestellt werden, wobei auch auf die sich hierbei herausbildenden Gegensatzstrukturen Mäßigung versus Zügellosigkeit und deren Objektivierung in dick versus schlank eingegangen werden soll. Den Abschluss bildet sodann der Problemkomplex nachhaltige Ernährung und Armut. Hierbei sollen Problematiken der unteren sozialen Schichten mit dem Thema gesunde und nachhaltige Ernährung erörtert werden und anschließend auch einige mögliche Nachhaltigkeitsstrategien für arme Haushalte nicht unerwähnt bleiben.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Armut und Ernährung
- 2 Ernährung und Lebensstil
- 2.1 Habitus und Lebensstil
- 2.2 Der Geschmack als Mittel der Distinktion - Gegensatzstrukturen Luxus
- 2.3 Die Macht des Geschmacks – der legitime Geschmack
- 3 Die neuen Gegensatzstrukturen in der Ernährung
- 3.1 Der naturgemäße Essstil als Leitlebensstil in der Ernährung und neuer
- 3.2 Der Notwendigkeitsgeschmack als illegitimer Geschmack
- 3.3 Körperlichkeit und Geschmack - fit und schlank vs. träge und fett
- 4 Nachhaltige Ernährung in der Armut - Ein
- 4.1 Was bedeutet nachhaltige Ernährung
- 4.2 Nachhaltige Ernährung und arme Haushalte
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die soziokulturellen Aspekte von Ernährungsverhalten in armen Haushalten. Sie hinterfragt die bestehenden Gegensätze zwischen "gutem" und "schlechtem" Geschmack im Kontext sozialer Ungleichheit und beleuchtet die Rolle des Lebensstils und des Habitus nach Bourdieu. Die Arbeit vermeidet rein gesundheitsökonomische Ansätze und konzentriert sich auf die kulturellen und gesellschaftlichen Determinanten des Ernährungsverhaltens.
- Der Einfluss des soziokulturellen Habitus auf Ernährungsentscheidungen armer Haushalte
- Die Konstruktion von "gutem" und "schlechtem" Geschmack im Kontext von Armut
- Die Rolle von Lebensstilen und sozialer Distinktion bei der Nahrungsmittelauswahl
- Der "naturgemäße" Lebensstil als neuer Maßstab für "guten" Geschmack und seine Auswirkungen auf arme Haushalte
- Herausforderungen und Strategien für nachhaltige Ernährung in armen Haushalten
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung legt den Fokus auf die Forschungslücke im deutschsprachigen Raum bezüglich soziokultureller Aspekte von Armut und Ernährung. Sie verweist auf bestehende Studien, die zwar Zusammenhänge zwischen Einkommen, Bildung und Ernährungsgewohnheiten aufzeigen, jedoch die soziokulturellen Dimensionen vernachlässigen. Es wird deutlich, dass die bestehenden Studien oft rein quantitativ sind und die Komplexität der Problematik nicht hinreichend erfassen. Die Arbeit kündigt daher einen soziologischen Ansatz an, der den Habitus und den Geschmack als zentrale Analysekategorien verwendet.
2 Ernährung und Lebensstil: Dieses Kapitel analysiert den Habitus nach Bourdieu und dessen Bedeutung für die Erklärung sozialer Praktiken, einschließlich des Ernährungsverhaltens. Es wird der Geschmack als Mittel der sozialen Distinktion und als Ausdruck von Lebensstilen vorgestellt. Der Abschnitt legt den Grundstein für die spätere Auseinandersetzung mit den neuen Gegensatzstrukturen in der Ernährung, indem er die theoretischen Grundlagen liefert.
3 Die neuen Gegensatzstrukturen in der Ernährung: Dieser Kapitelteil untersucht den „naturgemäßen“ Lebensstil als dominierenden Faktor, der den „guten“ Geschmack definiert und im Kontrast zum „Notwendigkeitsgeschmack“ armer Haushalte steht. Es wird die Dichotomie von Mäßigung/Zügellosigkeit und deren Objektivierung in „dick/schlank“ analysiert. Die Kapitel verdeutlicht die gesellschaftliche Konstruktion von „gutem“ und „schlechtem“ Geschmack und die daraus resultierenden Ungleichheiten.
Schlüsselwörter
Armut, Ernährung, Habitus, Lebensstil, Geschmack, soziale Distinktion, soziokulturelle Aspekte, nachhaltige Ernährung, Gesundheitsförderung, soziale Ungleichheit, Bourdieu.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Soziokulturelle Aspekte von Armut und Ernährung
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die soziokulturellen Aspekte von Ernährungsverhalten in armen Haushalten. Sie betrachtet die bestehenden Gegensätze zwischen "gutem" und "schlechtem" Geschmack im Kontext sozialer Ungleichheit und beleuchtet die Rolle des Lebensstils und des Habitus nach Bourdieu. Der Fokus liegt auf den kulturellen und gesellschaftlichen Determinanten des Ernährungsverhaltens, nicht auf gesundheitsökonomischen Aspekten.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit befasst sich mit dem Einfluss des soziokulturellen Habitus auf Ernährungsentscheidungen armer Haushalte, der Konstruktion von "gutem" und "schlechtem" Geschmack in Verbindung mit Armut, der Rolle von Lebensstilen und sozialer Distinktion bei der Nahrungsmittelauswahl, dem "naturgemäßen" Lebensstil als neuem Maßstab für "guten" Geschmack und dessen Auswirkungen auf arme Haushalte sowie den Herausforderungen und Strategien für nachhaltige Ernährung in armen Haushalten.
Welche theoretischen Grundlagen werden verwendet?
Die Arbeit verwendet den Habitus-Begriff nach Pierre Bourdieu als zentrale Analysekategorie, um soziale Praktiken, insbesondere das Ernährungsverhalten, zu erklären. Der Geschmack wird als Mittel der sozialen Distinktion und Ausdruck von Lebensstilen betrachtet.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zu Ernährung und Lebensstil, ein Kapitel zu den neuen Gegensatzstrukturen in der Ernährung und ein Kapitel zu nachhaltiger Ernährung in der Armut. Die Einleitung beschreibt die Forschungslücke und den methodischen Ansatz. Die Kapitel analysieren den Habitus, den Geschmack als Mittel der Distinktion, den "naturgemäßen" Lebensstil im Vergleich zum "Notwendigkeitsgeschmack" und die Herausforderungen nachhaltiger Ernährung in armen Haushalten.
Welche Kapitelzusammenfassungen werden angeboten?
Die Zusammenfassung der Kapitel beschreibt den Fokus der Einleitung auf die Forschungslücke im deutschsprachigen Raum bezüglich soziokultureller Aspekte von Armut und Ernährung. Kapitel 2 analysiert den Habitus nach Bourdieu und dessen Bedeutung für das Ernährungsverhalten. Kapitel 3 untersucht den „naturgemäßen“ Lebensstil als dominierenden Faktor für "guten" Geschmack im Kontrast zum "Notwendigkeitsgeschmack".
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Die relevanten Schlüsselwörter sind: Armut, Ernährung, Habitus, Lebensstil, Geschmack, soziale Distinktion, soziokulturelle Aspekte, nachhaltige Ernährung, Gesundheitsförderung, soziale Ungleichheit, Bourdieu.
Welche Forschungslücke wird geschlossen?
Die Arbeit schließt die Forschungslücke im deutschsprachigen Raum bezüglich der soziokulturellen Aspekte von Armut und Ernährung. Bisherige Studien fokussierten oft quantitativ auf Zusammenhänge zwischen Einkommen, Bildung und Ernährung, vernachlässigten aber die soziokulturellen Dimensionen.
Was ist der methodische Ansatz?
Die Arbeit verwendet einen soziologischen Ansatz, der den Habitus und den Geschmack als zentrale Analysekategorien verwendet. Rein gesundheitsökonomische Ansätze werden vermieden.
- Arbeit zitieren
- Mag. phil. Christian Dallinger (Autor:in), 2013, Guter Geschmack vs. Schlechter Geschmack: Soziokulturelle Problematiken im Diskurs um das Ernährungsverhalten armer Haushalte, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/267442