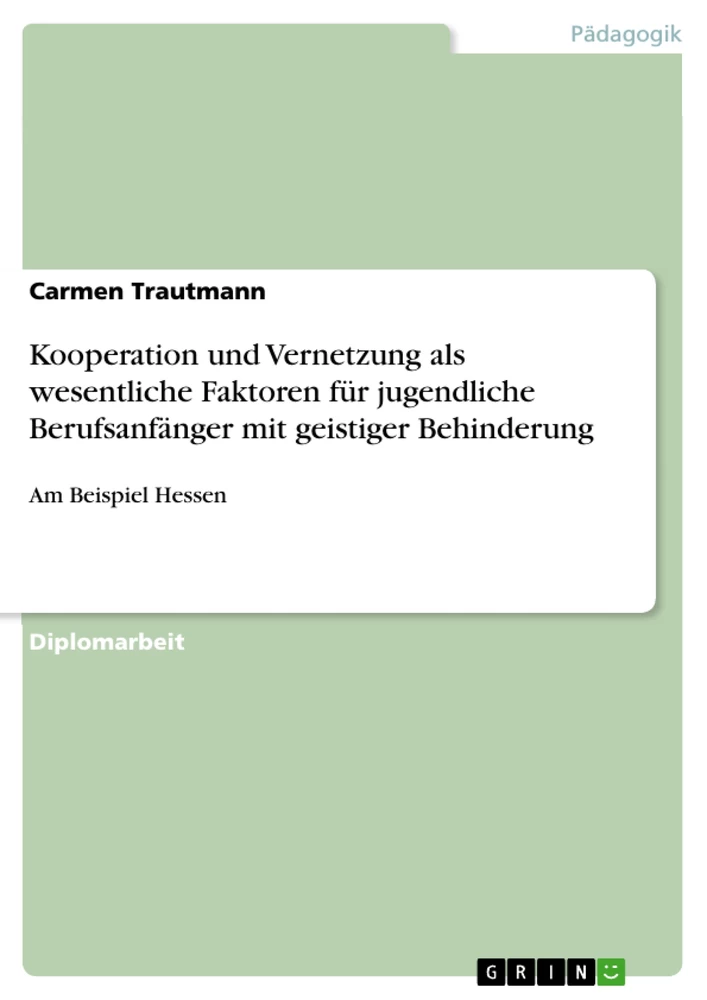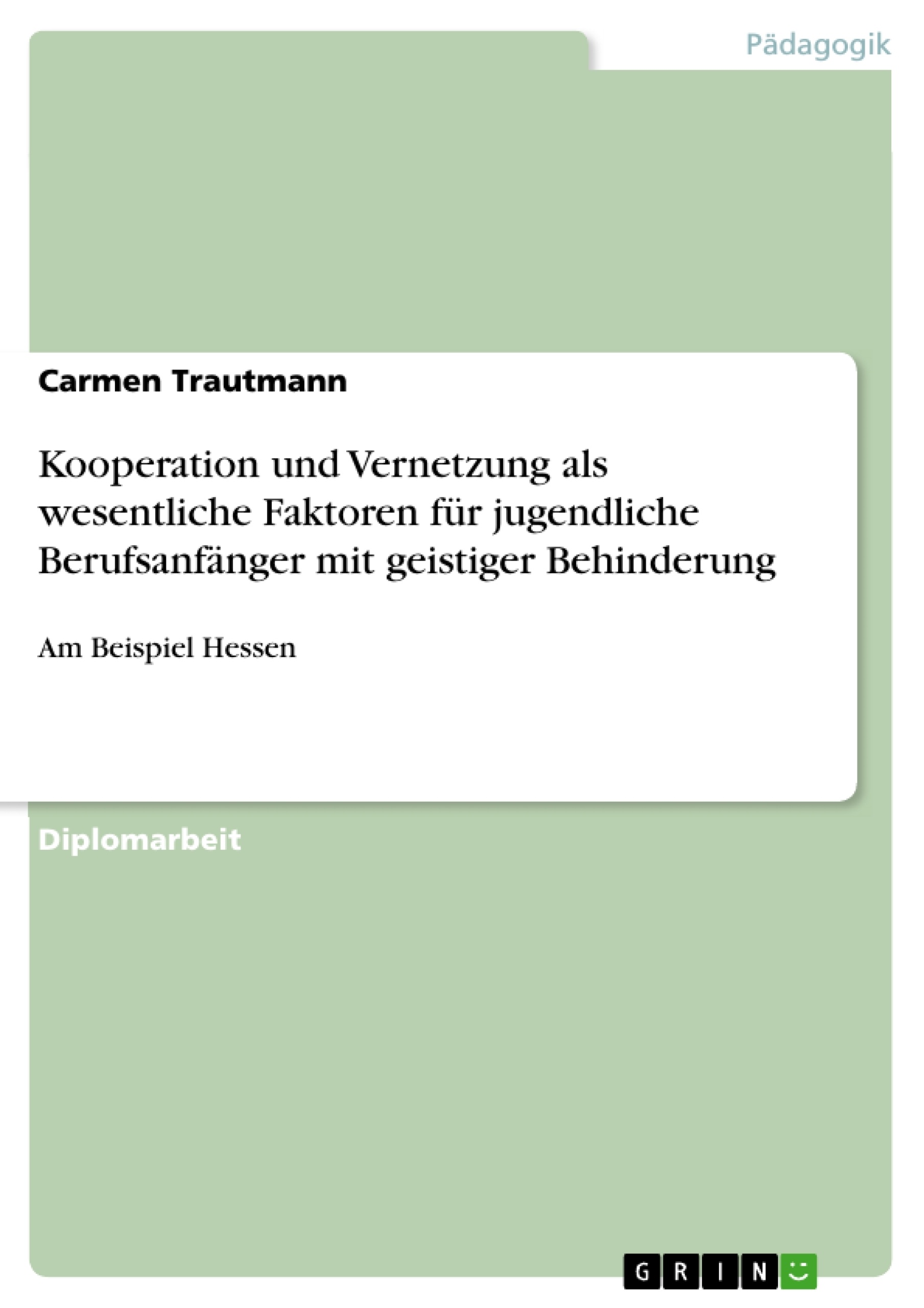Menschen mit geistiger Behinderung sind in ihrem Leben auf
unterschiedlichste Hilfssysteme und Institutionen angewiesen, die durch
unterschiedliche Schwerpunkte bezüglich der beruflichen Qualifikation und
Integration gekennzeichnet sind. Die viele Institutionen, die ihren Beitrag zur Qualifikation und Integration von
jungen Menschen mit geistiger Behinderung leisten, tun dies jedoch oft
ausschließlich in ihrem eigenen Zuständigkeitsbereich (vgl. PBI 1995, S.42).
So bereitet die Schule für Praktisch Bildbare ihre Schüler auf ein beruflichintegratives
Leben vor (Selbstverwirklichung in sozialer Integration), das
Arbeitsamt berät und fördert den Übergang in das Berufsleben. Dies alles wird
gestützt durch das einzelfallorientierte Vorgehen der Integrationsfachdienste
mit unmittelbaren Kontakten zum Berufsanwärter mit geistiger Behinderung
sowie zu dessen Eltern. Zur Aufrechterhaltung eines sich etablierten
Arbeitsverhältnisses trägt dann das Angebot des Psychosozialen Dienstes bei,
und das Integrationsamt sorgt für den Kündigungsschutz von Menschen mit
Behinderung und für begleitende Hilfen im Arbeits- und Berufsleben. Und falls
eine direkte Integration in den allgemeinen Arbeitsmarkt noch nicht möglich
ist, sollte die Teilnahme an einer Maßnahme im Berufsbildungsbereich den
Menschen mit geistiger Behinderung die Möglichkeit bieten, auf eine
weiterführende Ausbildung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt vorbereitet zu
werden, in den Arbeitsbereich der Werkstatt für behinderte Menschen
übergehen zu können oder eine Übergangsqualifikation erwerben zu können,
die ihnen eine weiterführende Ausbildungsmaßnahme ermöglicht. Der Mensch mit geistiger Behinderung macht hierbei jedoch die Erfahrung,
dass er von jedem Teilsystem unterschiedlich gesehen und angesprochen wird.
Doch das System Mensch ist unteilbar, daher müssen die unterschiedlichen
Teilsysteme kooperativ zusammenarbeiten, um den Menschen als Ganzes
möglichst optimal zu fördern und voranzubringen (vgl. SPECK 1998, S. 531).
Inhaltsverzeichnis
- 1.) Zielsetzung und Problemstellung der Arbeit
- 2.) Die Übergangsphase Schule/Arbeitswelt
- 2.1.) Übergangsphasen sind stets krisenbehaftet eine grundsätzliche Betrachtung
- 2.2.) Der Übergang von der Kindheit zur Jugend
- Identitätsfindung und -bildung
- 2.3.) Die Übergangsphase Schule / Arbeitswelt
- 2.3.1.) Aus dem Schonraum Schule in den Ernst des Lebens
- neue Lebensgestaltungsanforderungen an das Individuum
- 2.3.2.) Der Hauptschulabschluss als Mindestvoraussetzung für eine berufliche Ausbildung im dualen Berufsbildungssystem
- Soziale Schlüsselqualifikationen
- 2.3.3.) soziale Kompetenz als unverzichtbare Ausgestaltungsfaktoren der Übergangsphase Schule Arbeitswelt
- 2.3.4.) Gesellschaftlich bedingte Benachteiligungsfaktoren für jugendliche Berufsanwärter mit geistiger Behinderung im Berufsvorbereitungsprozess
- 2.3.4.1.) Geistige Behinderung als Arbeitskraft minderer Güte
- 2.3.4.2.) Die defizit- und defektorientierte Sichtweise des jugendlichen Berufsanwärters mit geistiger Behinderung (medizinisch defizitäres Menschenbild)
- 2.3.4.3.) Der immer noch traditionell praktizierte Automatismus „Schülerschaft auf der Schule für Geistigbehinderte führt zur Mitarbeiterschaft der Werkstatt für behinderte Menschen”
- 2.3.4.4.) Das alleinige Planen und Handeln im eigenen Zuständigkeitsbereich ohne Kooperations- und Informationskontakte zu anderen am beruflichen Kooperationsprozess Beteiligten
- 3.) Kooperation und Vernetzung ein neuer Weg zur verbesserten Ausgestaltung der Übergangsphase Schule /Arbeitswelt im Hinblick auf effiziente berufliche Qualifizierungs- und Integrationsprozesse von jugendlichen Berufsanfängern mit geistiger Behinderung.
- 3.1.) Kooperation
- 3.1.1.) Kooperation was ist das?
- 3.1.2.) Das Kooperationsfeld der beruflichen Rehabilitation und Integration
- 3.1.3.) Kooperationsformen
- 3.1.3.1.) Interdisziplinäre Aspekte
- 3.1.3.2.) Personale Aspekte
- 3.1.4.) Bedingungen verbesserter Kooperation
- 3.2.) Vernetzung – Begriffsklärung, Ziele und Inhalte
- 3.3.) Die am beruflichen Rehabilitationsprozess und am Aufbau eines Systems von Kooperation und Vernetzung beteiligten Institutionen
- 3.3.1.) Die Werkstufe der Schule für Praktisch Bildbare
- 3.3.2.) Die regional zuständige Berufschule
- 3.3.3.) Der Berufsbildungsbereich der Werkstatt für behinderte Menschen
- Exkurs: Detmolder-Lernwege-Modell
- 3.3.4.) Das Örtlich zuständige Arbeitsamt
- 3.3.5.) Der regionalansässige Integrationsfachdienst
- 3.3.6.) Der jugendliche Berufsanwärter mit geistiger Behinderung
- 3.3.7.) Die Eltern
- 3.3.8.) Der Psychosoziale Dienst (nach erfolgter beruflicher Eingliederung)
- 3.3.9.) Das Integrationsamt
- 3.4.) „Runde Tische“ innerhalb der Region als eine Möglichkeit der Kooperation der am beruflichen Qualifizierungs- und Integrationsprozess beteiligten Institutionen
- 34.) Welche Möglichkeiten und Chancen bietet uns das SGB IX im Hinblick auf die Umsetzung von Kooperations- und Vernetzungsstrategien im Rahmen beruflicher Qualifizierungs- und Integrationsprozesse?
- 5.) Kooperation und Vernetzung in der modernen Informationsgesellschaft: Eine zukunftsszenarische Ideensammlung zur verbesserten Ausgestaltung von beruflichen Qualifizierungs- und Integrationsprozessen für Menschen mit geistiger Behinderung - thesenhaft formuliert.
- Die Herausforderungen des Übergangs Schule/Arbeitswelt für junge Menschen mit geistiger Behinderung.
- Die Rolle von Kooperation und Vernetzung in der beruflichen Rehabilitation und Integration.
- Die verschiedenen Akteure im Übergangsprozess und ihre jeweiligen Aufgaben.
- Die Bedeutung von sozialer Kompetenz und Schlüsselqualifikationen.
- Die Herausforderungen der Defizit- und Defektorientierten Sichtweise im Bezug auf Menschen mit geistiger Behinderung.
- Kapitel 1 stellt die Zielsetzung und Problemstellung der Arbeit vor. Es wird die Notwendigkeit von Kooperation und Vernetzung im Übergangsprozess hervorgehoben.
- Kapitel 2 betrachtet die Übergangsphase Schule/Arbeitswelt als eine krisenanfällige Orientierungsphase. Es werden die Herausforderungen des Übergangs für alle Jugendlichen und speziell für junge Menschen mit geistiger Behinderung dargestellt.
- Kapitel 3 beleuchtet den Stellenwert von Kooperation und Vernetzung im Übergangsprozess. Es werden verschiedene Kooperationsformen und die beteiligten Institutionen vorgestellt.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht die Bedeutung von Kooperation und Vernetzung im Übergang von der Schule in die Arbeitswelt für junge Berufsanfänger mit geistiger Behinderung. Dabei wird der Fokus auf die Situation in Hessen gelegt.
Zusammenfassung der Kapitel
Schlüsselwörter
Geistige Behinderung, Übergang Schule/Arbeitswelt, Kooperation, Vernetzung, berufliche Rehabilitation, Integration, soziale Kompetenz, Schlüsselqualifikationen, Integrationsfachdienst, Werkstatt für behinderte Menschen, SGB IX.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist der Übergang von der Schule in den Beruf für Menschen mit geistiger Behinderung schwierig?
Dieser Übergang ist oft krisenhaft, da er den Wechsel aus dem Schonraum Schule in den Ernst des Lebens bedeutet und oft durch defizitorientierte Sichtweisen erschwert wird.
Welche Rolle spielen Kooperation und Vernetzung?
Da das „System Mensch“ unteilbar ist, müssen Institutionen wie Schulen, Arbeitsämter und Werkstätten zusammenarbeiten, um eine optimale Förderung zu gewährleisten.
Was ist der Integrationsfachdienst?
Er bietet einzelfallorientierte Beratung und Unterstützung für Berufsanfänger mit Behinderung sowie deren Eltern und Arbeitgeber.
Welche Bedeutung hat das SGB IX in diesem Prozess?
Das SGB IX bietet die rechtliche Grundlage für die Umsetzung von Kooperations- und Vernetzungsstrategien in der beruflichen Rehabilitation.
Was sind „Runde Tische“ in der Region?
Sie dienen als Instrument der regionalen Kooperation, um alle am Qualifizierungsprozess beteiligten Institutionen an einen Tisch zu bringen.
- Citation du texte
- Carmen Trautmann (Auteur), 2002, Kooperation und Vernetzung als wesentliche Faktoren für jugendliche Berufsanfänger mit geistiger Behinderung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/26819