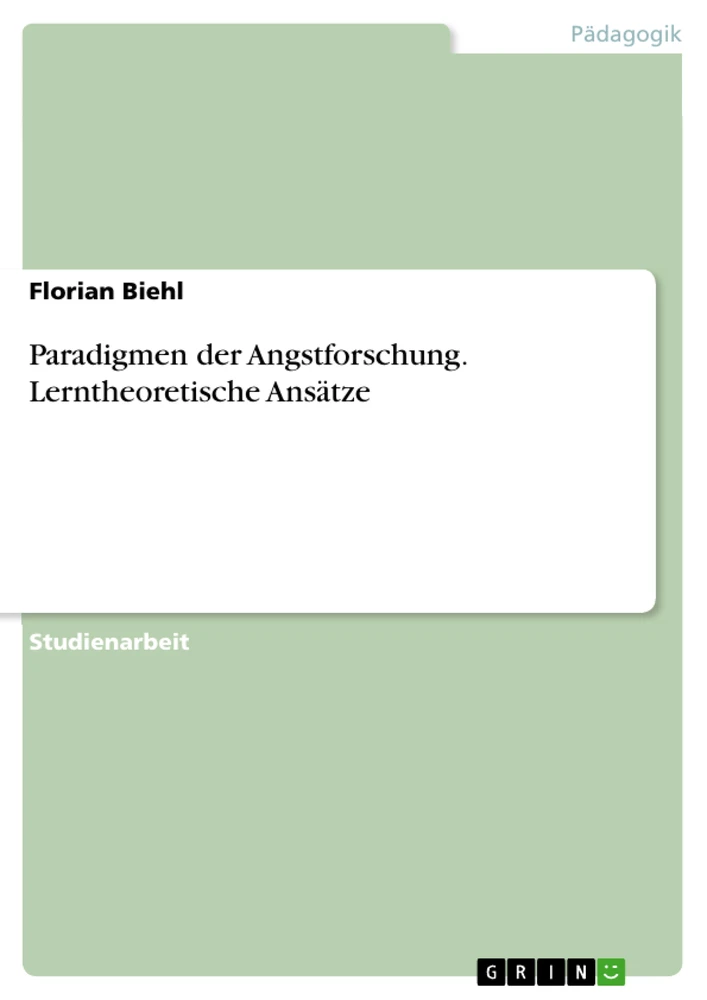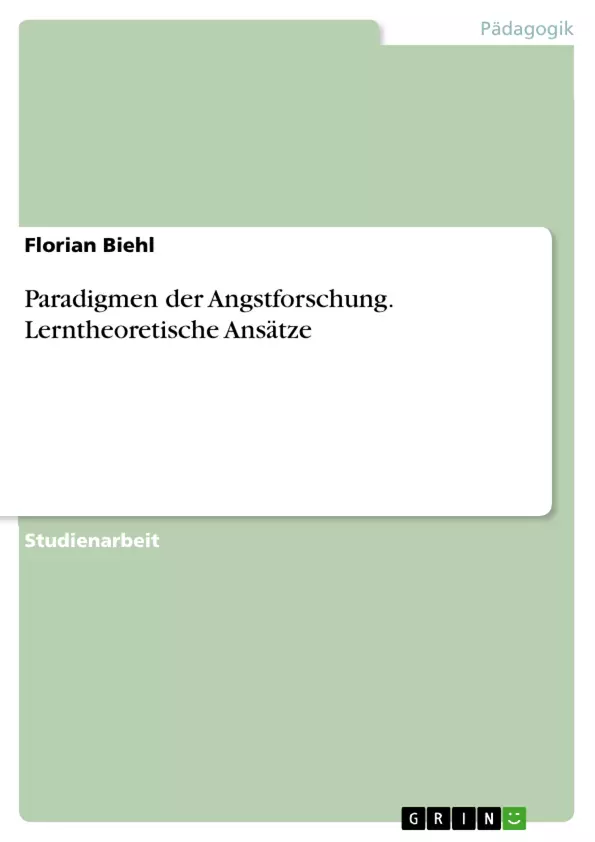Ein Phänomen, dessen Messung und Erforschung die Wissenschaft schon lange beschäftigt, ist die Angst. Besonders im pädagogischen Bereich der Erziehung kommt es immer wieder zu der bedeutsamen Frage, wie Angst entsteht, was sie auslöst und besonders, wie sie wieder zu beseitigen ist bzw. wie sie gar nicht erst entsteht.
Gerade im schulischen Kontext stellt sich diese Frage häufig, da die Schule ein Ort ist, an dem viele Kinder und Jugendliche ihre ersten intensiven Angsterfahrungen machen. Die Folgen dieser Erfahrungen sind sowohl in ihrer Entstehung als auch in ihren Auswirkungen auf den betroffenen Schüler vielseitig und unterschiedlich.
Somit gilt, besonders von Seiten der Lehrer und der Eltern, den möglichen Antworten, die die Wissenschaft erbringen kann, großes Interesse. Denn nur, wenn der erziehenden Person bewusst ist, wodurch ein Schüler Angst entwickelt, kann er ihr entgegenwirken und Rahmenbedingungen schaffen, in denen Angst entweder gar nicht erst entsteht oder die zu diesem Zustand führenden Elemente so abändern, dass sie nicht mehr bedrohlich oder angstauslösend wirken und sich das negativ geprägte Verhalten des Schülers wieder ändert.
Im nun folgenden Text wird zunächst definiert, was Angst eigentlich ist und ob sie erlernbar ist. Ist dies der Fall, führt das zu der Frage, ob sie dann auch wieder verlernt werden kann, wenn die entsprechenden äußeren Parameter, die sie hervorriefen, geändert werden.
Im Hauptteil werden repräsentativ vier klassische Lerntheorien vorgestellt, welche einem angehenden Pädagogen bekannt sein sollten, um die Entstehungsmöglichkeiten von Angst zu verstehen. Zunächst wird die jeweilige Theorie näher erläutert und in einem jeweils dazugehörenden Experiment veranschaulicht. Danach folgt ein zu dem Experiment passendes, frei erfundenes Fallbeispiel inklusiven eines Lösungsvorschlages aus dem schulischen Alltag, um die Relevanz der vorgestellten Theorie praktisch zu veranschaulichen. Die vier Lerntheorien, die vorgestellt werden, sind das klassische sowie das operante Konditionieren nach Iwan P. Pawlow bzw. Burrhus F. Skinner, die Zwei-Faktoren-Theorie nach Orval H. Mowrer und das Lernen am Modell nach Albert Banduras.
Abschließend wird geklärt, ob Angst nach Erläuterung dieser Theorien als erlernbar angesehen werden kann und, wenn ja, wie man als Lehrperson einem solchen fragwürdigen „Lernerfolg“ entgegenwirken kann, um dem Schüler angstfreies Lernen zu ermöglichen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Definition von Angst
- Klassische Lerntheorien
- Klassische Konditionierung
- Erläuterung
- Der pawlowsche Hund
- Schulisches Fallbeispiel
- Operante Konditionierung
- Erläuterung
- Die Skinner-Box
- Schulisches Fallbeispiel
- Zwei-Faktoren-Theorie der Angstentstehung
- Erläuterung
- Das Miller-Experiment zur Zwei-Faktoren-Theorie
- Schulisches Fallbeispiel
- Modellernen
- Erläuterung
- Das Rocky-Experiment
- Schulisches Fallbeispiel
- Klassische Konditionierung
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Text befasst sich mit dem Phänomen der Angst und analysiert, wie sie durch klassische Lerntheorien erklärt werden kann. Das Ziel ist es, pädagogischen Fachkräften ein Verständnis für die Entstehung von Angst zu vermitteln und ihnen Werkzeuge an die Hand zu geben, um Angst im schulischen Kontext zu begegnen.
- Definition von Angst und ihre Unterscheidung in „state“ und „trait“
- Vorstellung klassischer Lerntheorien, die die Entstehung von Angst erklären
- Analyse von Experimenten zur Veranschaulichung der Theorien
- Anwendung der Theorien in schulischen Fallbeispielen
- Diskussion der Frage, ob Angst erlernbar ist und wie man angstfreiem Lernen entgegenwirken kann
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema Angst ein und erläutert seine Bedeutung im pädagogischen Bereich. Anschließend wird die Definition von Angst vorgestellt, wobei die Unterscheidung zwischen „state“ und „trait“ beleuchtet wird.
Das Hauptkapitel beschäftigt sich mit klassischen Lerntheorien, die die Entstehung von Angst erklären. Der Text erläutert die klassische Konditionierung, das operante Konditionieren, die Zwei-Faktoren-Theorie und das Modellernen. Jedes dieser Konzepte wird anhand von Experimenten veranschaulicht und durch ein schulisch relevantes Fallbeispiel illustriert.
Schlüsselwörter
Angst, Lerntheorie, klassische Konditionierung, operante Konditionierung, Zwei-Faktoren-Theorie, Modellernen, pädagogischer Kontext, Schule, Angstbewältigung.
Häufig gestellte Fragen
Kann Angst gelernt werden?
Ja, Lerntheorien zeigen, dass Angst oft eine Reaktion auf bestimmte Reize oder Erfahrungen ist, die im Laufe der Zeit erworben wurden.
Was ist der Unterschied zwischen "State"- und "Trait"-Angst?
"State"-Angst ist ein vorübergehender Zustand in einer bedrohlichen Situation, während "Trait"-Angst eine dauerhafte Persönlichkeitseigenschaft beschreibt.
Welche Rolle spielt die klassische Konditionierung bei Angst?
Nach Pawlow kann ein neutraler Reiz (z.B. ein Schulgebäude) durch die Koppelung mit einem negativen Erlebnis selbst zum angstauslösenden Reiz werden.
Was besagt die Zwei-Faktoren-Theorie von Mowrer?
Sie kombiniert klassische Konditionierung (Entstehung der Angst) mit operanter Konditionierung (Aufrechterhaltung der Angst durch Vermeidung).
Wie können Lehrer Schülern bei Prüfungsangst helfen?
Durch die Gestaltung angstfreier Rahmenbedingungen und das Verständnis der Lernprozesse können negative Konditionierungen wieder "verlernt" werden.
- Arbeit zitieren
- Florian Biehl (Autor:in), 2008, Paradigmen der Angstforschung. Lerntheoretische Ansätze, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/268313