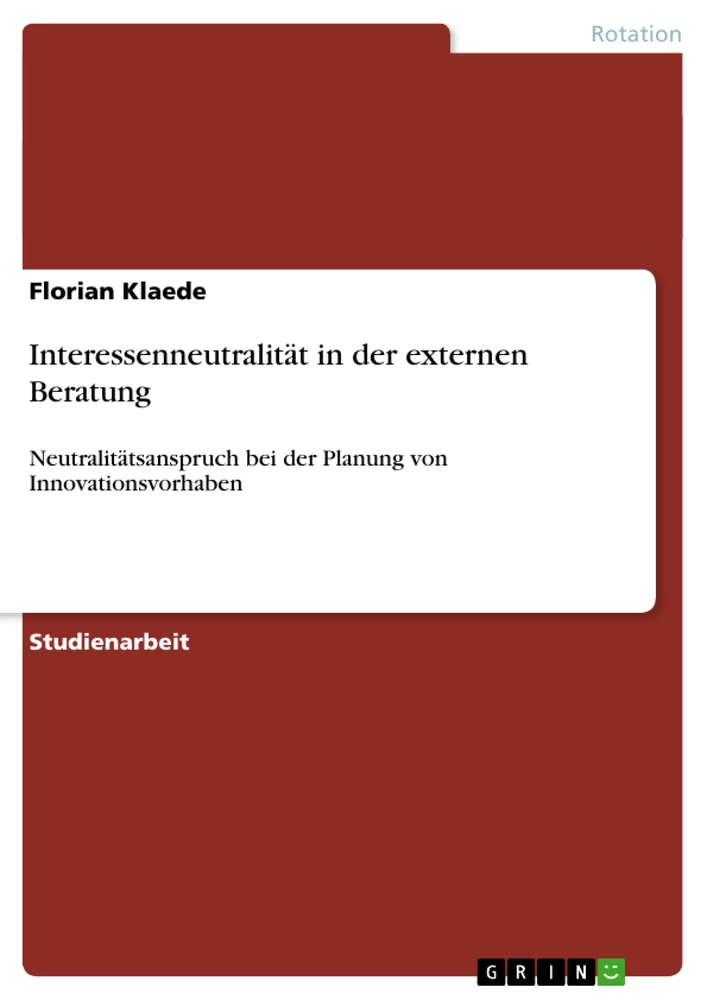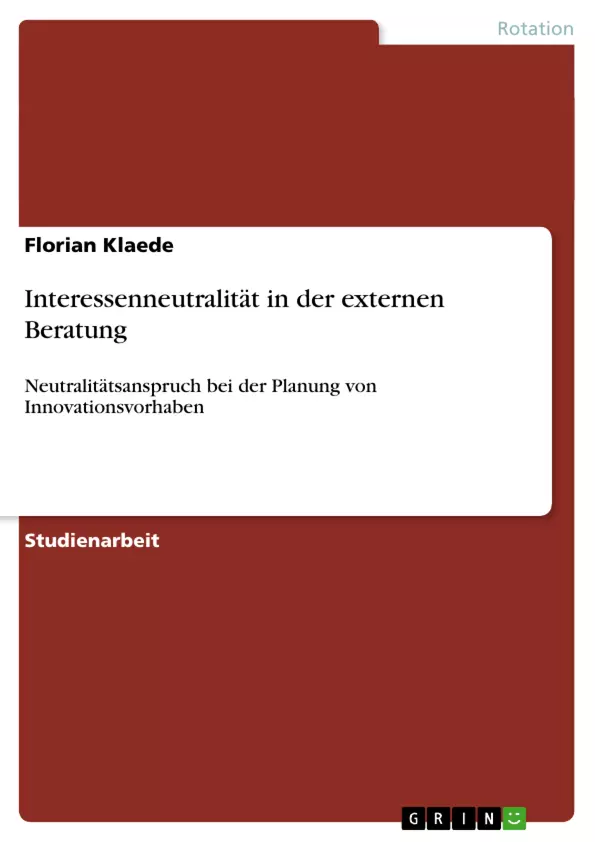Innovationsvorhaben können vielerlei gegenläufige persönliche Interessen von Stakeholdern tangieren.
Die Frage der Interessenneutralität eines externen Beraters könnte vor diesem Hintergrund ein entscheidender Faktor für den Erfolg der von ihm erbrachten Beratungsleistung sein.
In der vorliegenden Arbeit werden Aspekte der Interesseneutralität externer Beratung im Bezug darauf untersucht, welche Deutung der Begriff der Neutralität in der externen Beratung erfährt. Es sollen hierbei Probleme und Widersprüche aufgezeigt und betrachtet werden, in welcher Hinsicht deren Erkenntnis zu einem erweiterten Verständnis der Rolle des externen Beraters im Innovationsprozess beitragen kann.
Inhaltsverzeichnis
1. Ein kritischer Ansatz zum Problem der Interessenneutralität
2. Der Neutralitätsanspruch in der externen Beratung
3. Probleme des Neutralitätsanspruches - Neutralität als Dilemma des externen Beraters
3.1 Macht- und Interessenkonflikte der externen Beratung
3.2 Beraterfunktionen
4. Fazit: Interessenneutralität in Abhängigkeit von Beraterfunktionen
Quellenverzeichnis
1.Ein kritischer Ansatz zum Problem der Interessenneutralität
Innovationsvorhaben können vielerlei gegenläufige persönliche Interessen von Stakeholdern tangieren.
Die Frage der Interessenneutralität eines externen Beraters könnte vor diesem Hintergrund ein entscheidender Faktor für den Erfolg der von ihm erbrachten Beratungsleistung sein.
Ausgehend vom Gedanken Peter Atteslanders, den unüberbrückten Gegensatz von empirisch-analytischen und dialektisch-kritischen Ansätzen in der Sozialforschung als unfruchtbar zu betrachten[1], erschien es in Bezug auf die Schwierigkeit empirischer Erhebung von Interessenneutralität sinnvoll, Letzterem das Wort zu erteilen.
In der vorliegenden Arbeit werden Aspekte der Interesseneutralität externer Beratung im Bezug darauf untersucht, welche Deutung der Begriff der Neutralität in der externen Beratung erfährt. Es sollen hierbei Probleme und Widersprüche aufgezeigt und betrachtet werden, in welcher Hinsicht deren Erkenntnis zu einem erweiterten Verständnis der Rolle des externen Beraters im Innovationsprozess beitragen kann.
2.Der Neutralitätsanspruch in der externen Beratung
Nach Damkowski und Precht können vier Typen von Beratung unterschieden werden[2] :
1. durch Drittmittel geförderte Wissenschaftler oder Wissenschaftlergruppen
2. Beratungsinstitute, meist aus dem Wissenschaftsbereich
3. kleinere, oft Ein-Personen-Unternehmensberater
4. große Unternehmensberatungen.
Die Interessenneutraltität von durch Drittmittel geförderten Wissenschaftlern müsste gesondert diskutiert werden, dürfte aber einen selteneren Fall[3] darstellen. Das Augenmerk dieser Arbeit richtet sich daher auf die beauftragte Unternehmensberatung.
Die Berufsgrundsätze des Bundesverbandes Deutscher Unternehmensberater BDU e.V. fordern, dass die Beratung „unvoreingenommen und objektiv“ durchgeführt werden soll.[4]
Ähnliche Grundsätze enthält auch der Code of Ethics der Association of Management Consulting Firms (AMCF).[5]
Dies legt nahe, dass der Anspruch auf Interessenneutralität eine zentrale Rolle für das Selbstverständnis der Unternehmensberatung spielt.
3.Probleme des Neutralitätsanspruches- Neutralität als Dilemma des externen Beraters
3.1 Macht- und Interessenkonflikte der externen Beratung
Sofern der Berater nicht über Drittmittel finanziert oder unentgeltlich tätig ist, liegt es für ihn nahe, den Wünschen dessen, der über seine Beauftragung und Bezahlung entscheidet, zu entsprechen.
Nach Auffassung von Werner R. Müller et al. hat auch das Streben nach Sozialprestige Einfluss auf das Verhalten von externen Beratern.[6] Es entstehe eine Nähe zur Macht, da der Berater zum Intimus der Mächtigen werden könne, indem er gleiche Interessen und Ansichten entdecke und gegenseitige Identifikationsmöglichkeiten schaffe.[7] Je näher sich der Berater an den Mächtigen der Organisation platziere, desto größer würden seine Chancen eingeschätzt, Erfolge aufweisen zu können.[8]
Müller et al. weisen auch darauf hin, dass das Bild der Unvoreingenommenheit und Sachkompetenz des Beraters sich zur Durchsetzung spezifischer Interessen instrumentalisieren lasse.[9] Hieraus ergebe sich ein Dilemma des Beraters, da die persönliche Reputation eines Beraters nicht nur von seiner Fachkompetenz abhänge, sondern eben auch von seiner ihn selbst legitimierenden Unabhängigkeit und Neutralität.[10]
Wenn, wie bei Jürgen Nagel, hervorgehoben wird, die „objektive und neutrale Haltung“ gestatte „in Loyalität zum Auftraggeber die Entwicklung unkonventioneller und unorthodoxer Problemlösungen ohne Rücksicht auf gewachsene Besitzstände […] (insbesondere bei Aufträgen, die die Machtverteilung berühren)“[11], so kann zumindest kontrovers diskutiert werden, in wieweit die Nichtberücksichtigung vorhandener Partikularinteressen Merkmal einer Interessenneutralität sein kann.
Im Innovationsprozess innerhalb von Verwaltungen ist zu bedenken, dass Konflikte zwischen der Legitimation der Verwaltung selbst, die nicht Selbstzweck ist und der Legitimation vorhandener Besitzstände, die auch auf Rechtsnormen und Verträgen, sowie ethischen und sozialen Komponenten beruhen, bestehen können.
Letztere aufgrund einer Unterscheidung in „übergeordnete“ und „untergeordnete“ Interessen auszuklammern, könnte den Anspruch der Interessenneutralität erheblich in Frage stellen.
[...]
[1] Atteslander, Peter: Methoden der empirischen Sozialforschung, S. 8
[2] Vgl. Damkowski, Wulf/ Precht, Claus: Moderne Verwaltung in Deutschland- Public Management in der Praxis, 1998, S. 19 f.
[3] Vgl. Nagel, Jürgen: Die Implementierung von Verwaltungsmanagement-Reformen, 2009, S. 81
[4] Vgl. Bundesverband Deutscher Unternehmensberater BDU e.V .(Hrsg.): Berufsgrundsätze des Bundesverbandes Deutscher Unternehmensberater BDU e. V., online im Internet auf http://www.bdu.de/media/15144/berufsgrunds_tze_12_2010_endfassung.pdf [15.06.2013]
[5] Vgl. Association of Management Consulting Firms (AMCF): Code of Ethics, online im Internet http://amcf.org/index.php?option=com_content&view=article&id=14&Itemid=25 [15.06.2013]
[6] Vgl. Müller, Werner R. et al.: Organisationsberatung: Heimliche Bilder und ihre praktischen Konsequenzen, 2007, S. 134
[7] Ebd., S. 135
[8] Ebd.
[9] Ebd.
[10] Ebd., S. 141
[11] Nagel, Jürgen: Die Implementierung von Verwaltungsmanagement-Reformen, 2009, S. 82 f.
Häufig gestellte Fragen
Ist ein externer Berater wirklich interessenneutral?
Die Arbeit zeigt auf, dass Neutralität oft ein Dilemma ist, da Berater von der Bezahlung durch den Auftraggeber abhängig sind und dazu neigen, dessen Wünschen zu entsprechen.
Welche Rolle spielt Macht in der externen Beratung?
Berater suchen oft die Nähe zur Macht, um Erfolge vorweisen zu können, was ihre objektive und neutrale Haltung beeinflussen kann.
Was fordern die Berufsgrundsätze (z.B. BDU) von Beratern?
Sie fordern eine unvoreingenommene und objektive Durchführung der Beratung, was eine zentrale Säule des Selbstverständnisses der Branche ist.
Können Berater für spezifische Interessen instrumentalisiert werden?
Ja, das Bild der Unvoreingenommenheit und Sachkompetenz kann genutzt werden, um bereits feststehende Entscheidungen der Geschäftsführung zu legitimieren.
Welche Konflikte entstehen bei Innovationsprozessen in Verwaltungen?
Es entstehen Spannungen zwischen der notwendigen Reform und dem Schutz gewachsener Besitzstände, wobei der Berater zwischen diesen Interessen navigieren muss.
- Quote paper
- Florian Klaede (Author), 2013, Interessenneutralität in der externen Beratung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/268511