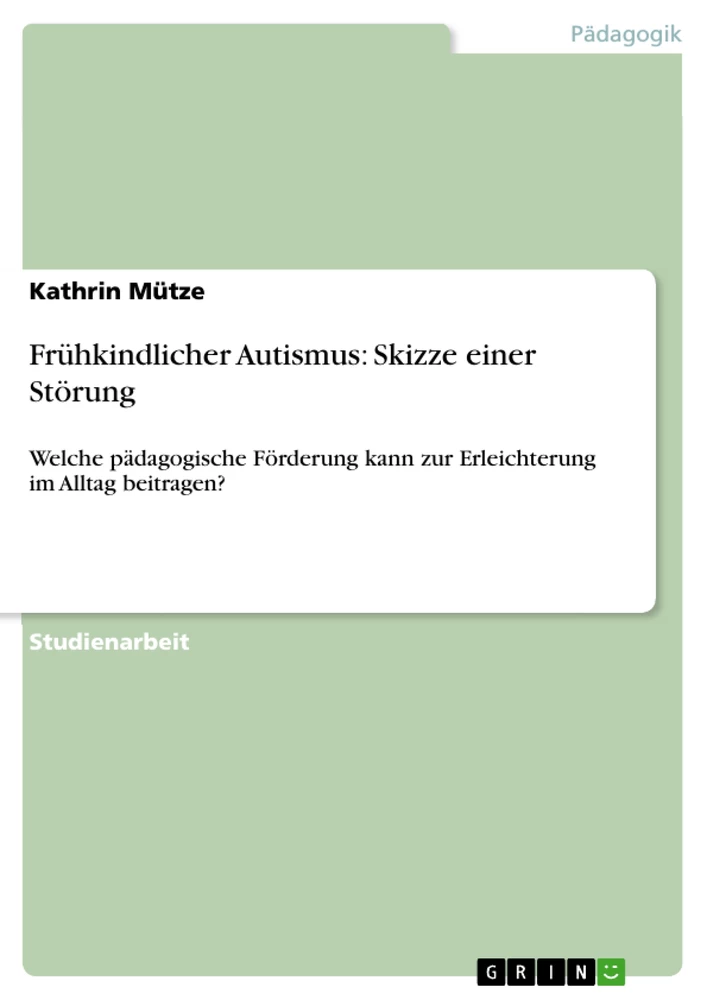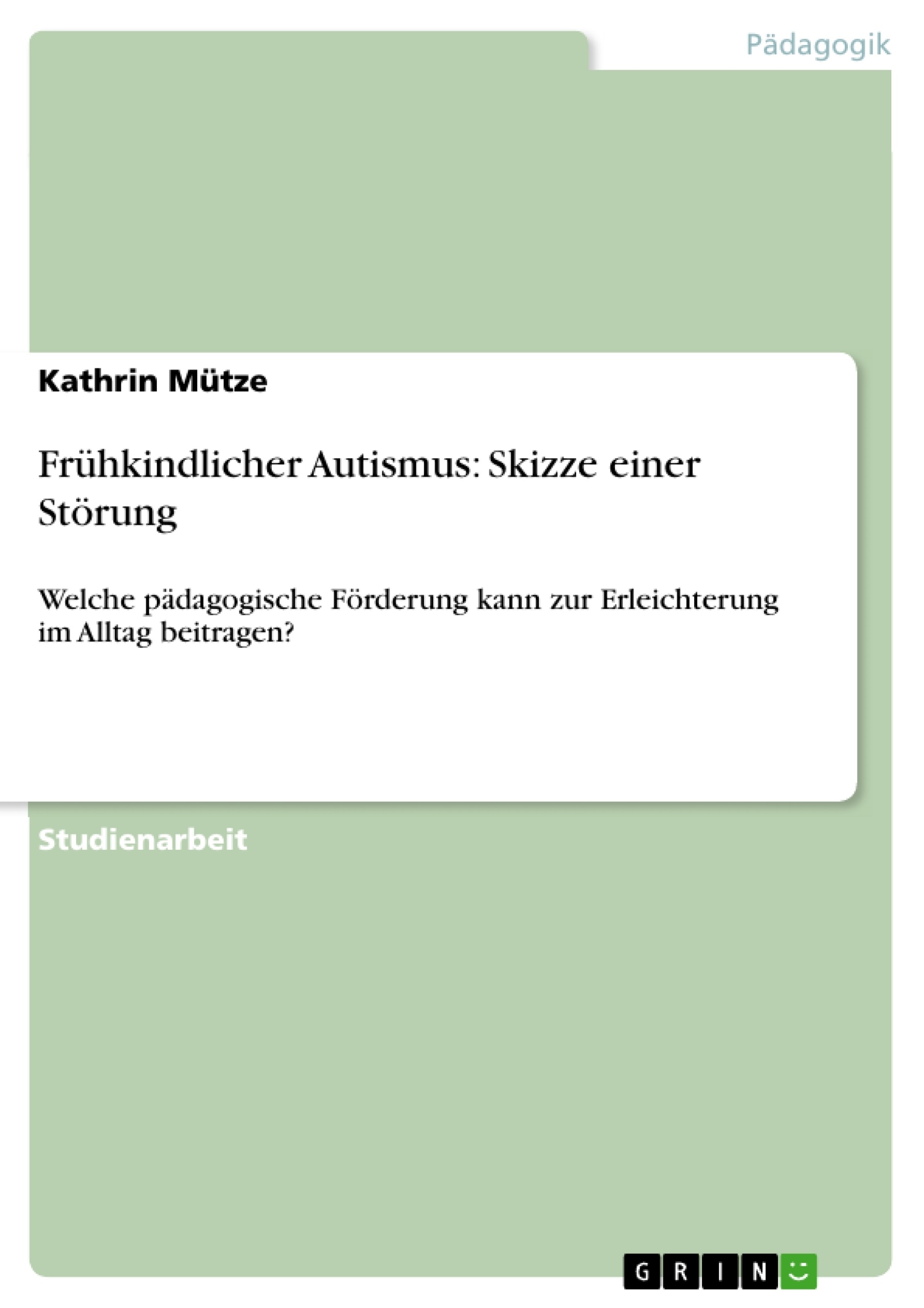Was ist das Andere, das Besondere an Kindern, bei denen „frühkindlicher Autismus“ diagnostiziert wurde? Haben sie überhaupt eine Chance in unserer Gesellschaft zu bestehen, sich zurechtzufinden? Diese und ähnlich Fragen haben mich schon lange im Zusammenhang mit dem Kanner-Syndrom beschäftigt.
Nicht nur das Kind, das eine Behinderung und im Falle meiner Arbeit eine Entwicklungsstörung hat, wird in der Gesellschaft kritischen Blicken ausgesetzt und gemieden – auch die Familie muss sich auf eine neue Lebensweise einstellen, sich auf häufig nicht ausbleibende Vorwürfe von außen gefasst machen, ihre Ressourcen koordinieren und nicht selten mit Selbstzweifeln und Erschöpfungsgefühlen kämpfen.
Welche pädagogische Förderung kann dem Kind mit frühkindlichem Autismus einerseits zu mehr Selbstständigkeit und Sicherheit verhelfen und somit andererseits für die Familie eine Unterstützung und Erleichterung im Alltag darstellen? Diese Frage möchte ich im Folgenden erörtern, indem Beeinträchtigungen und auffällige Verhaltensweisen, aber auch Fähigkeiten und Besonderheiten im Umgang und im Lernen bei Kindern mit Kanner-Syndrom skizziert werden, an denen eine pädagogische Förderung möglicherweise ansetzen kann. Bei diesen Darstellungen soll sowohl auf das Bild von frühkindlichem Autismus in der Gesellschaft, als auch auf die Problematiken und Chancen innerhalb der Familie eingegangen werden. Ziel dieser Arbeit soll sein, ein ausreichendes Bild über die Störung zu erhalten, anhand dessen sich die beiden vorgestellten Fördermethoden auf ihre Wirksamkeit zur Erleichterung im Alltag – für Kind und Eltern - beurteilen lassen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Frühkindlicher Autismus - Skizze einer Störung
- 2.1. Entdeckung des frühkindlichen Autismus durch Leo Kanner
- 2.2. Mögliche Ursachen
- 2.3. Äußeres Erscheinungsbild und das Unverständnis der Gesellschaft
- 2.4. Besonderheiten in der Sprachentwicklung
- 2.5. Stereotypien und Verhaltensauffälligkeiten
- 2.6. Affektive und kognitive Besonderheiten
- 3. Förderung von Menschen mit frühkindlichem Autismus
- 3.1. Gestützte Kommunikation (FC)
- 3.1.1. Methoden und Ziele
- 3.1.2. Auswirkungen auf die familiäre Situation
- 3.1.3. Kritik
- 3.2. Förderung nach dem TEACCH-Ansatz
- 3.2.1. Philosophie und Ziele
- 3.2.2. „Structured Teaching“ als TEACCH-Prinzip - theoretische Grundlagen
- 4. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit widmet sich der Erforschung des frühkindlichen Autismus, genauer gesagt der Skizzierung der Störung und der Frage, welche pädagogische Förderung zur Erleichterung im Alltag beitragen kann. Die Arbeit zielt darauf ab, ein tieferes Verständnis für die Herausforderungen von Kindern mit frühkindlichem Autismus und ihren Familien zu entwickeln.
- Entdeckung und mögliche Ursachen des frühkindlichen Autismus
- Äußeres Erscheinungsbild und das Unverständnis der Gesellschaft
- Besonderheiten in der Sprachentwicklung, Stereotypien und Verhaltensauffälligkeiten
- Zwei ausgewählte Fördermethoden: Gestützte Kommunikation (FC) und TEACCH-Ansatz
- Reflexion der Wirksamkeit der Fördermethoden zur Erleichterung im Alltag
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung befasst sich mit der Frage nach dem „Anderen“ an Kindern mit frühkindlichem Autismus und der besonderen Situation der Familien. Sie führt den Leser in das Thema ein und stellt die Forschungsfrage nach der pädagogischen Förderung im Alltag.
Kapitel 2, „Frühkindlicher Autismus - Skizze einer Störung“, beleuchtet die Entdeckung der Störung durch Leo Kanner und die möglichen Ursachen. Weiterhin wird das äußere Erscheinungsbild, die Eigenheiten in der Sprachentwicklung sowie die Stereotypien und Besonderheiten in der affektiven und kognitiven Entwicklung von Kindern mit Autismus betrachtet.
Kapitel 3, „Förderung von Menschen mit frühkindlichem Autismus“, stellt zwei spezielle Fördermethoden vor: die „Gestützte Kommunikation (FC)“ und den „TEACCH-Ansatz“ nach Eric Schopler.
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt das Thema „frühkindlicher Autismus“ und beleuchtet die Störung anhand ihrer Entdeckung durch Leo Kanner, den möglichen Ursachen, dem Erscheinungsbild, den Besonderheiten in der Sprachentwicklung sowie den Stereotypien und Verhaltensauffälligkeiten. Darüber hinaus werden zwei pädagogische Fördermethoden, die „Gestützte Kommunikation (FC)“ und der „TEACCH-Ansatz“, in Bezug auf ihre Wirksamkeit zur Erleichterung im Alltag von Kindern mit Autismus und ihren Familien untersucht.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Kanner-Syndrom?
Eine Form des frühkindlichen Autismus, die erstmals von Leo Kanner beschrieben wurde und durch tiefgreifende Entwicklungsstörungen gekennzeichnet ist.
Was ist der TEACCH-Ansatz?
Ein pädagogisches Konzept (Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped Children), das auf Strukturierung und Visualisierung setzt.
Wie funktioniert „Gestützte Kommunikation“ (FC)?
Eine Methode, bei der eine Hilfsperson die Hand oder den Arm des autistischen Menschen stützt, um das Tippen auf einer Tastatur zu ermöglichen.
Welche Herausforderungen haben Familien mit autistischen Kindern?
Familien kämpfen oft mit Erschöpfung, Selbstzweifeln und dem Unverständnis der Gesellschaft gegenüber den Verhaltensauffälligkeiten des Kindes.
Können autistische Kinder Selbstständigkeit erlernen?
Ja, durch gezielte pädagogische Förderung wie „Structured Teaching“ können Sicherheit und Alltagskompetenzen deutlich verbessert werden.
- Quote paper
- Master of Arts Kathrin Mütze (Author), 2009, Frühkindlicher Autismus: Skizze einer Störung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/268535