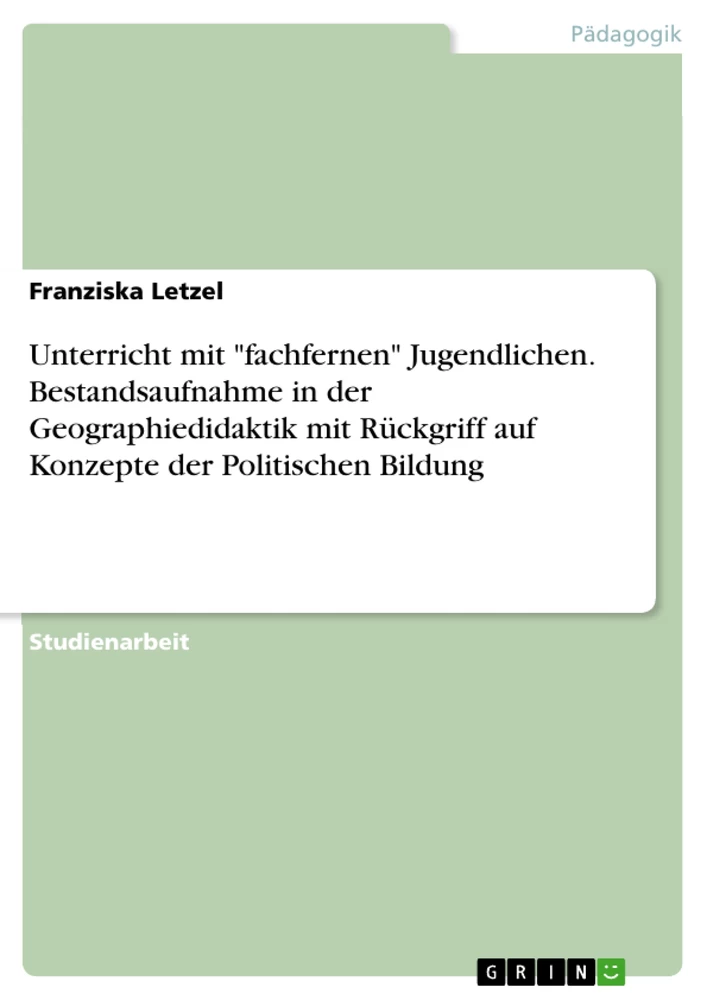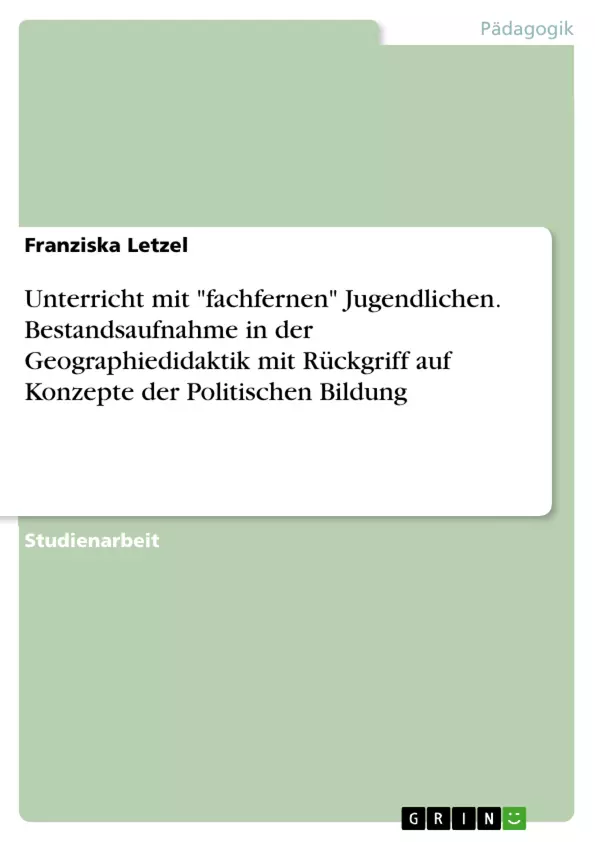Die vorliegende Arbeit stellt die Auswertung eines an der Universität durchgeführten Interviews mit einer abgeordneten Lehrerin zum Thema "Unterricht mit fachfernen Jugendlichen" dar. Dabei erfolgt die Anwendung des Konzepts "politikferner" Jugendlicher aus der Didaktik der politischen Bildung auf die Geographiedidaktik, in der ein solches Konzept noch nicht existiert.
Die Arbeit umfasst folgende Themengebiete: (1) eine ausführliche Auswertung des Interviews mit einer Darstellung der Interviewsituation und einer Zusammenfassung der zentralen Ergebnisse sowie (2) die Reflexion des durchgeführten Interviews und Schlussfolgerungen für den Lehr-/Lernkontext.
Rückblickend auf das durchgeführte Interview und die folgende Auseinandersetzung mit dem Interviewmaterial lassen sich folgende zwei zentrale Schlüsse ziehen:
(1)Es besteht in der Geographiedidaktik ein deutliches Defizit in der Beschäftigung mit der Problematik „fachferner“ Schüler.
(2)Viele Lehrkräfte haben vermutlich keine konkrete Vorstellung „fachferner“ Schüler. Die Beschäftigung mit dem „uninteressierten“ oder „unmotivierten“ Schüler steht im Vordergrund.
Inhaltsverzeichnis
1. Auswertung der Ergebnisse
1.1 Darstellung der Interviewsituation
1.2 Zusammenfassung des Interviews
2. Reflexion des Interviews
3. Transkription des Interviews
- Quote paper
- Franziska Letzel (Author), 2013, Unterricht mit "fachfernen" Jugendlichen. Bestandsaufnahme in der Geographiedidaktik mit Rückgriff auf Konzepte der Politischen Bildung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/268638