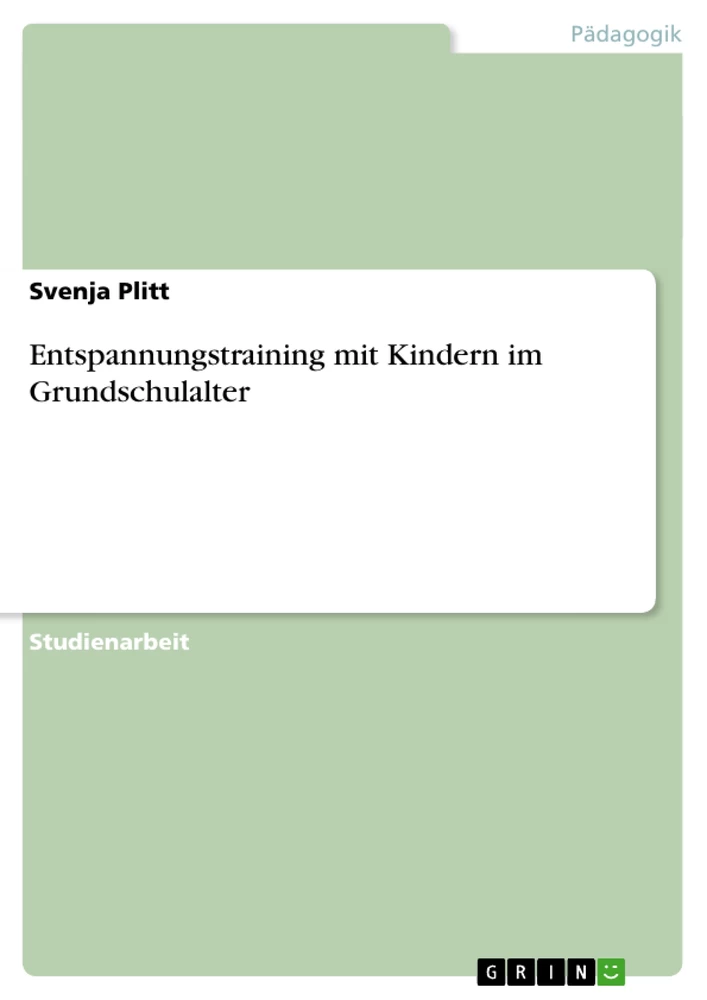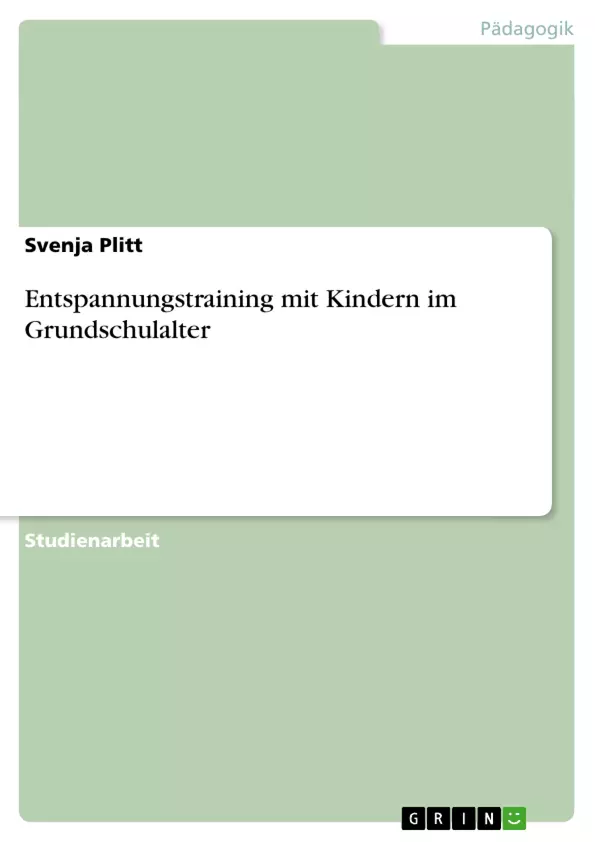Kinder sind heute einer Vielzahl von Reizen ausgesetzt, durch die ständige Berieselung der Kinder mit Werbespots, Fernsehfilmen, Videospielen etc , kann es zu einer regelrechten Reizüberflutung kommen. Ruhige, stille Momente, wie das Spielen im Wald oder das stundenlange Ausmalen eines Malbuches werden immer seltener. Hinzu kommt, dass die Freizeit der Kinder immer geringer wird: Oftmals hetzten die Kinder von Termin zu Termin, nach dem Sportverein kommt der Klavierunterricht, am nächsten Tag die AG in der Schule, dazwischen noch Hausaufgaben und am Wochenende das Vereinsspiel. Auch die gesellschaftlichen Anforderungen an die Kinder steigen, sie müssen sich immer früher in immer komplexeren Lebensräumen zurechtfinden und Orientierungsmöglichkeiten entdecken in einer Welt, in der die Zukunft immer offener wird. Neben der Aufklärung der, z.T. sehr ehrgeizigen Eltern, scheint es immer sinnvoller zu werden, den Kindern einen Gegenpol zu bieten, und sie die positiven Effekte der Entspannung kennen lernen zu lassen. Bei 2/3 der Kinder finden sich zu irgendeinem Zeitpunkt einfache Verhaltensstörungen wie Nägelkauen, Einschlafstörungen oder Schulschwierigkeiten. Diese sind die häufigste Indikationen zum Autogenen Training oder anderen Entspannungsverfahren.1 Bei Ihnen, aber auch bei gesunden Kindern, lassen sich Verbesserungen der Konzentration, ein leichteres Einschlafen, die Reduzierung von Angst und der Rückgang von stressbedingten Verhaltensweisen feststellen.
Es liegen diverse Studien vor, die die Wirksamkeit von Entspannungsverfahren in verschiedenen medizinischen Kontexten untersuchen z.B. beim Tourette-Syndrom, bei Asthma bronchiale oder in der pädiatrischen Onkologie. Das vorliegende Konzept richtet sich allerdings an gesunde Kinder und solche, mit leichten Stresserscheinungen. Es soll dem Kind in erster Linie Spaß bereiten und nicht zusätzlichen Stress. Die Kinder sollen in einer entspannten Atmosphäre lernen, loszulassen und sich zurückzuziehen. Das Training dient als Kompetenzvermittlung für den Alltag. Ziele sind z.B. die Steigerung von Kreativität und Phantasie, das Erlangen eines Zugangs zum positiven Erleben des Körpers, die Erweiterung von sinnlichen Fähigkeiten und die Schaffung eines Kontrapunktes zu stressreichen Anforderungen
des Alltags. 1 Hoffmann, Bernt: „Handbuch Autogenes Training“, S.401
Inhaltsverzeichnis
- Theoretische Grundlagen
- Anwendungsgebiete
- Kontraindikationen
- Besonderheiten bei der Entspannungsarbeit mit Kindern.
- Der Seminarraum
- Das Vorgespräch
- Das Seminarkonzept
- Die erste Stunde
- Die zweite Stunde
- Die dritte Stunde
- Die vierte Stunde
- Die fünfte Stunde
- Die sechste Stunde
- Die siebte Stunde
- Die letzte Stunde
- Anmerkungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Das vorliegende Seminar konzipiert ein Entspannungstraining für Kinder im Grundschulalter. Es zielt darauf ab, Kindern die positiven Effekte von Entspannungstechniken näherzubringen und ihnen so einen Gegenpol zu den zahlreichen Stressoren des modernen Alltags zu bieten. Das Konzept soll Kindern helfen, sich zu entspannen, den eigenen Körper besser wahrzunehmen und ihre Kreativität und Phantasie zu fördern.
- Anwendungsgebiete und Grenzen von Entspannungstechniken bei Kindern
- Spezifische Herausforderungen und Möglichkeiten in der Entspannungsarbeit mit Kindern
- Die Bedeutung eines geschützten und entspannten Seminarraums
- Die Rolle des Vorgesprächs und die Bedeutung einer vertrauensvollen Beziehung zwischen Trainer und Kind
- Die Integration von Bewegung und spielerischen Elementen in das Entspannungstraining
Zusammenfassung der Kapitel
Der erste Teil des Seminars befasst sich mit den theoretischen Grundlagen der Entspannungsarbeit mit Kindern. Hier werden Anwendungsgebiete, Kontraindikationen und besondere Aspekte der Arbeit mit dieser Altersgruppe erörtert. Das Kapitel beleuchtet auch die Bedeutung eines geeigneten Seminarraums und die Vorbereitungen, die für ein erfolgreiches Entspannungstraining notwendig sind.
Das zweite Kapitel widmet sich dem Vorgespräch, das eine wichtige Grundlage für eine vertrauensvolle Beziehung zwischen Trainer und Kind darstellt. Es werden wichtige Aspekte für die Kommunikation mit Kindern und Eltern im Vorfeld des Seminars erläutert.
Das dritte Kapitel stellt das Seminarkonzept selbst vor. Es umfasst eine detaillierte Beschreibung der einzelnen Stunden, die von der ersten bis zur letzten Stunde reichen. Jede Stunde wird mit ihren spezifischen Inhalten und Zielen vorgestellt.
Schlüsselwörter
Entspannungstraining, Kinder, Grundschulalter, Stress, Autogenes Training, Imaginationsverfahren, Kapitän Nemo, Spiel, Bewegung, Vorgespräch, Vertrauen, Seminarraum, Empathie, Wertschätzung, Selbstkongruenz, Reizüberflutung, Freizeit, gesellschaftliche Anforderungen, Verhaltensstörungen, Konzentration, Einschlafen, Angst, Stressbedingte Verhaltensweisen, Studien, Tourette-Syndrom, Asthma bronchiale, pädiatrische Onkologie, Kompetenzvermittlung, Kreativität, Phantasie, sinnliche Fähigkeiten, Kontrapunkt, Kontraindikationen, psychotische Formenkreis, Schizophrenie, Wahnvorstellungen, Angstzustände, Epilepsie, hyperkinetische Syndrome, Depressionen, Aggressionen.
Häufig gestellte Fragen
Warum brauchen Grundschulkinder heute Entspannungstraining?
Kinder sind heute oft einer Reizüberflutung durch Medien ausgesetzt und haben einen vollen Terminkalender, was zu Stresserscheinungen, Konzentrationsproblemen oder Schlafstörungen führen kann.
Welche Entspannungsverfahren sind für Kinder geeignet?
Besonders geeignet sind Autogenes Training, Progressive Muskelentspannung sowie Imaginationsverfahren (Fantasiereisen), die spielerisch und kindgerecht aufbereitet sind.
Gibt es Kontraindikationen für Entspannungstraining?
Ja, bei bestimmten psychotischen Erkrankungen (z.B. Schizophrenie), akuten Angstzuständen oder schweren Depressionen sollte Entspannungstraining nur nach ärztlicher Rücksprache erfolgen.
Was sind die Ziele des Seminars?
Ziele sind die Förderung der Körperwahrnehmung, die Steigerung von Kreativität und Phantasie sowie die Vermittlung von Kompetenzen zur Stressbewältigung im Alltag.
Wie sieht eine typische Stunde im Seminarkonzept aus?
Eine Stunde integriert oft Bewegung, spielerische Elemente und spezifische Entspannungsübungen, um den Kindern den Zugang ohne zusätzlichen Leistungsdruck zu ermöglichen.
Welche Rolle spielt das Vorgespräch?
Das Vorgespräch dient dem Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung zwischen Trainer, Kind und Eltern sowie der Abklärung von Erwartungen und möglichen Problemen.
- Citar trabajo
- Svenja Plitt (Autor), 2004, Entspannungstraining mit Kindern im Grundschulalter, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/26864