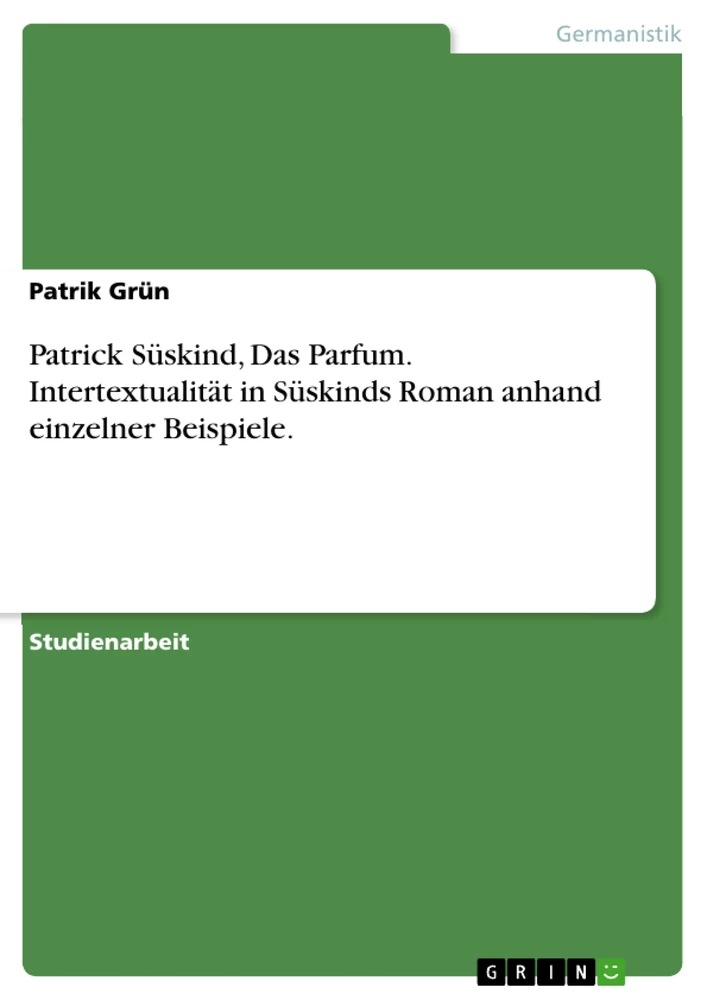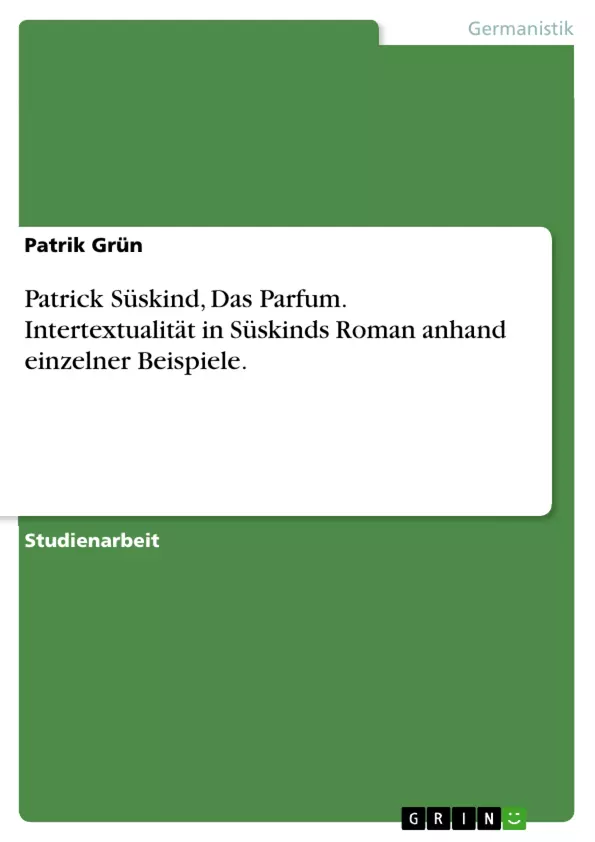Diese Arbeit zeigt einige intertextuellen Bezüge in Patrick Süskinds Roman "Das Parfum" und analysiert kritisch deren Wirkung für das Textverständnis.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung - Zum Roman „Das Parfum“
- II. Hauptteil – Intertextualität
- 1. Definition von Intertextualität im Zusammenhang mit Süskinds Roman; Kritische Bemerkungen zur Intertextualität
- 2. Ausführliche Darstellung intertextueller Bezüge anhand zweier Beispiele
- a) Der Romananfang (DP S. 5f.)
- b) Die „Schöpfungsszene“ (DP 160-163)
- 3. Jean-Baptiste Grenouille - ein Konglomerat intertextueller Verweise
- III. Zusammenfassung der Ergebnisse, Ergänzungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Intertextualität in Patrick Süskinds Roman „Das Parfum“. Ziel ist es, die Art und Weise aufzuzeigen, wie Süskind literarische Vorlagen in seine Erzählung einbaut und welche Wirkung er damit erzielt. Die Analyse konzentriert sich auf die Identifizierung und Interpretation dieser intertextuellen Bezüge und deren Beitrag zum Gesamtverständnis des Romans.
- Definition und kritische Auseinandersetzung mit dem Konzept der Intertextualität
- Analyse spezifischer intertextueller Bezüge in „Das Parfum“
- Die Rolle von Jean-Baptiste Grenouille als Manifestation intertextueller Verweise
- Die Wirkung der Intertextualität auf die Rezeption des Romans
- Süskinds Schreibstil und seine bewusste Gestaltung der Intertextualität
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung - Zum Roman „Das Parfum“: Die Einleitung stellt Patrick Süskinds Roman „Das Parfum“ als eines der populärsten Werke der neueren deutschen Literatur vor und gibt einen kurzen Überblick über die Handlung. Sie beschreibt den Protagonisten Jean-Baptiste Grenouille, seine außergewöhnlichen Fähigkeiten und sein Streben nach dem perfekten Parfum, das ihn zur Macht verhelfen soll. Die Einleitung hebt hervor, dass Süskind in seinem Roman zahlreiche intertextuelle Bezüge verarbeitet und eine gelungene Mischung aus massentauglichem Roman und literarisch anspruchsvoller Erzählung schafft. Der Fokus liegt auf der Ankündigung der folgenden Analyse der Intertextualität im Roman.
II. Hauptteil – Intertextualität: Dieser Kapitelteil analysiert die umfangreiche Intertextualität in „Das Parfum“. Es beginnt mit einer Definition von Intertextualität nach Genette und Buß, betont die Notwendigkeit, diese Bezüge nachzuweisen und ihre Funktion im Text zu belegen, und diskutiert kritische Positionen dazu, insbesondere von Umberto Eco. Der Hauptteil untersucht die spezifischen intertextuellen Bezüge anhand ausgewählter Beispiele aus dem Roman, und beleuchtet, wie Süskind durch Umformulierungen und Anpassungen die Quellen in seine Erzählung integriert, ohne die Klarheit und Übersichtlichkeit zu beeinträchtigen. Er zeigt wie diese subtilen Verweise die Sinntiefe des Romans erhöhen und ihn für ein breiteres Publikum attraktiv machen.
Schlüsselwörter
Patrick Süskind, Das Parfum, Intertextualität, Literaturwissenschaft, Romananalyse, Jean-Baptiste Grenouille, Geruch, Parfum, Motiv, Anleihen, Literaturgeschichte, Gérard Genette, Umberto Eco, Angelika Buß.
Häufig gestellte Fragen zu: Analyse der Intertextualität in Patrick Süskinds "Das Parfum"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Intertextualität in Patrick Süskinds Roman "Das Parfum". Sie untersucht, wie Süskind literarische Vorlagen in seine Erzählung einbaut und welche Wirkung er damit erzielt. Der Fokus liegt auf der Identifizierung und Interpretation intertextueller Bezüge und deren Beitrag zum Gesamtverständnis des Romans.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Definition und kritische Auseinandersetzung mit dem Konzept der Intertextualität; Analyse spezifischer intertextueller Bezüge in "Das Parfum"; die Rolle von Jean-Baptiste Grenouille als Manifestation intertextueller Verweise; die Wirkung der Intertextualität auf die Rezeption des Romans; und Süskinds Schreibstil und seine bewusste Gestaltung der Intertextualität.
Welche Methode wird angewendet?
Die Arbeit identifiziert und interpretiert intertextuelle Bezüge in "Das Parfum". Sie analysiert, wie Süskind Quellen in seine Erzählung integriert und welche Wirkung diese subtilen Verweise auf die Sinntiefe und die Rezeption des Romans haben. Dabei werden Definitionen von Intertextualität nach Genette und Buß herangezogen und kritische Positionen, insbesondere von Umberto Eco, diskutiert.
Welche Beispiele werden analysiert?
Die Analyse konzentriert sich auf zwei konkrete Beispiele: den Romananfang (S. 5f.) und die "Schöpfungsszene" (S. 160-163). Diese Beispiele dienen der ausführlichen Darstellung der intertextuellen Bezüge und ihrer Funktion im Roman.
Welche Rolle spielt Jean-Baptiste Grenouille?
Jean-Baptiste Grenouille wird als ein "Konglomerat intertextueller Verweise" betrachtet. Seine Figur und sein Handeln werden im Kontext der analysierten intertextuellen Bezüge interpretiert.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Relevante Schlüsselwörter sind: Patrick Süskind, Das Parfum, Intertextualität, Literaturwissenschaft, Romananalyse, Jean-Baptiste Grenouille, Geruch, Parfum, Motiv, Anleihen, Literaturgeschichte, Gérard Genette, Umberto Eco, Angelika Buß.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in drei Kapitel: Eine Einleitung, die den Roman "Das Parfum" und die Thematik der Intertextualität einführt; einen Hauptteil, der die Intertextualität im Detail analysiert; und eine Zusammenfassung der Ergebnisse und Ergänzungen.
Welche Autoren werden zitiert?
Die Arbeit bezieht sich auf die Theorien von Gérard Genette, Umberto Eco und Angelika Buß im Kontext der Intertextualität.
- Quote paper
- Patrik Grün (Author), 2008, Patrick Süskind, Das Parfum. Intertextualität in Süskinds Roman anhand einzelner Beispiele., Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/268686