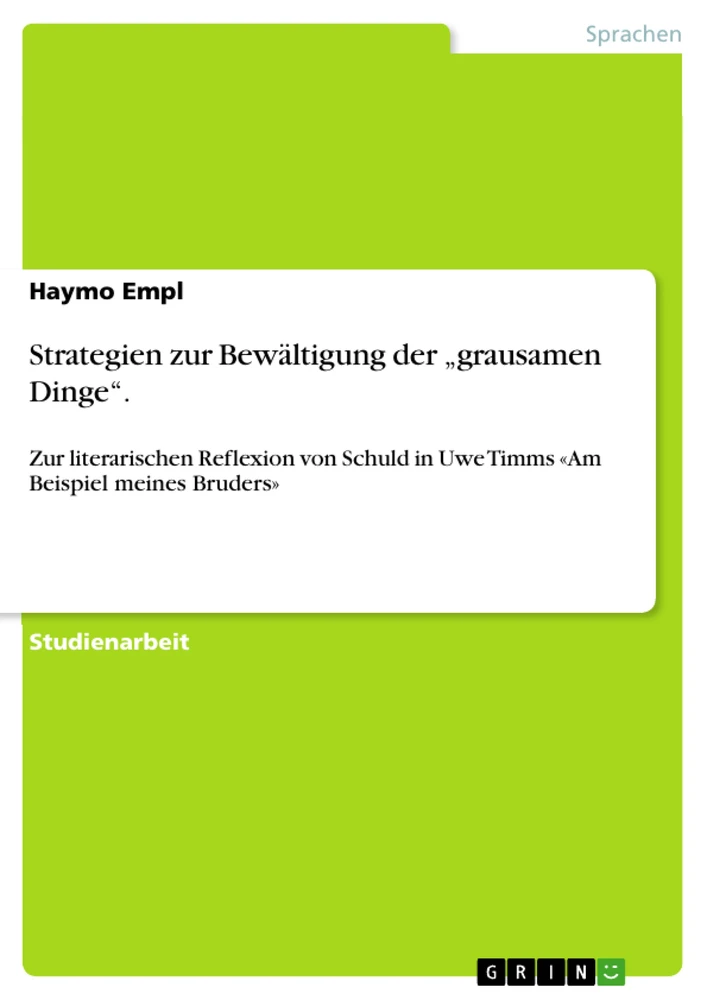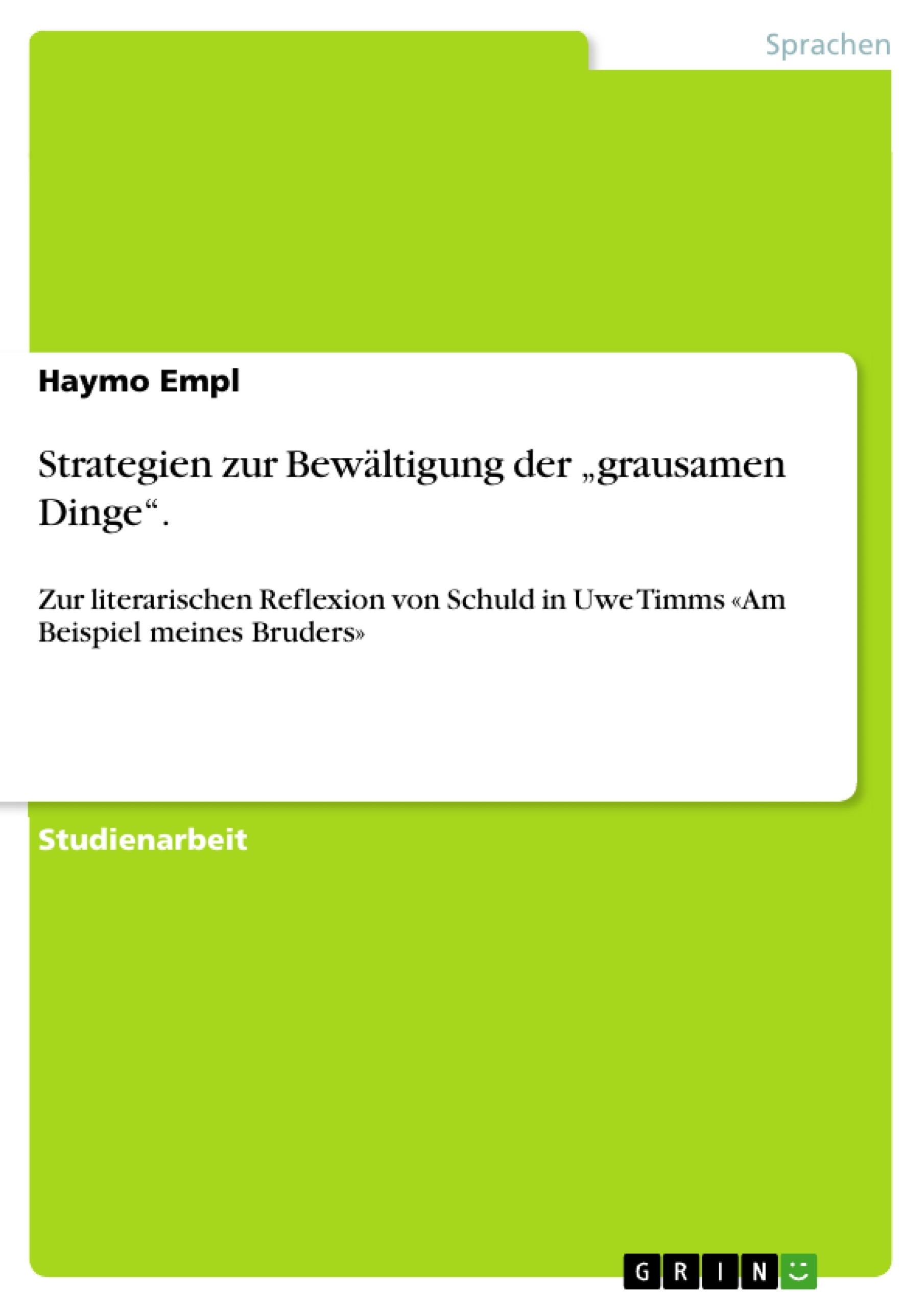Mit seiner reportageartigen Erzählung «Am Beispiel meines Bruders» hat Uwe Timm einen autobiografischen Text vorgelegt. Damit wurde wohl die die Diskussion über die deutsche Erinnerungskultur und die Verbrechen des Nationalsozialismus neu und auf differenzierte Weise angefacht.
Die Arbeit widmet sich dem Zusammenhang von Schuld, Schuldgefühl und Schuldbewältigung und damit dem Thema der Vergangenheitsbewältigung für die Zeit des Nationalsozialismus. Ebenso wird der moralische Begriff der „Schuld“ bzw. die moralisch relevante „Frage der Schuld“ problematisiert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Im Konflikt der Generationen. Dimensionen des Schuldbegriffs zwischen Individual- und Kollektiv-Schuld
- Unschuldig schuldig? Aspekte des juristischen und des ethischen Begriffs der Zurechnung
- Zur Normalität von „Schuld" in Timms Am Beispiel meines Bruders
- Von der Schuld zur Opferrolle. Zur Selbstlegitimation der Generation der Täter
- Die Schuld des Verschweigens und der sprachlichen „Verrohung“
- Die Schuld kleinmalen oder die Gefahr der Alltäglichkeit
- Die Generation der Täter. Zur Thematisierung der Schuldfrage am Beispiel der Hauptfiguren (Bruder, Vater)
- Eine Frage des Gewissens: Die Wahrheit über den Bruder
- Schuld als Nichtwissen? Die mögliche Zurechenbarkeit des Bruders
- Dem „Festgeschriebenen nachgehen“ oder „Reduktion auf Haltung“ …
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die literarische Reflexion von Schuld in Uwe Timms „Am Beispiel meines Bruders“. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie die Auseinandersetzung mit der individuellen und kollektiven Schuld im Kontext der NS-Vergangenheit im Werk Timms dargestellt wird. Die Arbeit analysiert dabei die erzählerischen Strategien, die Timm zur Bewältigung der „grausamen Dinge“ einsetzt.
- Die Relevanz des Schuldbegriffs in der deutschen Nachkriegsliteratur
- Die Konfrontation mit der Familiengeschichte und der NS-Vergangenheit
- Die Darstellung der unterschiedlichen Schuldgefühle und -bewältigungsstrategien innerhalb der Familie
- Die Bedeutung des Schweigens und der Sprachlosigkeit im Umgang mit Schuld
- Die Möglichkeiten und Grenzen der transgenerationalen Übertragung von Schuld und Verantwortung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der literarischen Reflexion von Schuld ein und stellt Timms „Am Beispiel meines Bruders“ als Beispiel für eine Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit im Kontext der Familiengeschichte vor. Das zweite Kapitel analysiert die Dimensionen des Schuldbegriffs und beleuchtet die unterschiedlichen Perspektiven auf Schuld, die in Timms Erzählung zur Sprache kommen. Hier werden auch die Aspekte der Zurechnung im Kontext der NS-Verbrechen diskutiert. Das dritte Kapitel konzentriert sich auf die Generation der Täter und untersucht die Schuldfrage am Beispiel der Hauptfiguren, dem Bruder und dem Vater. Es beleuchtet die verschiedenen Perspektiven auf die Schuldfrage, die innerhalb der Familie existieren und die unterschiedlichen Arten des Umgangs mit Schuld.
Schlüsselwörter
Schuld, Schuldgefühl, Schuldbewältigung, NS-Vergangenheit, Familiengeschichte, Generationenkonflikt, autobiographische Erzählung, literarische Reflexion, Erinnerungskultur, Schweigen, Sprachlosigkeit, Zurechnung, individuelle Verantwortung, kollektive Schuld, transgenerationale Übertragung.
Häufig gestellte Fragen zu Uwe Timms 'Am Beispiel meines Bruders'
Worum geht es in Uwe Timms autobiografischer Erzählung?
Timm setzt sich mit der Geschichte seines älteren Bruders auseinander, der Mitglied der SS-Division 'Totenkopf' war und im Zweiten Weltkrieg fiel, sowie mit der Schuld und dem Schweigen seiner Familie.
Was thematisiert das Werk hinsichtlich der deutschen Erinnerungskultur?
Es beleuchtet den Generationenkonflikt und die Schwierigkeit, die Taten der Angehörigen während der NS-Zeit mit dem Bild des geliebten Familienmitglieds in Einklang zu bringen.
Welche Rolle spielt das Schweigen in der Familie?
Das Verschweigen der grausamen Details der Vergangenheit wird als eine Form der Schuld dargestellt, die eine ehrliche Auseinandersetzung über Generationen hinweg verhindert.
Was ist der Unterschied zwischen juristischer und ethischer Schuld?
Während juristische Schuld nachweisbare Taten betrifft, befasst sich die ethische Schuld mit der moralischen Verantwortung und dem Gewissen des Einzelnen im System.
Wie wird die 'Opferrolle' der Tätergeneration kritisiert?
Timm analysiert, wie sich die Generation der Täter oft selbst als Opfer der Umstände oder Befehle darstellte, um sich der individuellen Verantwortung für die NS-Verbrechen zu entziehen.
- Quote paper
- Haymo Empl (Author), 2014, Strategien zur Bewältigung der „grausamen Dinge“., Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/268705