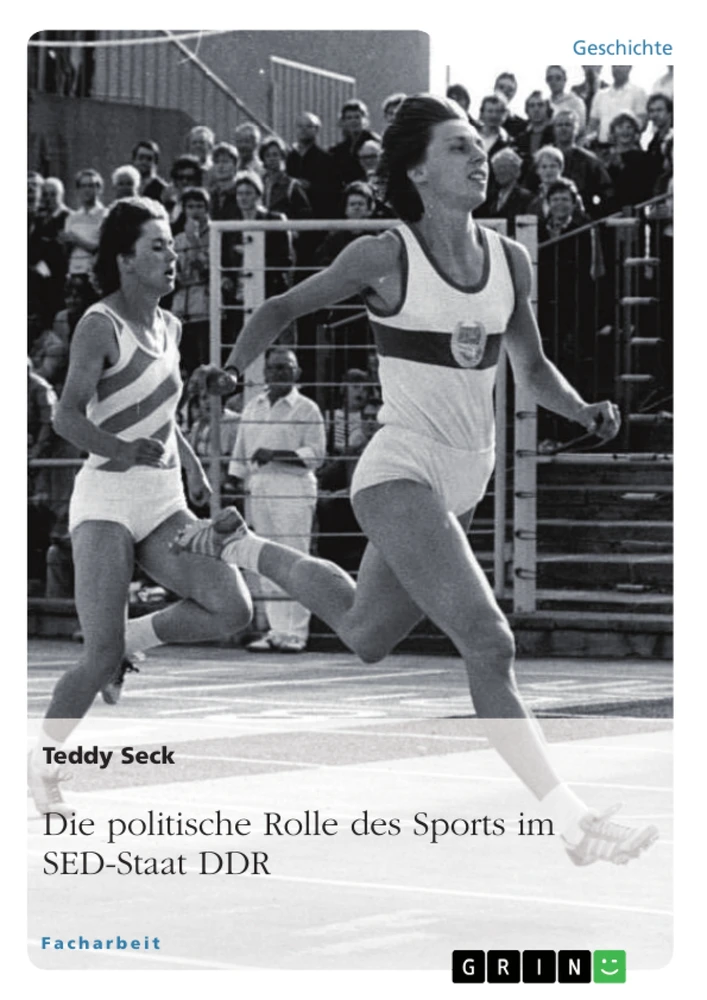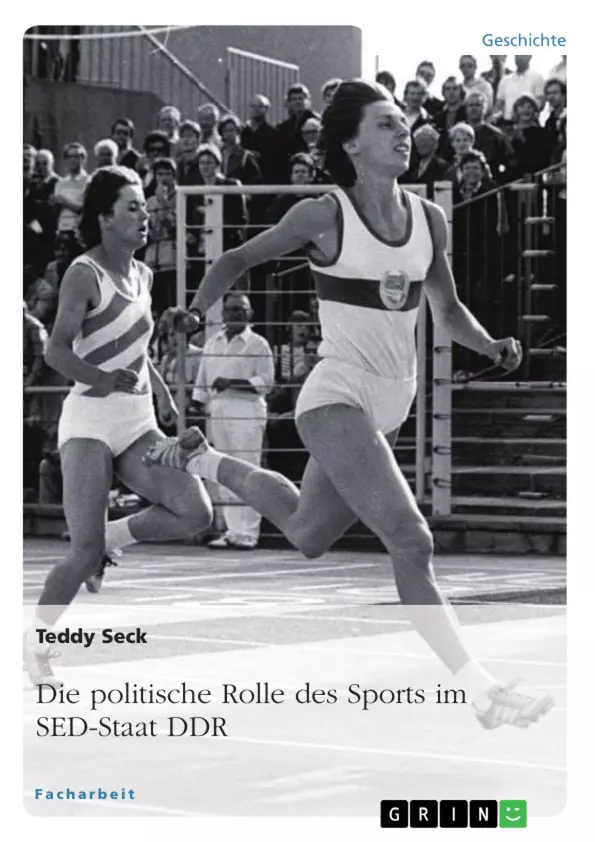„Für Sport wurde in der DDR immer viel getan, mehr als in der BRD“, das habe ich von meinen Verwandten oft gehört. Die gesamte Familie meiner Mutter lebt in der ehemaligen DDR und viele sind noch in der DDR zur Schule gegangen oder haben dort studiert. Deswegen haben sich bei gegenseitigen Besuchen Gespräche oft auf die Lebens- und Arbeitsbedingungen in der DDR bezogen. Über das Thema „Sport“ bekam ich einen leichteren Einstieg in das schwierige Thema des anderen „sozialistischen“ Deutschlands, da aktiver Sport zu meinen Hauptinteressen gehört.
In den letzten fünf Jahren gab es auffallend viele Medienberichte über den Leistungssport in der DDR und über die Aufbereitung der allmählich bekannt gewordenen Dopingskandale. Im „Zeitgeschichtlichen Forum Leipzig“ hat die „Stiftung Haus der Geschichte“ am 25.11.2009 eine interessante Ausstellung zum Thema Sport im geteilten Deutschland unter dem Titel: „Wir gegen uns“ eröffnet. Im Zusammenhang mit dieser eindrucksvoll gestalteten Auseinandersetzung mit der 40-jährigen DDR-Sportgeschichte wurde im Deutschlandfunk am 26.01.2010 eine brisante Diskussion zwischen Opfern und Tätern (Medizinern und Trainern) zum Thema „Doping in der DDR“ übertragen. In dieser Podiumsdiskussion kam auch ein Sportler - selbst Dopingopfer – zu Wort, der vor allem darauf hinwies, dass die meisten einstigen Täter und Mitwisser des DDR-Dopings ihre Taten bis heute nicht eingestanden hätten, auch seien sie kaum zur Verantwortung gezogen worden. Demnach wurden viele der Höchstleistungen von DDR Spitzensportlern nur über ein staatlich verordnetes „Leistungsdoping“ erreicht.
Bei einem zweiten Besuch in Leipzig, im Oktober 2011, hatte ich die Chance, im Zeitgeschichtlichen Forum und im ehemaligen Sportmedizinischen Institut auf dem Gelände des Sportforums Leipzig selbst Gespräche mit Zeitzeugen zu führen, die mir helfen könnten, die Frage zu beantworten, weshalb das SED-Regime in der DDR mit Sport Politik machen wollte – und das mit allen Mitteln. Diese andere Seite der Medaille hat mich stutzig gemacht und dazu veranlasst, diesen Widerspruch zu unter-suchen, auch unter dem Aspekt, welche Rolle der Breitensport dabei spielte.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Hauptteil
- Gesellschaftliche Bedingungen für Breitensport und Spitzensport in der DDR
- Konkurrenz zum andern System - Leistungssteigerung durch Doping
- KJS – der Preis für Medaillen
- Wettkämpfe in der DDR
- Die Kinder- und Jugendspartakiaden
- Weitere Leistungsvergleiche
- Mannschaftssport in der DDR – am Beispiel Fußball
- Bindung ans Sportkollektiv - zwischen VEB und Wohngebiet
- Interviews mit ehemaligen DDR-Bürgern zu ihren Sporterfahrungen
- Fazit: Was bleibt von der SED-Sportpolitik?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die politische Rolle des Sports im SED-Staat DDR. Die Zielsetzung ist es, die Motivation des SED-Regimes zu analysieren, Sport als politisches Instrument einzusetzen, und dabei die Rolle von Breitensport und Spitzensport zu beleuchten. Die Arbeit analysiert, wie der Sport zur Durchsetzung ideologischer Ziele und zur Darstellung der Überlegenheit des sozialistischen Systems genutzt wurde.
- Die gesellschaftlichen Bedingungen für Breitensport und Spitzensport in der DDR
- Der Einsatz von Doping als Mittel zur Leistungssteigerung im Spitzensport
- Die Rolle der Kinder- und Jugendsportschulen (KJS) in der Ausbildung von Spitzensportlern
- Die Bedeutung von Wettkämpfen und Leistungsvergleichen im Kontext der politischen Propaganda
- Die Verbindung von Sport und Kollektiv im Alltag der DDR-Bürger
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Arbeit beginnt mit persönlichen Anekdoten des Autors, die sein Interesse an der Thematik wecken. Es wird auf Medienberichte über Doping in der DDR und eine Ausstellung im Zeitgeschichtlichen Forum Leipzig verwiesen, welche die Grundlage für die Untersuchung bilden. Der Fokus liegt auf dem Widerspruch zwischen der offiziellen Förderung des Breitensportes und der tatsächlichen Fokussierung auf den Spitzensport.
Gesellschaftliche Bedingungen für Breitensport und Spitzensport in der DDR: Dieses Kapitel beschreibt die ideologischen Grundlagen der SED-Sportpolitik, die auf den „Zehn Geboten für den neuen sozialistischen Menschen“ basierten. Obwohl die Verfassung die Förderung von Breitensport betont, zeigt sich in der Realität eine starke Diskrepanz: Spitzensport wurde massiv gefördert, während der Breitensport vernachlässigt wurde. Die DDR-Spitzensportler wurden als Vorbilder für die sozialistische Gesellschaft präsentiert, während der Breitensport vor allem der Talentsichtung diente und die Bindung an das Kollektiv fördern sollte.
Konkurrenz zum andern System – Leistungssteigerung durch Doping: Dieses Kapitel beleuchtet das systematische Doping im DDR-Spitzensport. Es werden Interviews und Berichte zitiert, die das Ausmaß der staatlich verordneten Leistungssteigerung aufzeigen. Die gesundheitlichen Folgen für die Athleten, die oft unter Druck gesetzt wurden, werden ebenso thematisiert wie die mangelnde Rechenschaftspflicht der Verantwortlichen. Die Motivation der Athleten wurde durch die Aussicht auf Auslandsreisen und materielle Vorteile gesteigert.
KJS – der Preis für Medaillen: Der Fokus liegt hier auf den Kinder- und Jugendsportschulen (KJS). Das Kapitel beschreibt deren Entwicklung von volkstümlichen Einrichtungen zu hochspezialisierten Eliteschulen, in denen der sportliche Erfolg über schulische Leistungen gestellt wurde. Die hohen finanziellen Aufwendungen der DDR für die KJS und der immense Druck auf die jungen Athleten, oft unter Einsatz von Dopingmitteln, werden herausgestellt. Die gesundheitlichen Langzeitfolgen und das fehlende Wissen der Kinder über die verabreichten Substanzen werden als problematisch dargestellt.
Wettkämpfe in der DDR: Dieses Kapitel beschreibt verschiedene Wettkampfformen in der DDR, von den Kinder- und Jugendspartakiaden bis hin zu kleineren, schulischen Leistungsvergleichen. Die Spartakiade wird als ein wichtiges Element der politischen Propaganda dargestellt, welches die sportliche Überlegenheit der DDR demonstrieren sollte. Die Leistungsvergleiche dienten der frühzeitigen Identifizierung und Förderung von Talenten für den Spitzensport.
Mannschaftssport in der DDR – am Beispiel Fußball: Dieses Kapitel analysiert das deutsch-deutsche Fußballspiel von 1974 im Kontext des Kalten Krieges. Es wird auf die unterschiedlichen Medienberichterstattungen in Ost und West eingegangen und der unerwartete Sieg der DDR-Mannschaft analysiert. Der Sieg wird als Ausnahmefall betrachtet, der durch die spezielle Situation und weniger durch die systematische Überlegenheit der DDR bedingt war.
Bindung ans Sportkollektiv – zwischen VEB und Wohngebiet: Dieses Kapitel untersucht die Rolle des Sports in der Freizeitgestaltung der DDR-Bürger. Es werden die Bemühungen der SED dargestellt, den Sport zur Stärkung des Kollektivs und zur Bindung der Bevölkerung an das System zu nutzen. Die Organisation von Sportveranstaltungen durch Betriebe und Wohngebiete wird beschrieben, aber auch die oft große Diskrepanz zwischen staatlichen Planungen und der tatsächlichen Beteiligung der Bevölkerung.
Interviews mit ehemaligen DDR-Bürgern zu ihren Sporterfahrungen: Dieses Kapitel präsentiert Interviews mit ehemaligen DDR-Bürgern, die ihre persönlichen Erfahrungen mit dem Sport in der DDR schildern. Die Interviewaussagen spiegeln unterschiedliche Perspektiven wider: einige Betroffene betonen die Professionalität und die besonderen Anreize im Spitzensport, während andere die gesundheitlichen Risiken und den Druck durch den staatlich gesteuerten Sport betonen. Die Interviews bestätigen die Ergebnisse der Untersuchung und liefern zusätzliche Einblicke in die verschiedenen Facetten der DDR-Sportpolitik.
Schlüsselwörter
SED-Sportpolitik, DDR, Breitensport, Spitzensport, Doping, Kinder- und Jugendsportschulen (KJS), Spartakiade, Wettkämpfe, Kollektiv, politische Propaganda, Mannschaftssport, Fußball, Wiedervereinigung, Interviews, Zeitzeugen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: SED-Sportpolitik in der DDR
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die politische Rolle des Sports im SED-Staat DDR. Sie analysiert die Motivation des SED-Regimes, Sport als politisches Instrument einzusetzen, und beleuchtet dabei die Rolle von Breitensport und Spitzensport. Ein Schwerpunkt liegt auf der Nutzung des Sports zur Durchsetzung ideologischer Ziele und zur Darstellung der Überlegenheit des sozialistischen Systems.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die gesellschaftlichen Bedingungen für Breitensport und Spitzensport, den systematischen Einsatz von Doping zur Leistungssteigerung, die Rolle der Kinder- und Jugendsportschulen (KJS), die Bedeutung von Wettkämpfen und Leistungsvergleichen (wie den Spartakiden) im Kontext der politischen Propaganda, die Verbindung von Sport und Kollektiv im Alltag der DDR-Bürger, und den Mannschaftssport am Beispiel Fußball. Interviews mit ehemaligen DDR-Bürgern liefern zusätzliche Einblicke.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Arbeit basiert auf Medienberichten über Doping in der DDR, einer Ausstellung im Zeitgeschichtlichen Forum Leipzig und persönlichen Anekdoten des Autors. Ein wichtiger Bestandteil sind Interviews mit ehemaligen DDR-Bürgern, die ihre persönlichen Erfahrungen mit dem Sport schildern.
Wie wird der Breitensport in der DDR dargestellt?
Obwohl die Verfassung die Förderung des Breitensportes betonte, zeigt die Arbeit eine starke Diskrepanz zur Realität. Der Breitensport wurde im Vergleich zum Spitzensport vernachlässigt und diente vor allem der Talentsichtung und der Förderung der Bindung an das Kollektiv.
Welche Rolle spielte Doping im DDR-Spitzensport?
Die Arbeit beleuchtet das systematische Doping im DDR-Spitzensport als Mittel zur Leistungssteigerung. Interviews und Berichte zeigen das Ausmaß der staatlich verordneten Maßnahmen und deren gesundheitliche Folgen für die Athleten auf. Die Motivation der Athleten wurde durch Auslandsreisen und materielle Vorteile gesteigert.
Welche Bedeutung hatten die Kinder- und Jugendsportschulen (KJS)?
Die KJS werden als hochspezialisierte Eliteschulen beschrieben, in denen der sportliche Erfolg über schulische Leistungen gestellt wurde. Die hohen finanziellen Aufwendungen und der immense Druck auf die jungen Athleten, oft unter Einsatz von Dopingmitteln, werden kritisch dargestellt.
Welche Rolle spielten Wettkämpfe in der DDR?
Wettkämpfe, insbesondere die Spartakiade, dienten der politischen Propaganda und sollten die sportliche Überlegenheit der DDR demonstrieren. Weitere Leistungsvergleiche dienten der frühzeitigen Identifizierung und Förderung von Talenten für den Spitzensport.
Wie wird der Mannschaftssport dargestellt?
Am Beispiel Fußball, insbesondere des deutsch-deutschen Spiels von 1974, wird der Mannschaftssport im Kontext des Kalten Krieges analysiert. Der unerwartete Sieg der DDR-Mannschaft wird als Ausnahmefall betrachtet.
Welche Rolle spielte der Sport in der Freizeitgestaltung der DDR-Bürger?
Die SED versuchte, den Sport zur Stärkung des Kollektivs und zur Bindung der Bevölkerung an das System zu nutzen. Die Organisation von Sportveranstaltungen durch Betriebe und Wohngebiete wird beschrieben, aber auch die oft große Diskrepanz zwischen staatlichen Planungen und der tatsächlichen Beteiligung der Bevölkerung.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Das Fazit der Arbeit befasst sich mit dem Vermächtnis der SED-Sportpolitik und zieht Bilanz über die Auswirkungen auf die Sportlandschaft und die Bevölkerung der DDR. (Der genaue Inhalt des Fazits ist in der Zusammenfassung der Kapitel enthalten.)
- Citation du texte
- Teddy Seck (Auteur), 2011, Die politische Rolle des Sports im SED-Staat DDR, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/268891