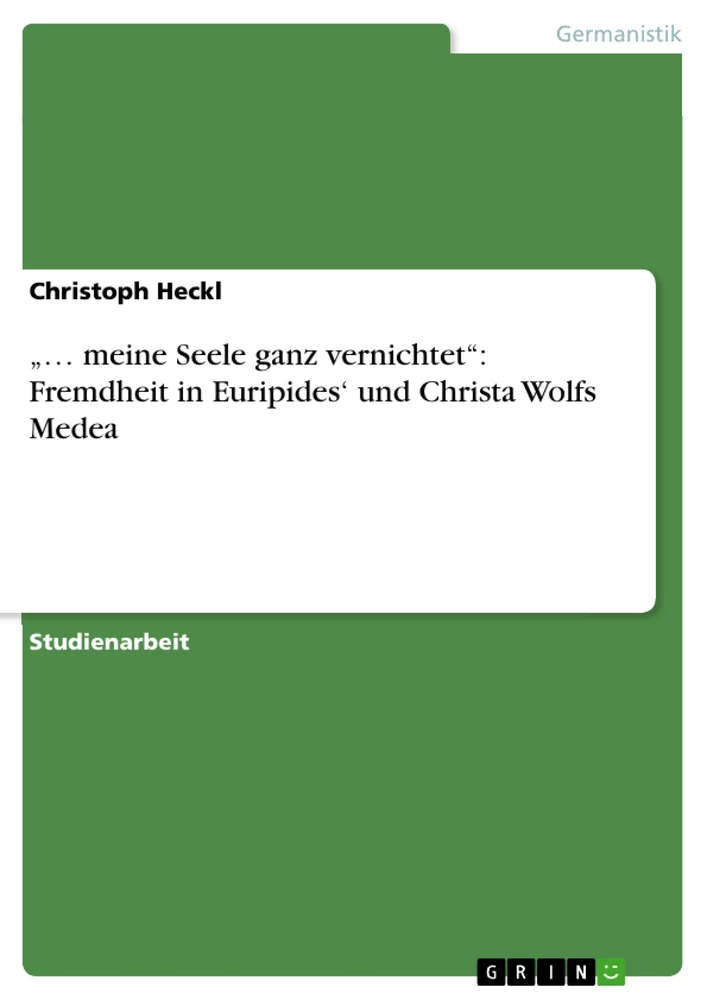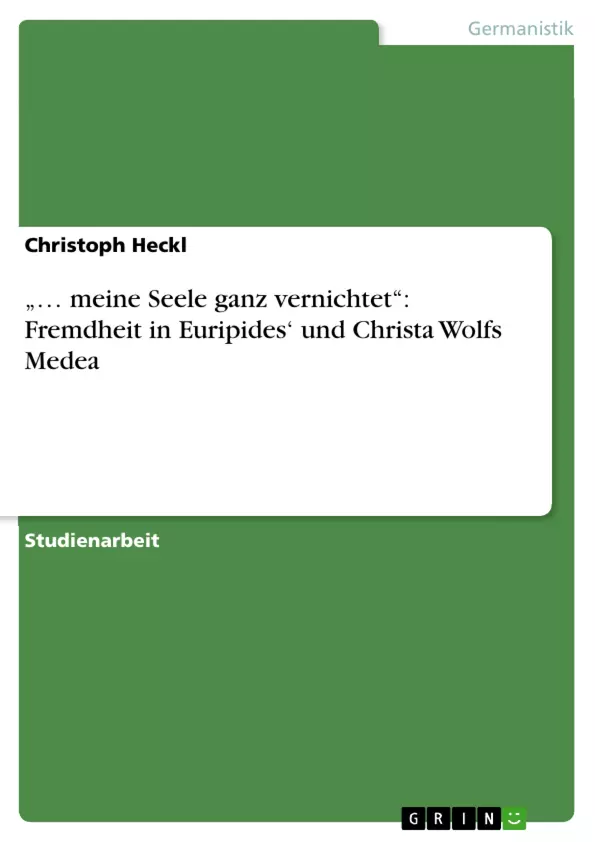Der Medea-Mythos hat die Menschen seit jeher fasziniert. Überlieferungen zur Medea waren Ausgangspunkt für Gedichte, Theaterstücke, Gemälde, Romane und Opern. Sie alle haben den Stoff, abgestimmt auf die Bedürfnisse ihres eigenen Zeitalters verschieden zu akzentuieren oder modellieren gewusst. Der römische Dichter Ovid etwa interessierte sich vor allem für die „hexenhafte Dimension“ der Geschichte, während sein römischer Landsmann Seneca „ungezügelter Rhetorik und Strömen von Blut“ besonderen Platz einräumte.1
Dabei blieb in den Verformungen des Mythos stets ein zentraler Kern bestehen, welcher von den Autoren gleichsam ummantelt wurde. Die wissenschaftliche Rezeption hat je nach Art dieser Ummantelung versucht, Medea innerhalb eines kulturell und moralisch irgendwie akzeptablen Deutungsmusters zu positionieren: zwischen Frau und Mann, liebender Mutter und Mörderin, Täterin und Opfer etc.2 Unter diesen dichotomen Begriffspaaren kommt der „Dazugehörigkeit und Fremdheit“3 eine besondere Rolle zu. Bereits in der rezeptionsgeschichtlich bedeutsamsten Fassung, 4 der des Athener Dramatikers Euripides, hat diese eine tragende Funktion.
Diese wird noch gesteigert in der neuesten und radikal umgestalteten Version des Mythos. In „Medea. Stimmen“ von 1996 stellt Christa Wolf der mordlüsternen Medea der antiken Fassung eine neue Medea entgegen. Dabei versucht sie, den Rahmen der reichen Überlieferung des Medea-Mythos nicht zu sprengen, sondern klug aus den vorhandenen Quellen und dem Stoff schöpfend eine alternative Möglichkeit des Mythos aufzuzeigen.5
Dabei wird man als Leser beständig mit der Fremde und Konstellationen von Fremdheit konfrontiert. Denn Medeas Wirkungspotential liegt, wie Manfred Schmeling richtig gesehen hat, „in der Komplexität der sie kennzeichnenden Fremdheitsmuster, in ihrer multiplen Alterität“.6 Sie repräsentiert geradezu eine ‚Kultur des Anderen‘. In dieser Arbeit wird Medeas Rolle als Frau in Korinth und ihre dortige zwischen den Polen Faszination und Ablehnung changierende Stellung thematisiert. In einem letzten Kapitel wird die zweite Hauptperson, Jason, in den Mittelpunkt der Betrachtung gerückt. Ihm hat Wolf eine Rolle zugedacht, die man aus einer postkolonialen Perspektive betrachtet als die des Kolonisators bezeichnen könnte. Seine Form der Wahrnehmung der Fremde ist bezeichnend für den Diskurs zur Fremdheit in Korinth.
Dabei regt Wolf auch ein Nachdenken über die Macht der Literatur an. Denn unser heutiges „Medea-Bild“ entspringt (...)
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
1. Begriffsklärung
1.1 Das Fremde als Interpretament der Andersheit
1.2 Die Objektivität des Fremden nach Georg Simmel
1.3 Fremdheit als nicht überschreitbare Differenzlinie
1.4 Innere Fremdheit
2. Konfigurationen der Fremde in Euripides‘ Medea
2.1 Prolog: Die Fremde als negativer Kontrast zur Heimat
2.2 Erster Auftritt: Medea als Fremde in Korinth
3. Fremdheit in Christa Wolfs Roman Medea. Stimmen
3.1 Ä… doch nur Wilde“: Fremdheit als nicht transzendierbare Differenzlinie
3.2 Medea: Repräsentantin einer ‚Kultur des Anderen‘
3.2.1 Das Frauenbild in Korinth und Kolchis
3.2.2 Zwischen Faszination und Ablehnung
3.3 Jason: der ‚Kolonisator‘
Schluss
Literaturverzeichnis
Quellen
Darstellungen
Häufig gestellte Fragen
Wie unterscheidet sich Christa Wolfs Medea von der antiken Figur des Euripides?
Während Euripides Medea als Kindsmörderin darstellt, entwirft Christa Wolf in "Medea. Stimmen" ein alternatives Bild. Wolf nutzt vorhandene Quellen, um Medea als Opfer von Intrigen und als Fremde in einer feindseligen Gesellschaft zu zeigen.
Welche Rolle spielt das Thema "Fremdheit" in der Medea-Rezeption?
Fremdheit ist ein zentrales Interpretament. Medea verkörpert die "multiple Alterität" – sie ist Fremde als Frau, als Ausländerin (aus Kolchis) und als Repräsentantin einer anderen Kultur, die zwischen Faszination und Ablehnung steht.
Was versteht Georg Simmel unter der "Objektivität des Fremden"?
Simmels soziologischer Ansatz beschreibt den Fremden als jemanden, der heute kommt und morgen bleibt, aber eine gewisse Distanz bewahrt. Diese Position ermöglicht eine objektivere Sicht auf die Gesellschaft, führt aber auch zu Ausgrenzung.
Warum wird Jason in Christa Wolfs Roman als "Kolonisator" bezeichnet?
Aus postkolonialer Perspektive betrachtet Wolf Jason als jemanden, der die fremde Kultur Medeas (Kolchis) ausnutzt und sich die Herrschaft in Korinth durch Anpassung an die dortigen Machtstrukturen sichert, während er Medea opfert.
Was thematisiert der Vergleich der Frauenbilder in Korinth und Kolchis?
Die Arbeit analysiert die gegensätzlichen gesellschaftlichen Strukturen: das patriarchale, machtorientierte Korinth und das (in Medeas Erinnerung) naturverbundenere, anders organisierte Kolchis.
- Quote paper
- Christoph Heckl (Author), 2008, „… meine Seele ganz vernichtet“: Fremdheit in Euripides‘ und Christa Wolfs Medea, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/269042