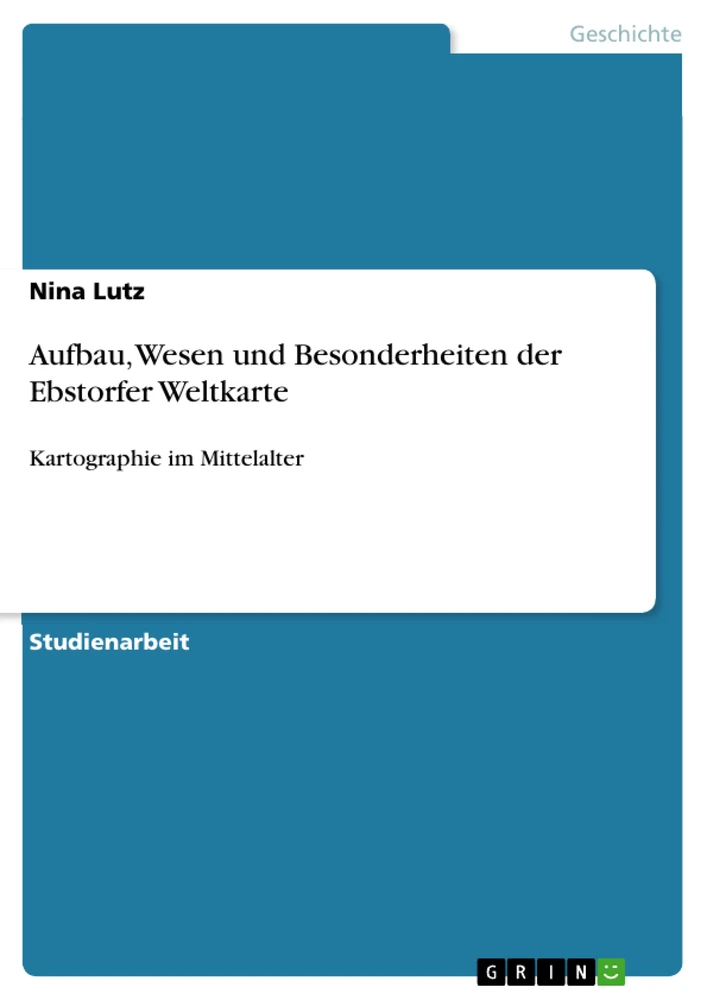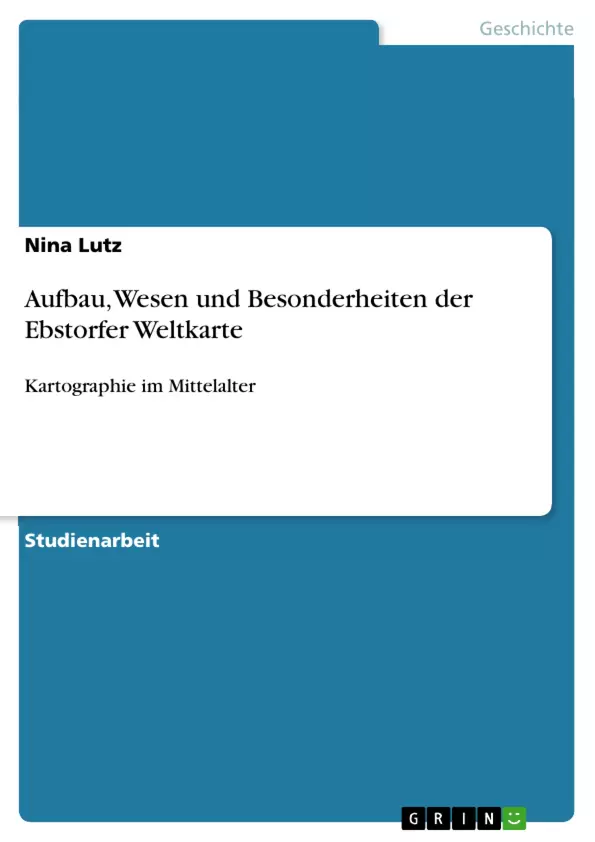Die Arbeit soll sich mit den Grundlagen der Kartographie, die den mappa mundi innewohnen,
beschäftigen. Hierbei ist danach zu fragen wo diese Grundlagen herrühren und warum antike
Traditionen noch in mittelalterlichen Karten zu finden sind. Wann hat sich die Weltsicht
gewandelt, ab wann sprechen wir vom christlichen Weltbild, und wie vorherrschend
waren biblische Einflüsse in den mittelalterlichen Karten?
Desweiteren soll der Frage nachgegangen werden ob in der Ebstorfkarte bestimmte
Themenschwerpunkte gesetzt wurden. Wurden Signaturen des Neuen oder des Alten
Testaments verwand? Welches zeitgenössische Wissen prägt das Kartenbild? Welche
Heiligen waren dem Verfasser der Karte besonders wichtig? Welche Annahmen lassen sich
aus der Ikonographie der Karte ableiten? In einer abschließenden Betrachtung sollen die
einzelnen Ergebnisse dann zusammengefügt werden, um diese Fragen zu beantworten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Ebstorfer Weltkarte: Autor, Datierung und Entstehungsort
- Grundlagen der mittelalterlichen Kartographie
- Aufbau und Struktur der Ebstorfer Weltkarte
- Das T-O-Schema
- Christliche Ikonographie: Christusbild, Jerusalem und die Monstrengalerie
- Der enzyklopädische Charakter: Tierwelt, Winde und Heiligengräber
- Quellen- und Literaturverzeichnis
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit setzt sich zum Ziel, die Ebstorfer Weltkarte als ein bedeutendes Dokument der europäischen Kulturgeschichte zu analysieren. Sie befasst sich mit den Grundlagen der mittelalterlichen Kartographie, der Entstehung und der Besonderheiten der Ebstorfer Weltkarte sowie deren Bedeutung als mittelalterliche Weltdarstellung.
- Analyse der Grundlagen der mittelalterlichen Kartographie und deren Entstehung
- Untersuchung der Entstehungsgeschichte der Ebstorfer Weltkarte: Autor, Datierung und Entstehungsort
- Analyse des Aufbaus und der Struktur der Ebstorfer Weltkarte: Das T-O-Schema, die christliche Ikonographie und der enzyklopädische Charakter
- Bewertung der Ebstorfer Weltkarte als ein wichtiges Zeugnis des mittelalterlichen Weltbildes
- Herausarbeitung der Bedeutung der Ebstorfer Weltkarte als Quelle für die Forschung zum Mittelalter
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in das Thema der Ebstorfer Weltkarte ein und stellt die Forschungsfrage nach ihrer Entstehung und Bedeutung dar. Das zweite Kapitel beleuchtet die Geschichte der Ebstorfer Weltkarte, ihren Autor, ihre Datierung und ihren Entstehungsort. Das dritte Kapitel befasst sich mit den Grundlagen der mittelalterlichen Kartographie und ihrer Bedeutung für die Entstehung der Ebstorfer Weltkarte.
Das vierte Kapitel analysiert den Aufbau und die Struktur der Ebstorfer Weltkarte, inklusive des T-O-Schemas, der christlichen Ikonographie und des enzyklopädischen Charakters. Der fünfte Abschnitt befasst sich mit den Quellen und der Literatur, die in dieser Arbeit verwendet wurden. Der sechste Abschnitt enthält die Schlussbetrachtung, die die Ergebnisse der Arbeit zusammenfasst und die Bedeutung der Ebstorfer Weltkarte für die Forschung zum Mittelalter herausstellt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen mittelalterliche Kartographie, Weltkarte, Ebstorf, T-O-Schema, christliche Ikonographie, enzyklopädischer Charakter, mittelalterliches Weltbild, Kulturgeschichte, Forschung zum Mittelalter.
- Arbeit zitieren
- Nina Lutz (Autor:in), 2013, Aufbau, Wesen und Besonderheiten der Ebstorfer Weltkarte, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/269233