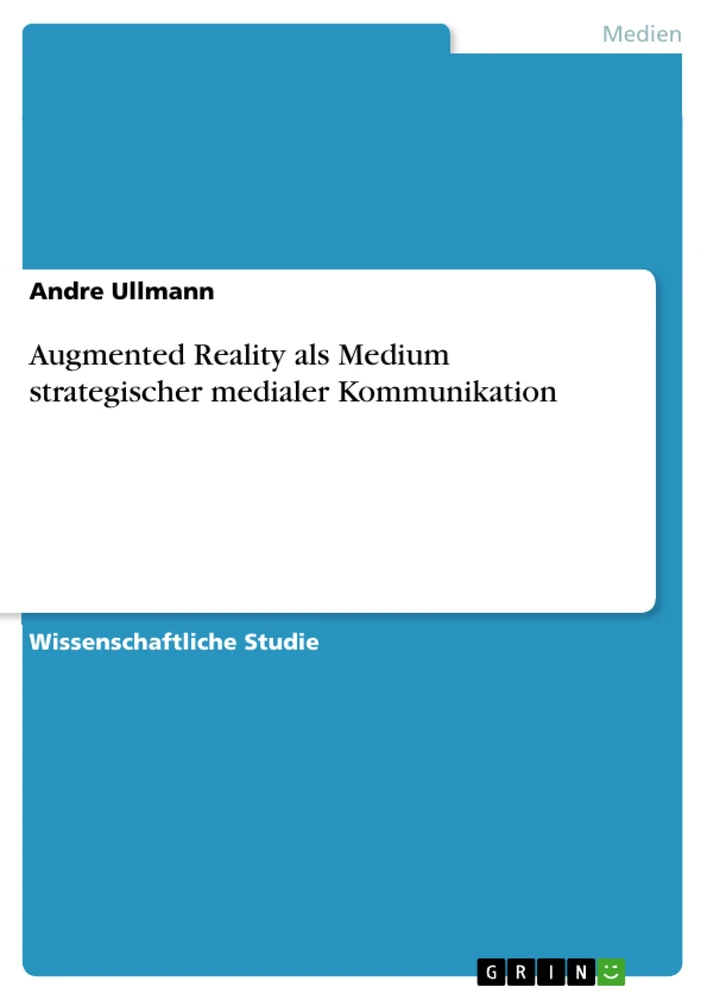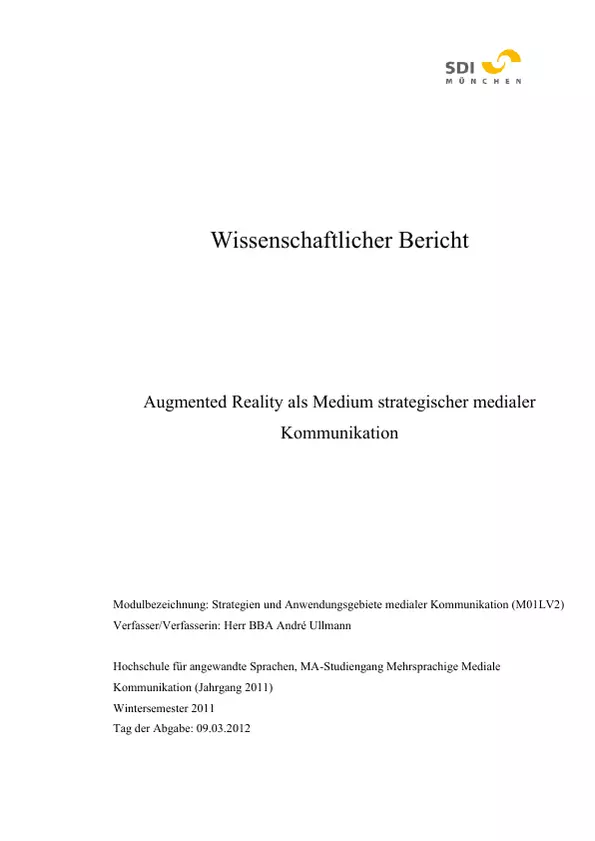Time-to-Content, der schnelle Zugriff auf die richtigen Informationen zur richtigen Zeit und ihre effiziente und effektive Darstellung, gewinnt zunehmend an Relevanz. Augmented Reality bietet gegenüber der herkömmlichen Vermittlung von Informationen durch Bücher, Videos, Vorträgen und dergleichen, eine innovative Alternative um Informationen auf völlig neue Art und Weise zu präsentieren, nämlich im direkten Blickfeld des Nutzers. Gartner- und Juniper Research prognostizieren den Durchbruch dieser Technologie schon für die nächsten 3-8 Jahre.1 Somit heißt es noch abwarten, ob sich die verschiedenen Anwendungsszenarien und Einsatzfelder in der Informationsvermittlung und Kommunikation auf Basis von Augmented Reality durchsetzen werden. Die wesentlichen Ziele der Kommunikation und die dazu passenden Einsatzfelder der Augmented Reality aus der Perspektive des Marketings, bilden den Fokus dieser Arbeit. Dabei bietet Kapitel 3 vorerst einige Grundlagen und Ansätze, gefolgt von den Zielen der Kommunikation. Kapitel 4 verbindet das vorherige Thema mit Augmented Reality und zeigt einige Einsatzfelder auf. Kapitel 5 widmet sich der monetären Seite, da es schwer vorstellbar ist, wie außer durch den Verkauf von Anwendungen mit dieser Technologie Umsätze generiert werden können.
Interessant ist, dass diese Technologie schon in den 90er Jahren entwickelt wurde, aber das Potenzial zu diesem Zeitpunkt noch nicht wahrgenommen wurde. Obwohl Augmented Reality ständig weiter entwickelt wurde, schätzten Studien wie Juniper Research das Markvolumen bis 2010 vorerst auf rund 2 Mio. US$. Allerdings stiegen die positiven Aussichten seit den letzten 2 Jahren auf ein Marktvolumen von 732 Mio. US$ bis 2014. Entscheidend dafür sind vor allem die Verfügbarkeit auf mobilen Endgeräten, sowie geringe Kosten für die Applikationen. Ein weiterer Aspekt ist, dass der Mehrwert von Augmented Reality nur schwer monetär quantifizierbar ist, was auch die Abwartehaltung der Unternehmen erklärt. Ein wenig erinnert die aktuelle Situation um Augmented Reality an die Entstehung des Webs. Auch hier haben Unternehmen den Mehrwert und die Tragweite der Technologie vorerst nicht erkannt. In den kommenden Jahren wird Augmented Reality aus unserem alltäglichen Leben aber nicht mehr wegzudenken sein. Computergenerierte Zusatzinformationen werden zukünftig so natürlich dargestellt, dass Nutzern nicht mehr bewusst sein wird, wenn sie in die virtuelle Realität eintauchen.2
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einführung und Motivation
- 2 Kommunikation
- 2.1 Grundlagen der Kommunikation
- 3 Augmented Reality
- 3.1 Potenzielle AR Geschäftsmodelle
- 3.2 Einsatzfelder für Augmented Reality
- 4 Augmented Reality und Kommunikation
- 5 Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Augmented Reality (AR) als innovatives Medium strategischer medialer Kommunikation, insbesondere im Marketingkontext. Sie beleuchtet die Potenziale von AR im Vergleich zu traditionellen Kommunikationsmethoden und analysiert die Herausforderungen bei der Monetarisierung von AR-Anwendungen.
- Grundlagen der Kommunikation und Mensch-Maschine-Interaktion
- Potenziale und Herausforderungen von Augmented Reality in der Kommunikation
- Entwicklung und zukünftige Anwendungsszenarien von AR
- Geschäftsmodelle und Monetarisierung von AR-Technologien
- Vergleich von AR mit traditionellen Kommunikationsmethoden
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einführung und Motivation: Dieses einleitende Kapitel beschreibt die zunehmende Bedeutung von Time-to-Content und stellt Augmented Reality als innovative Alternative zur Präsentation von Informationen im direkten Blickfeld des Nutzers vor. Es werden die Prognosen von Gartner und Juniper Research zum Durchbruch der AR-Technologie in den nächsten Jahren erwähnt und die Zielsetzung der Arbeit, die sich auf die wesentlichen Ziele der Kommunikation und die passenden Einsatzfelder von AR aus Marketingperspektive konzentriert, definiert. Die zukünftige Unausweichlichkeit von computergenerierten Zusatzinformationen im alltäglichen Leben wird hervorgehoben, wobei der Fokus auf die Entwicklung und das bisherige ungenutzte Potential von AR gelegt wird. Der Vergleich mit der frühen Entwicklung des Internets wird gezogen um die aktuelle Situation zu veranschaulichen.
2 Kommunikation: Dieses Kapitel legt die Grundlagen der Kommunikation, insbesondere im Kontext der Mensch-Maschine-Kommunikation, dar. Es betont die Bedeutung von „wer mit wem“, „was“ und „wie“ kommuniziert wird und veranschaulicht dies anhand eines Sender-Empfänger-Modells (Abbildung 1). Die Bedeutung der Benutzerschnittstelle in der Mensch-Maschine-Kommunikation und die Integration verschiedener Sinne (Augen-Hand-Koordination, Sprachsteuerung, haptische Interaktion) werden diskutiert. Das Kapitel bildet die Brücke zur technischen Kommunikation im Kontext von Augmented Reality.
3 Augmented Reality: Dieses Kapitel befasst sich mit den potenziellen Geschäftsmodellen und Einsatzfeldern von Augmented Reality. Es verknüpft die zuvor beschriebenen Kommunikationsgrundlagen mit den technischen Möglichkeiten von AR und zeigt diverse Anwendungsgebiete auf. Obwohl der Schwerpunkt auf dem monetären Aspekt liegt, wird der Mehrwert von AR als schwer quantifizierbar dargestellt, was die zögerliche Akzeptanz von Unternehmen erklärt.
4 Augmented Reality und Kommunikation: Dieses Kapitel verbindet die vorherigen Themen und zeigt konkrete Einsatzfelder von Augmented Reality in der Kommunikation auf. Es analysiert, wie AR die traditionellen Kommunikationsmethoden ergänzt und erweitert, und welche neuen Möglichkeiten sich dadurch ergeben. Die Zusammenfassung der einzelnen Einsatzfelder und deren wirtschaftliche Bedeutung bilden den Kern des Kapitels.
Schlüsselwörter
Augmented Reality, Strategische Medienkommunikation, Mensch-Maschine-Kommunikation, Marketing, Geschäftsmodelle, Einsatzfelder, Time-to-Content, Informationsvermittlung, Monetarisierung, Benutzerinterface.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Augmented Reality in der Strategischen Medienkommunikation"
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht Augmented Reality (AR) als innovatives Medium strategischer medialer Kommunikation, insbesondere im Marketingkontext. Sie beleuchtet die Potenziale von AR im Vergleich zu traditionellen Kommunikationsmethoden und analysiert die Herausforderungen bei der Monetarisierung von AR-Anwendungen. Die Arbeit beinhaltet eine Einleitung, Kapitel zu den Grundlagen der Kommunikation, zu Augmented Reality (einschließlich potenzieller Geschäftsmodelle und Einsatzfelder), ein Kapitel, das AR und Kommunikation verbindet, und schließlich eine Zusammenfassung und einen Ausblick. Die Arbeit umfasst außerdem ein Inhaltsverzeichnis, eine Zielsetzung mit Themenschwerpunkten, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Kernthemen: Grundlagen der Kommunikation und Mensch-Maschine-Interaktion, Potenziale und Herausforderungen von Augmented Reality in der Kommunikation, Entwicklung und zukünftige Anwendungsszenarien von AR, Geschäftsmodelle und Monetarisierung von AR-Technologien und einen Vergleich von AR mit traditionellen Kommunikationsmethoden. Ein besonderer Fokus liegt auf dem Marketingkontext und der Bedeutung von Time-to-Content.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in jedem Kapitel?
Die Arbeit besteht aus fünf Kapiteln: Kapitel 1 (Einführung und Motivation) führt in das Thema ein und beleuchtet die Bedeutung von Time-to-Content und die Zukunftsaussichten von AR. Kapitel 2 (Kommunikation) legt die Grundlagen der Kommunikation, insbesondere der Mensch-Maschine-Kommunikation, dar. Kapitel 3 (Augmented Reality) behandelt potenzielle Geschäftsmodelle und Einsatzfelder von AR. Kapitel 4 (Augmented Reality und Kommunikation) verbindet die vorherigen Themen und zeigt konkrete Einsatzfelder von AR in der Kommunikation auf. Kapitel 5 (Zusammenfassung und Ausblick) fasst die Ergebnisse zusammen und gibt einen Ausblick auf zukünftige Entwicklungen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Augmented Reality, Strategische Medienkommunikation, Mensch-Maschine-Kommunikation, Marketing, Geschäftsmodelle, Einsatzfelder, Time-to-Content, Informationsvermittlung, Monetarisierung, Benutzerinterface.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit untersucht das Potenzial von Augmented Reality als innovatives Kommunikationsmedium im Marketing. Sie analysiert die Möglichkeiten und Herausforderungen von AR im Vergleich zu traditionellen Kommunikationsmethoden und befasst sich mit der Monetarisierung von AR-Anwendungen. Die Arbeit zielt darauf ab, die wesentlichen Ziele der Kommunikation und die passenden Einsatzfelder von AR aus Marketingperspektive zu definieren und zu analysieren.
Wie wird die Bedeutung von Augmented Reality in der Arbeit dargestellt?
Die Arbeit betont die zunehmende Bedeutung von AR als innovative Alternative zur Informationsvermittlung im direkten Blickfeld des Nutzers. Sie vergleicht die Entwicklung von AR mit der des Internets und hebt das bisher ungenutzte Potenzial von AR hervor. Obwohl der monetäre Aspekt eine Rolle spielt, wird der oft schwer quantifizierbare Mehrwert von AR als Erklärung für die zögerliche Akzeptanz von Unternehmen genannt.
Welche Rolle spielt die Mensch-Maschine-Kommunikation in dieser Arbeit?
Die Mensch-Maschine-Kommunikation spielt eine zentrale Rolle, da AR als Technologie die Interaktion zwischen Mensch und Maschine gestaltet. Die Arbeit analysiert die Bedeutung der Benutzerschnittstelle und die Integration verschiedener Sinne (Augen-Hand-Koordination, Sprachsteuerung, haptische Interaktion) im Kontext von AR und Kommunikation.
- Quote paper
- M.A. Andre Ullmann (Author), 2013, Augmented Reality als Medium strategischer medialer Kommunikation, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/269247