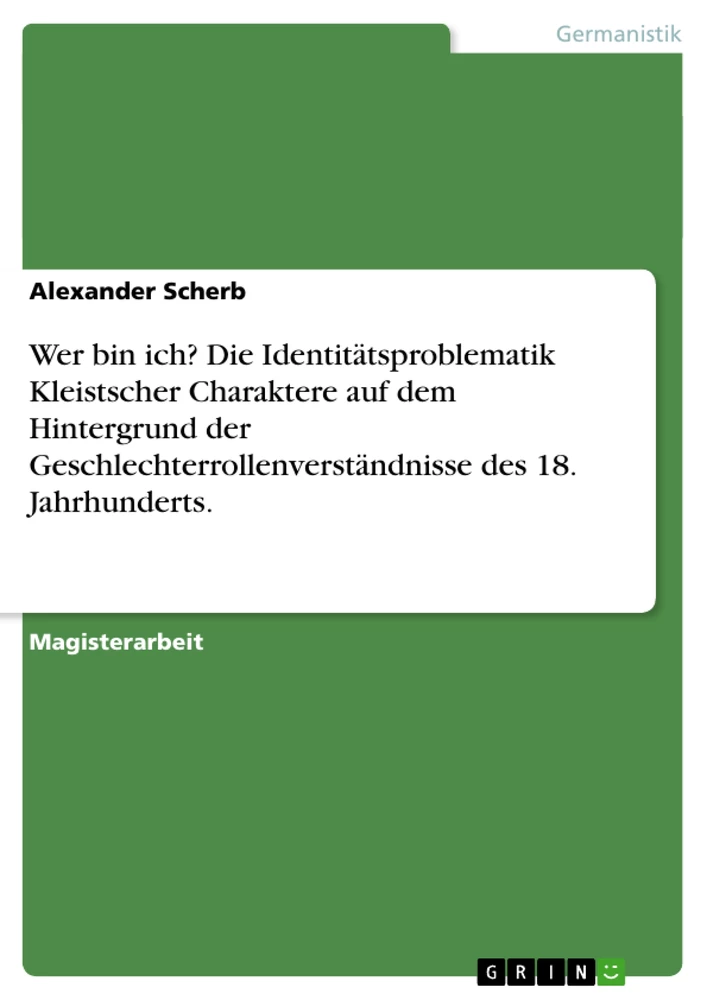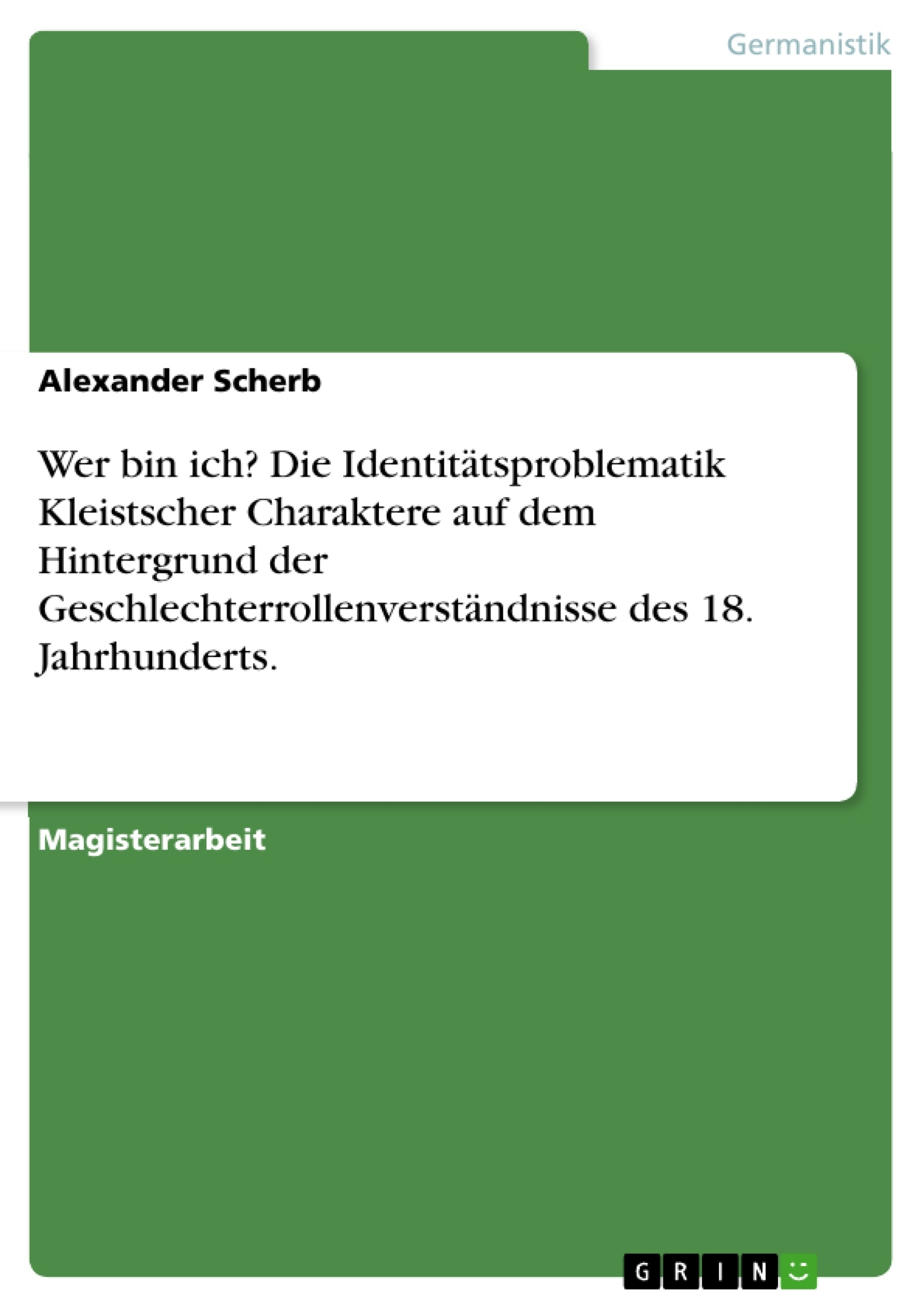Das Herausfallen der Protagonisten aus dem Geschlechter-Rollen-Verständnisses des 18. Jahrhunderts ist bei Heinrich von Kleist nicht nur die Regel, sondern Methode. Doch was wollte der Schriftsteller damit aussagen? Dieses Buch beschäftigt sich mit den Motiven und Gedanken einer der wohl umstrittensten Literaten des 18. und 19. Jahrhunderts.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Kleists Familien
- II.1.) Die Marquise von O....
- II.1.1) Herr von G.....
- II.1.2.) Frau von G
- II.1.3.) Die Marquise....
- II.2.) Der Findling .....
- II.3.) Vergleich der Familien
- II.1.) Die Marquise von O....
- III. Kleists Frauen
- III.1.) Die Verlobung in St. Domingo: Toni Bertrand.
- III.2.) Penthesilea.....
- IV. Kleists Männer
- IV.1.) Die Verlobung in St. Domingo: Gustav von der Ried
- IV.2.) Michael Kohlhaas: Michael Kohlhaas......
- V. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Magisterarbeit untersucht die Identitätsproblematik in Kleists Werken vor dem Hintergrund der Geschlechterrollen des 18. Jahrhunderts. Sie analysiert, wie Kleist damalige Normen in seinen Dramen und Erzählungen aufbricht und die inneren Konflikte seiner Charaktere darstellt. Die Arbeit konzentriert sich auf die Darstellung von Geschlechterrollen und deren Einfluss auf die Identität der Figuren.
- Identitätsfindung in Kleists Charakteren
- Auflösung traditioneller Geschlechterrollen
- Innere Zerrissenheit und Ambivalenz der Figuren
- Der Einfluss philosophischer Strömungen auf Kleists Werk
- Kleists kritischer Umgang mit gesellschaftlichen Normen
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt Heinrich von Kleist als bedeutenden, wenn auch zu Lebzeiten wenig erfolgreichen, Schriftsteller vor. Sie hebt seine ambivalente Stellung innerhalb der literarischen Strömungen seiner Zeit hervor und betont die bis heute anhaltende Relevanz seines Werks für die Forschung. Der Fokus auf Kleists provokative Darstellung von Geschlechterrollen und die innere Zerrissenheit seiner Charaktere wird als zentraler Untersuchungsgegenstand eingeführt. Die Einleitung skizziert die Problematik der Rezeption Kleists und erwähnt die Schwierigkeiten, ihn eindeutig einer literarischen Epoche zuzuordnen. Der Ausblick auf die folgenden Kapitel und die Forschungsfrage werden angedeutet.
II. Kleists Familien: Dieses Kapitel analysiert die Familiendynamiken in ausgewählten Werken Kleists. Es untersucht die Darstellung von Familienstrukturen und deren Auswirkungen auf die Identität der einzelnen Figuren. Die Analyse betrachtet die Rollenverteilung innerhalb der Familien, die Beziehungen zwischen den Familienmitgliedern und die Konflikte, die sich aus den unterschiedlichen Erwartungen und Lebensentwürfen ergeben. Es werden sowohl typische als auch untypische Rollenmuster der Figuren beleuchtet. Vergleichende Analysen verschiedener Familienkonstellationen sollen die komplexen Beziehungen und die damit verbundenen Identitätsfragen herausstellen.
III. Kleists Frauen: Das Kapitel widmet sich der Darstellung weiblicher Figuren in Kleists Werken. Es untersucht die Vielschichtigkeit und Komplexität weiblicher Identitäten, indem es unterschiedliche Rollenmuster und ihre Auswirkungen auf das Leben und Handeln der Frauen analysiert. Die Kapitel analysiert die Emanzipationsbestrebungen der Figuren, ihre Konflikte mit den gesellschaftlichen Normen und deren Auswirkungen auf ihre Identität und ihre Beziehungen zu Männern. Der Fokus liegt auf der Darstellung von Stärke, Verletzlichkeit und der Ambivalenz weiblicher Charaktere in der Literatur Kleists.
IV. Kleists Männer: In diesem Kapitel werden die männlichen Charaktere in Kleists Werken untersucht. Es wird analysiert, wie Kleist die traditionelle Männlichkeit aufbricht und die inneren Konflikte und Schwächen seiner männlichen Protagonisten darstellt. Die Analyse fokussiert auf die Vielschichtigkeit männlicher Identitäten und zeigt, wie Kleist die gesellschaftlichen Erwartungen an Männer hinterfragt und kritisiert. Es wird untersucht, wie die männlichen Charaktere mit Konflikten und Krisen umgehen und wie diese ihre Identität prägen.
Schlüsselwörter
Heinrich von Kleist, Identitätsproblematik, Geschlechterrollen, 18. Jahrhundert, Familienstrukturen, Emanzipation, Ambivalenz, innere Zerrissenheit, Romantik, Klassik, Aufklärung.
Häufig gestellte Fragen zur Magisterarbeit: Identitätsproblematik in Kleists Werken
Was ist der Gegenstand dieser Magisterarbeit?
Die Magisterarbeit untersucht die Identitätsproblematik in den Werken Heinrich von Kleists vor dem Hintergrund der Geschlechterrollen des 18. Jahrhunderts. Der Fokus liegt auf der Analyse, wie Kleist damalige Normen aufbricht und die inneren Konflikte seiner Charaktere darstellt, insbesondere im Hinblick auf Geschlechterrollen und deren Einfluss auf die Identität der Figuren.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit konzentriert sich auf die Identitätsfindung in Kleists Charakteren, die Auflösung traditioneller Geschlechterrollen, die innere Zerrissenheit und Ambivalenz der Figuren, den Einfluss philosophischer Strömungen auf Kleists Werk und Kleists kritischen Umgang mit gesellschaftlichen Normen.
Welche Werke von Kleist werden analysiert?
Die Arbeit analysiert ausgewählte Dramen und Erzählungen von Kleist, einschließlich, aber nicht beschränkt auf "Die Marquise von O...", "Der Findling", "Die Verlobung in St. Domingo" und "Michael Kohlhaas". Der Fokus liegt auf der Untersuchung der Familiendynamiken, der Darstellung weiblicher und männlicher Figuren und deren Identitätsfindung.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Eine Einleitung, die den Kontext und die Forschungsfrage etabliert; ein Kapitel über Kleists Familien und deren Einfluss auf die Identität der Figuren; ein Kapitel über die Darstellung weiblicher Figuren; ein Kapitel über die Darstellung männlicher Figuren; und abschließend ein Fazit.
Welche Kapitelzusammenfassungen werden geboten?
Die Zusammenfassung der Kapitel bietet einen Überblick über die jeweilige Analyseebene. Kapitel I (Einleitung) präsentiert Kleist als Schriftsteller und stellt die Forschungsfrage. Kapitel II (Kleists Familien) analysiert Familiendynamiken und deren Auswirkungen auf die Identitätsfindung. Kapitel III (Kleists Frauen) untersucht die Komplexität weiblicher Identitäten und Emanzipationsbestrebungen. Kapitel IV (Kleists Männer) analysiert die Darstellung männlicher Figuren und den kritischen Umgang mit traditionellen Männlichkeitsvorstellungen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Schlüsselwörter zur Beschreibung der Arbeit sind: Heinrich von Kleist, Identitätsproblematik, Geschlechterrollen, 18. Jahrhundert, Familienstrukturen, Emanzipation, Ambivalenz, innere Zerrissenheit, Romantik, Klassik, Aufklärung.
Welche Forschungsfrage wird in der Arbeit behandelt?
Die zentrale Forschungsfrage ist implizit, aber der Fokus liegt auf der Untersuchung, wie Kleist Geschlechterrollen des 18. Jahrhunderts in seinen Werken darstellt und wie diese Darstellung die Identitätsfindung seiner Figuren beeinflusst und prägt.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit ist primär für ein akademisches Publikum gedacht, insbesondere für Leser, die sich für die Literatur Heinrich von Kleists, Geschlechterforschung und die Literatur des 18. Jahrhunderts interessieren.
- Quote paper
- Alexander Scherb (Author), 2010, Wer bin ich? Die Identitätsproblematik Kleistscher Charaktere auf dem Hintergrund der Geschlechterrollenverständnisse des 18. Jahrhunderts., Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/269270