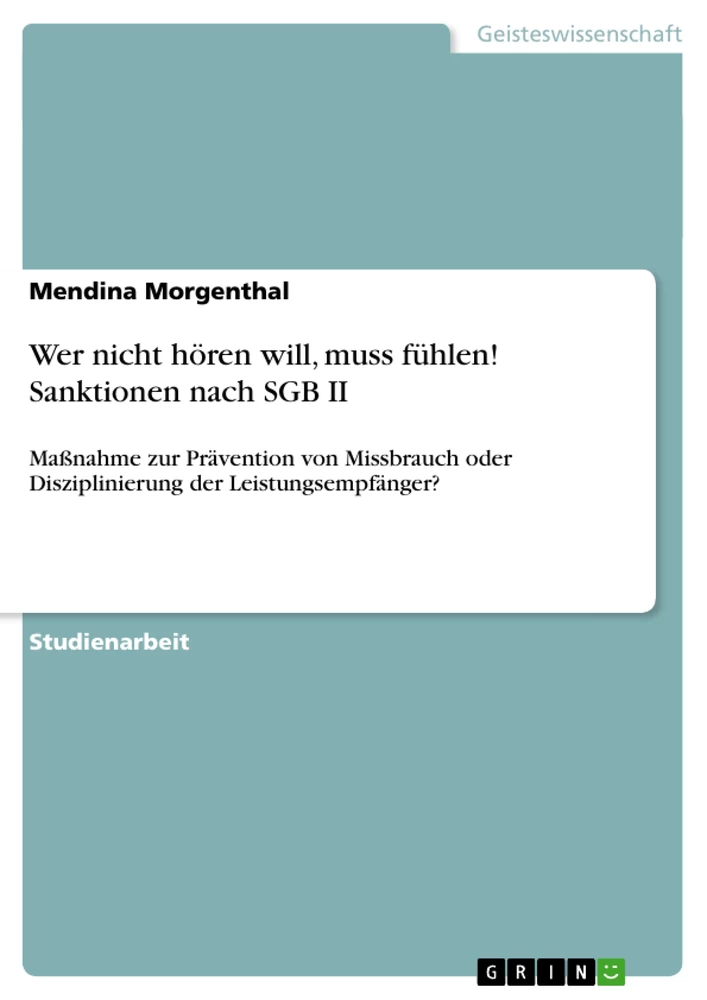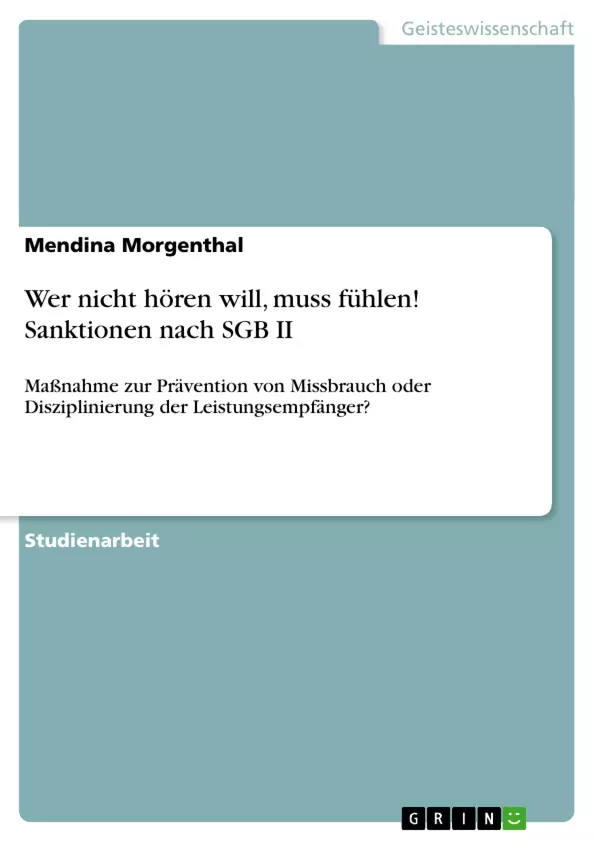Am Beispiel der Sanktion unter SGB II kann eine Diskrepanz zwischen Recht und Moral wunderbar skizziert werden. Denn rein rechtlich gesehen muss die Frage, ob den Leistungsempfängern bei Pflichtverletzung das Existenzminimum gekürzt werden darf, positiv beantwortet werden. Moralisch gesehen stellt sich jedoch die Frage, ob eine Grundsicherung, welche das Existenzminimum sichern soll, überhaupt gekürzt werden darf? Also: Ist es moralisch vertretbar, das Existenzminimum noch zu kürzen?
Wer nicht hören will, muss fühlen Sanktionen nach SGB II
Maßnahme zur Prävention von Missbrauch oder Disziplinierung der Leistungsempfänger?
Reflektion zum Referat „System sozialer Sicherung- Sozialhilfe und Grundsicherung“
Mendina Sabrina Morgenthal
System sozialer Sicherung: Sozialhilfe und Grundsicherung Sanktionen nach SGB II
Mit der Einführung der sogenannten „Hartz - Reform“ im Jahr 2005 wurde ein steuerfinan- ziertes Fürsorgesystem geschaffen. Ziel dieser Reform ist es, den Leistungsberechtigten ein Leben, welches der Würde des Menschen entspricht (SGB II, § 1), zu ermöglichen. Hierbei wird auf den ersten Artikel des Grundgesetzes („Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.“) Bezug genom- men.
Die Reglungen zur Grundsicherung für Arbeitssuchende sind im Sozialgesetzbuch zweites Buch (SGB II) verordnet. Nicht jeder Bürger1 in der Bundesrepublik Deutschland (BRD) hat einen Anspruch auf Arbeitslosengeld II bzw. auf Grundsicherung für Arbeitssuchende (um- gangssprachlich oft vereinfacht „Hartz IV“ genannt). Wer also als Leistungsberechtigt gilt, ist im SGB II festgelegt:
1. Personen zwischen 15 und 65 Jahren
2. Erwerbsfähige Personen
3. Hilfebedürftige Personen
4. Personen mit gewöhnlichem Aufenthaltsort in der Bundes Republik Deutschland
5. Personen, die mit einem Leistungsberechtigten in einer Bedarfsgemeinschaft leben. (vgl. Sozialgesetzbuch zweites Buch § 7)
Erwerbsfähig ist nach Sozialgesetzbuch zweites Buch § 8 jeder, der mindestens drei Stunden täglich arbeiten kann. Hilfebedürftigkeit liegt nach SGB II § 9 nun nicht ausschließlich bei Erwerbslosigkeit vor, sondern auch dann, wenn die Person ihren Lebensunterhalt nicht aus Einkommen oder Vermögen sichern kann und auch weder Verwandte, noch Freunde u. ä. hat, welche jenen sichern können.
Das Prinzip des Forderns und Förderns steht dabei an zentraler Stelle. Denn die Grundsicherung für Arbeitssuchende soll den Leistungsberechtigten zwar dabei helfen, den Lebensunterhalt zu sichern und die Hilfebedürftigkeit zu verringern bzw. zu beenden (Fördern), jedoch ist der leistungsberechtigte Hilfeempfänger dazu angehalten, alle Möglichkeiten der Verringerung oder Beendigung seiner Hilfebedürftigkeit zu nutzen (SGB II, § 2), welches dem Grundsatz des Forderns entspricht.
So ist der Leistungsempfänger also an seine Mitwirkungspflicht gebunden. Im Rahmen einer Eingliederungsvereinbarung, welche der Leistungsempfänger mit dem jeweiligen Jobcenter trifft, werden die Pflichten und die zu erbringenden Leistungen, sowohl des Leistungsemp- fängers, als auch der Bundesagentur für Arbeit festgelegt (SGB II § 15). Der erwerbsfähige Leistungsempfänger ist dabei angehalten, zu kooperieren und Eigenbemühung zu zeigen. „Vorrang vor der Geldleistung hat die Eingliederung in Arbeit“ (BÄCKER 2010, S. 346). Bei dem Konzept der „Hartz - Reform“ geht es also vielmehr darum, den Wiedereinstieg in den System sozialer Sicherung: Sozialhilfe und Grundsicherung Sanktionen nach SGB II Arbeitsmarkt von Langzeitarbeitslosen zu ermöglichen und die Bedingungen für den selbigen zu verbessern. Dabei spielt die Zumutbarkeit von Arbeit eine wichtige Rolle. Jede Arbeit, die „nicht gegen Gesetz oder die guten Sitten verstößt“ (BÄCKER 2010, S. 343) ist zumutbar. Im Einzelnen bedeutet dies: Nach Sozialgesetzbuch zweites Buch § 10 gilt jede Arbeit als zu- mutbar, solange der erwerbsfähige Hilfebedürftige dazu sowohl körperlich als auch seelisch in der Lage ist und/ oder die Arbeit die Erziehung des Kindes (wenn es das dritte Lebensjahr noch nicht vollendet hat) oder die Pflege eines Verwandten nicht gefährdet. D. h. der Hilfe- empfänger muss auch eine Arbeit aufnehmen, welche für ihn einen sozialen Abstieg bedeu- tet (BÄCKER 2010, S. 343). Damit gehen auch eine geringere Entlohnung, schlechtere Ar- beitsbedingungen und weitere Entfernung der Arbeit vom Wohnort einher.
KUMPMANN behauptet, dass die Erweiterung um die fordernde Komponente innerhalb der Hartz - Reformen zeigt, dass Sanktionen „als ein Kernelement der Arbeitsmarktreform anzu- sehen“ (KUMPMANN 2009, S. 236) sind. Sanktionen treten immer dann ein, wenn der Leis- tungsempfänger seiner, in der Eingliederungsvereinbarung festgehaltenen Pflichten, nicht nachkommt, wie beispielsweise eine zumutbare Arbeit abzulehnen oder einen Ein - Euro - Job abzubrechen (KUMPMANN 2009, S. 236). Dabei wird der Regelsatz, welcher sich monat- lich auf 374 Euro für Alleinstehende beläuft, für insgesamt drei Monate um 30% gemindert. Folgen weitere Pflichtverletzungen wird der Regelsatz um 60% gekürzt bis hin zu einer hun- dertprozentigen Kürzung einschließlich der Unterkunftskosten (Miete und Heizung) (KUMP- MANN 2009, S. 236). Von einer wiederholten Pflichtverletzung kann dann gesprochen wer- den, wenn der vorangegangene Minderungszeitraum weniger als ein Jahr her ist (MARBUR- GER 2011, S. 42).
Bei einer hundertprozentigen Kürzung kann man von einer Gefährdung des Existenzmini- mums sprechen. Abhilfe kann hier über Sachleistungen und Lebensmittelgutscheine ge- schaffen werden (BÄCKER 2010, S. 344). Bei erwerbsfähigen Leistungsberechtigten, welche das 25. Lebensjahr noch nicht erreicht haben, werden Sanktionen strenger vollzogen. Im Sozialgesetzbuch zweites Buch § 31a ist verordnet, dass die Leistungen bei Pflichtverlet- zungen bereits auf Leistungen für Unterkunft und Heizung beschränkt werden. Bei einer wie- derholten Pflichtverletzung entfällt die Leistung vollständig. Die Minderung des Regelbedarf, sowohl bei den unter als auch bei den über 25jährigen erstreckt sich auf einen Zeitraum von drei Monaten (SGB II § 31b).
Für Meldeversäumnisse kommen gesonderte Sanktionen hinzu. Versäumt der erwerbsfähige Leistungsempfänger nach Aufforderung und Rechtsbelehrung der Bundesagentur für Arbeit (oder des Jobcenters) sich bei ihm zu melden oder geht er der Aufforderung nicht nach, sich einer ärztlichen oder psychologischen Untersuchung zu unterziehen, wird der Regelbedarf um 10 % gekürzt (SGB II § 32).
[...]
1 Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wird auf eine geschlechtsspezifische Differenzierung, wie z.B. Teilneh- mer/Innen, verzichtet. Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung für beide Geschlechter.
Häufig gestellte Fragen
Was war das Hauptziel der Hartz-Reformen im Jahr 2005?
Das Ziel der Reform war die Schaffung eines steuerfinanzierten Fürsorgesystems, das Leistungsberechtigten ein Leben ermöglicht, welches der Würde des Menschen entspricht, basierend auf Artikel 1 des Grundgesetzes.
Wer gilt nach dem SGB II als leistungsberechtigt für Arbeitslosengeld II?
Leistungsberechtigt sind Personen zwischen 15 und 65 Jahren, die erwerbsfähig und hilfebedürftig sind, ihren gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland haben oder mit einem Leistungsberechtigten in einer Bedarfsgemeinschaft leben.
Was versteht man unter dem Prinzip des „Forderns und Förderns“?
Die Grundsicherung soll einerseits helfen, den Lebensunterhalt zu sichern (Fördern), verlangt aber gleichzeitig vom Empfänger, alle Möglichkeiten zu nutzen, um die Hilfebedürftigkeit zu beenden (Fordern).
Welche Sanktionen drohen bei Pflichtverletzungen nach SGB II?
Bei Pflichtverletzungen kann der Regelsatz zunächst um 30 % gemindert werden. Bei weiteren Verstößen folgen Kürzungen um 60 % bis hin zum vollständigen Wegfall der Leistungen inklusive der Unterkunftskosten.
Welche Besonderheiten gelten für Leistungsempfänger unter 25 Jahren?
Bei unter 25-Jährigen werden Sanktionen strenger vollzogen; die Leistungen können bereits bei der ersten Pflichtverletzung auf Kosten für Unterkunft und Heizung beschränkt werden und bei Wiederholung ganz entfallen.
Was gilt als „zumutbare Arbeit“ für Empfänger von Grundsicherung?
Jede Arbeit ist zumutbar, die nicht gegen Gesetze oder gute Sitten verstößt und zu der der Hilfebedürftige körperlich und seelisch in der Lage ist, auch wenn sie einen sozialen Abstieg oder geringere Entlohnung bedeutet.
- Citation du texte
- Mendina Morgenthal (Auteur), 2013, Wer nicht hören will, muss fühlen! Sanktionen nach SGB II, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/269278