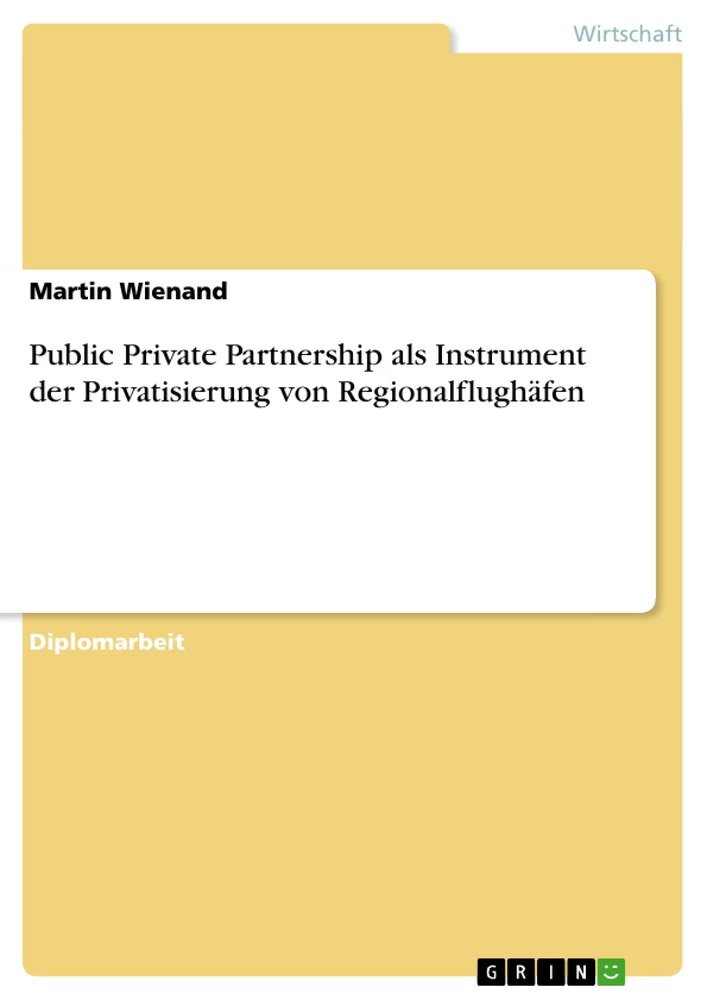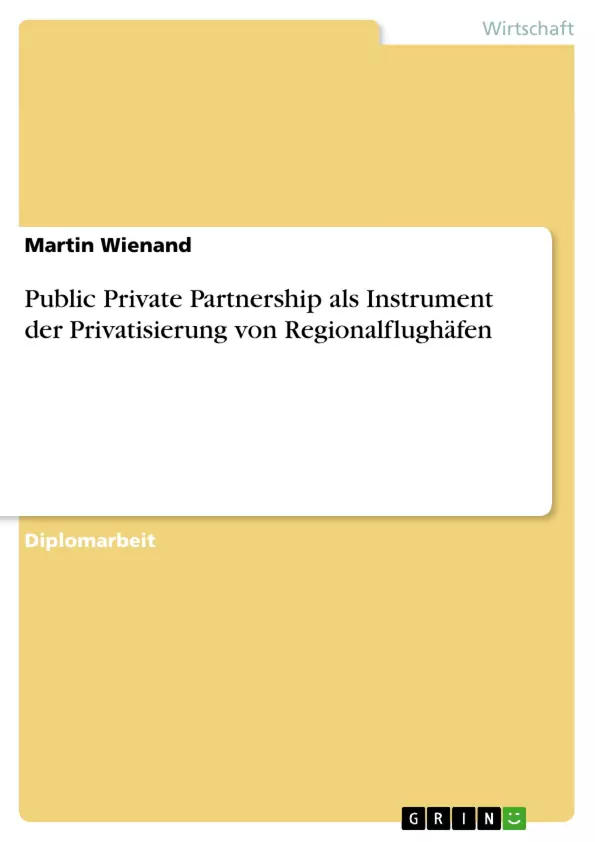Aufgrund des starken Anwachsens des Luftverkehrs sind viele Flughäfen in den vergangenen Jahren an ihre Kapazitätsgrenzen gestoßen. Wenn man das erwartete Wachstum des Luftverkehrs in den kommenden Jahren dem derzeitigen Angebot gegenüberstellt, ergibt sich ein deutlicher Nachfrageüberhang. Laut Prognosen wird sich das Passagieraufkommen auf deutschen Verkehrsflughäfen von ca. 142 Mio. im Jahr 2000 auf vermutlich 380 Mio. bis zum Jahr 2020 erhöhen. Das Aufkommen der Luftfracht soll sich von 1995 bis 2020 nahezu vervierfachen. Im Vergleich zu anderen Verkehrsarten zeichnet sich der Luftverkehr durch besonders hohe Wachstumsraten von 4,5% pro Jahr aus, die trotz der Terroranschläge vom 11. September 2001 nur vorübergehend abgeschwächt wurden. Das ständige Anwachsen des Luftverkehrs stellt hohe Anforderungen an die bereits bestehenden Verkehrsflughäfen. Einige Flughäfen arbeiten bereits heute an ihrer Kapazitätsgrenze. Die volkswirtschaftlichen Schäden, die aus Verspätungen und Umwegen resultieren, betragen ein vielfaches dessen, was ein Ausbau der Infrastruktur kosten würde. Angesichts struktureller Probleme, wie Finanznot und hoher Arbeitslosigkeit, erhoffen sich Bund, Länder und Gemeinden Vorteile durch Public Private Partnership (PPP) bei dem erforderlichen Ausbau der Verkehrsinfrastruktur.
Die Zusammenarbeit mit privaten Partnern an deutschen Flughäfen gewinnt jedoch erst seit einigen Jahren zunehmend an Dynamik. Die Privatisierungstendenzen haben auch Einfluss auf das 1994 veröffentlichte Luftfahrtkonzept 2000 des Bundes gehabt, in dem als Ziel der deutschen Luftverkehrspolitik u.a. auch die Privatisierung von Anteilen der öffentlichen Hand an Flughäfen genannt wurde. Bisher ist das Thema Public Private Partnership (PPP) vorwiegend im Zusammenhang mit der Privatisierung von internationalen Flughäfen behandelt worden, die Privatisierung von Regionalflughäfen wurde dagegen kaum untersucht.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP ALS INSTRUMENT DER PRIVATISIERUNG VON REGIONALFLUGHÄFEN
- DEFINITION UND ABGRENZUNG VON PPP
- DEFINITIONEN UND ABGRENZUNGEN IM LUFTFAHRTBEREICH
- Definition Flugplatz
- Definition Regionalflughafen
- PRIVATISIERUNG VON FLUGHÄFEN
- Gründe für die Privatisierung von Flughäfen
- Gründe für Privatinvestoren in Regionalflughäfen zu investieren
- Beteiligung an für Verkehrsverlagerungen geeigneten Regionalflughäfen
- Politische Gründe gegen Flughafenprivatisierungen
- PPP-VARIANTEN ZUR PRIVATISIERUNG VON FLUGHÄFEN
- ÜBERLEGUNGEN ZUR AUSWAHL DER PPP-VARIANTE
- ERWARTUNGEN AN PPP
- FLUGHÄFEN ALS NATÜRLICHE MONOPOLE
- NATÜRLICHES MONOPOL UND FOLGEN
- NATÜRLICHE MONOPOLE IM FLUGHAFENBEREICH
- DIE REGULIERUNGSMÖGLICHKEITEN
- EMPFEHLUNGEN FÜR PROJEKT- UND REGULIERUNGSRAHMEN
- PRINCIPAL-AGENT-PROBLEM
- DAS AUSSCHREIBUNGSVERFAHREN
- VERTRAGLICHE GESTALTUNG
- STAND DER PRIVATISIERUNG VON REGIONALFLUGHÄFEN
- ERWARTUNGEN AN DIE ERGEBNISSE DER EMPIRISCHEN UNTERSUCHUNG
- ÜBERSICHT AUSGEWÄHLTER REGIONALFLUGHÄFEN
- ERGEBNISSE DER EMPIRISCHEN UNTERSUCHUNG
- SITUATION DER KONVERSIONSFLUGHÄFEN
- PERSPEKTIVEN FÜR DIE WEITERE ENTWICKLUNG
- SITUATION DES REGIONALFLUGHAFENS KASSEL/CALDEN
- CHRONOLOGIE
- ARGUMENTE FÜR EINEN AUSGEBAUTEN FLUGHAFEN KASSEL/CALDEN
- Verkehrsverlagerung von Frankfurt nach Kassel/Calden
- Synergieeffekte bei einer Beteiligung des Flughafens Frankfurt
- Fluglärm als Argument Pro Regionalflughafen statt Kontra
- ZUSAMMENFASSENDE BETRACHTUNG
- RESÜMEE
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Diplomarbeit befasst sich mit der Frage, inwieweit Public Private Partnerships (PPP) als Instrument zur Privatisierung von Regionalflughäfen geeignet sind. Dabei werden die verschiedenen PPP-Varianten und ihre Anwendbarkeit auf den Flughafenbereich untersucht.
- Definition und Abgrenzung von PPP
- Gründe für die Privatisierung von Flughäfen
- PPP-Varianten und ihre Anwendbarkeit auf den Flughafenbereich
- Regulierungsaspekte und rechtliche Rahmenbedingungen
- Empirische Analyse von Privatisierungsprojekten
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in die Thematik und der Definition von Public Private Partnerships (PPP). Im zweiten Kapitel wird die Privatisierung von Flughäfen näher beleuchtet und die Gründe für die Privatisierung sowie die potenziellen Vorteile für Privatinvestoren aufgezeigt. Die verschiedenen PPP-Varianten und ihre Anwendbarkeit auf den Flughafenbereich werden im dritten Kapitel detailliert diskutiert.
Das vierte Kapitel befasst sich mit der Rolle von Flughäfen als natürliche Monopole und den damit verbundenen Regulierungsproblemen. Die Empfehlungen für einen optimalen Projekt- und Regulierungsrahmen werden im fünften Kapitel vorgestellt.
Das sechste Kapitel analysiert den aktuellen Stand der Privatisierung von Regionalflughäfen in Deutschland. Die Ergebnisse einer empirischen Untersuchung werden präsentiert und die Perspektiven für die weitere Entwicklung des Privatisierungsmodells werden diskutiert.
Im siebten Kapitel wird die Situation des Regionalflughafens Kassel/Calden näher beleuchtet. Die Argumente für einen Ausbau des Flughafens werden analysiert und die Bedeutung des Regionalflughafens für die Region Kassel/Calden wird bewertet.
Schlüsselwörter
Public Private Partnerships, Privatisierung, Regionalflughäfen, Flughafenwirtschaft, Regulierung, natürliche Monopole, Empirische Analyse, Kassel/Calden
Häufig gestellte Fragen
Was ist eine Public Private Partnership (PPP)?
PPP bezeichnet die langfristig angelegte Zusammenarbeit zwischen der öffentlichen Hand und privaten Unternehmen zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben, hier dem Ausbau von Flughäfen.
Warum ist die Privatisierung von Regionalflughäfen ein Thema?
Angesichts leerer öffentlicher Kassen und steigendem Luftverkehrsaufkommen suchen Kommunen nach privaten Investoren für Infrastrukturmaßnahmen.
Warum gelten Flughäfen als „natürliche Monopole“?
Aufgrund hoher Fixkosten und fehlender direkter Konkurrenz in einer Region haben Flughäfen oft eine marktbeherrschende Stellung, was Regulierungsbedarf nach sich zieht.
Welche Rolle spielt der Flughafen Kassel/Calden in der Arbeit?
Kassel/Calden dient als Fallbeispiel, um die Argumente für den Ausbau (Verkehrsverlagerung, Synergieeffekte) und die wirtschaftlichen Perspektiven zu analysieren.
Was ist das Principal-Agent-Problem in diesem Kontext?
Es beschreibt Informationsasymmetrien zwischen dem Staat (Principal) und dem privaten Betreiber (Agent), die durch vertragliche Gestaltung minimiert werden müssen.
Welche Erwartungen werden an PPP-Modelle geknüpft?
Man erhofft sich mehr Effizienz, schnellere Umsetzung von Bauprojekten und eine Entlastung des staatlichen Haushalts.
- Quote paper
- Martin Wienand (Author), 2004, Public Private Partnership als Instrument der Privatisierung von Regionalflughäfen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/26932