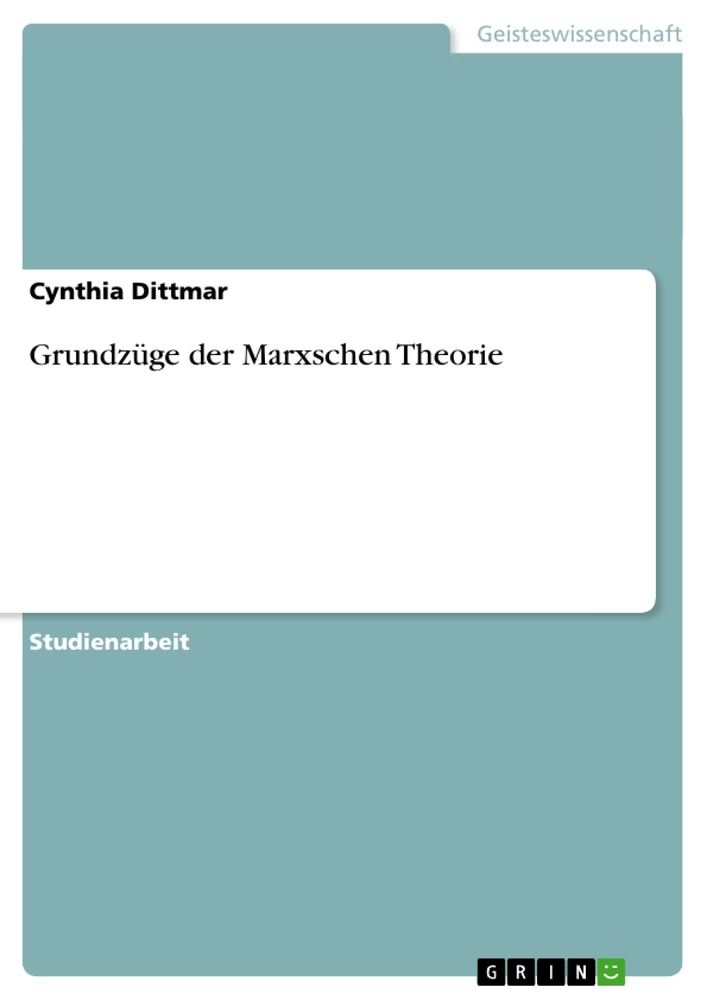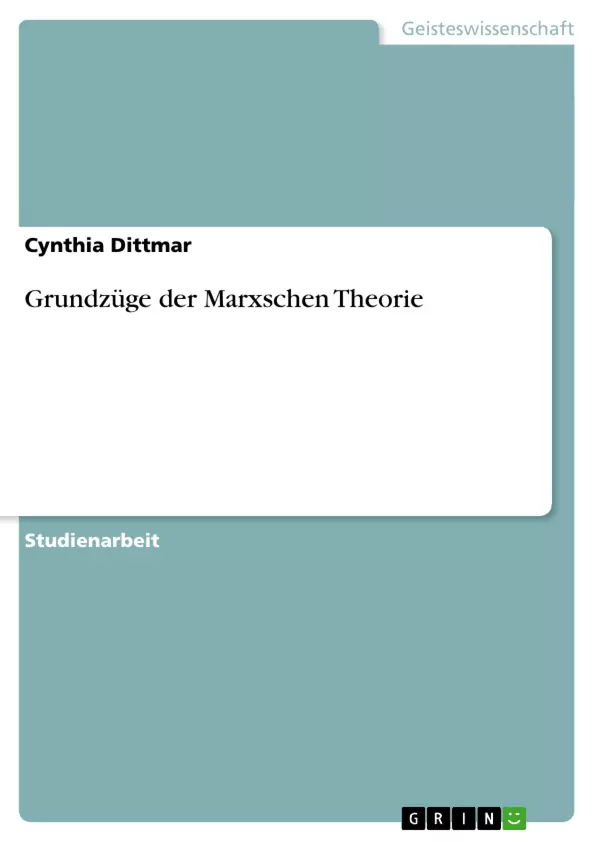Diese Arbeit ‘Grundzüge der Marxschen Theorie’ beschäftigt sich mit einer kleinen
Auswahl der Theorie von Karl Marx. Zentrales Anliegen ist es, darzustellen mit welchen
philosophischen, theoretischen und ökonomischen Argumenten Marx das kommende
Scheitern des Kapitalismus begründete.
Nach der kurzen Darstellung seiner Biographie wird auf die philosophischen Grundannahmen
über die Entwicklung von Gesellschaften der Marxschen Theorie, dem historischen
Materialismus und der materialistischen Dialektik, eingegangen. Anhand der
Gesellschaftsformen wird dies anschaulicher dargestellt. Auf die Funktionsweise des
Kapitalismus und seine negativen Auswirkungen auf einen Großteil der Bevölkerung
wird hier besonderes Augenmerk gelegt. Im Anschluss wird die Marxsche
Klassentheorie und Marx’ Verständnis vom Klassenkampf dargestellt. Im Schluss wird
Bezug auf die aktuelle Lage genommen. Karl Heinrich Marx wurde am 5.5.1818 in Trier als Sohn des protestantischen, vormals
jüdischen Rechtsanwaltes Heinrich Marx geboren. Ab 1835 studierte Karl Marx Jura,
Philosophie und Geschichte in Bonn und Berlin. Er promovierte 1841 über die
Philosophie Georg Wilhelm Friedrich Hegels und verfasste im gleichen Jahr das
Manuskript „Kritik der hegelschen Staatsphilosophie“.1 Die Auseinandersetzung mit
Hegel hatte großen Einfluss, insbesondere auf den jungen Marx, der sich noch stark der
Philosophie widmete. Doch „die Philosophen haben die Welt immer nur verschieden
interpretiert, es kommt darauf an, sie zu verändern“2 formuliert er 1846 in den Thesen
über Feuerbach und fordert eine revolutionäre Praxis.3
Bereits 1842 setzte er seine revolutionären Überzeugungen zunächst als Mitarbeiter
und später auch als Chefredakteur bei der neugegründeten liberalen „Rheinische
Zeitung“, die bald zu einer wichtigen Stimme der deutschen Opposition avancierte, um.
Durch die enge Berührung mit dem wirtschaftlichen und politischen Tagesgeschehen
fühlte sich Marx durch die kommunistischen Lehren angezogen. [...]
1 vgl. Korte 1992, S. 43
2 Marx, „Thesen über Feuerbach“ in Borkenau 1956, S. 41
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Biographie
- Historischer Materialismus
- Die Produktionsweise als ökonomische Basis
- Dialektische Entwicklung von Gesellschaften
- Gesellschaftsformationen
- Von der Urgesellschaft zum Feudalismus
- Der Kapitalismus
- Bewegungsgesetze des Kapitalismus
- Verelendung
- Entfremdung
- Klassen und Klassenkampf
- Schlusswort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit "Grundzüge der Marxschen Theorie" befasst sich mit ausgewählten Aspekten der Theorie von Karl Marx. Das zentrale Ziel ist es, die philosophischen, theoretischen und ökonomischen Argumente aufzuzeigen, mit denen Marx das Scheitern des Kapitalismus prophezeite.
- Die philosophischen Grundlagen der Marxschen Gesellschaftstheorie
- Der historische Materialismus und die materialistische Dialektik
- Die Funktionsweise des Kapitalismus und seine negativen Auswirkungen
- Die Marxsche Klassentheorie und das Konzept des Klassenkampfes
- Die Anwendung der Marxschen Theorie auf die aktuelle Situation
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Diese Einleitung präsentiert die Zielsetzung und den Aufbau der Arbeit, wobei der Fokus auf die Kritik des Kapitalismus durch Marx gelegt wird.
- Biographie: Dieses Kapitel beleuchtet die wichtigsten Stationen im Leben von Karl Marx, von seinem Studium und seiner frühen philosophischen Auseinandersetzung mit Hegel bis zu seinem politischen Engagement und seiner Arbeit an den Grundlagen der politischen Ökonomie.
- Historischer Materialismus: Dieses Kapitel behandelt die materialistische Geschichtsauffassung von Marx. Es wird die zentrale Bedeutung der Produktionsweise als Grundlage gesellschaftlicher Entwicklung und die dialektische Natur des gesellschaftlichen Wandels erläutert.
- Gesellschaftsformationen: Dieses Kapitel setzt sich mit der Entwicklung verschiedener Gesellschaftsformationen auseinander, beginnend mit der Urgesellschaft und dem Feudalismus, und legt den Schwerpunkt auf die Analyse des Kapitalismus.
- Klassen und Klassenkampf: Dieses Kapitel stellt die zentrale Rolle der Klassen im gesellschaftlichen System dar und beleuchtet die Konflikte und den Kampf zwischen den Klassen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den zentralen Themen der Marxschen Theorie, darunter der historische Materialismus, die Kritik des Kapitalismus, die Analyse von Klassen und Klassenkampf, die Entfremdung und Verelendung der Arbeiterklasse sowie die dialektische Methode.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der historische Materialismus?
Es ist Marx' philosophische Grundannahme, dass die ökonomische Basis (Produktionsweise) die Entwicklung der Gesellschaft und deren Überbau (Recht, Politik, Kultur) bestimmt.
Warum prophezeite Marx das Scheitern des Kapitalismus?
Marx argumentierte mit den inneren Widersprüchen des Systems, die zu Krisen, Verelendung der Arbeiterklasse und schließlich zur revolutionären Überwindung führen würden.
Was bedeutet "Entfremdung" in der Marxschen Theorie?
Im Kapitalismus entfremdet sich der Arbeiter von seinem Produkt, seiner Tätigkeit, seinem Gattungswesen und seinen Mitmenschen.
Welche Rolle spielt der Klassenkampf?
Der Klassenkampf zwischen Bourgeoisie (Besitzende) und Proletariat (Lohnabhängige) ist laut Marx der Motor der Geschichte, der den Übergang zu neuen Gesellschaftsformen erzwingt.
Wie beeinflusste Hegel das Werk von Karl Marx?
Marx übernahm Hegels Methode der Dialektik, stellte sie aber „vom Kopf auf die Füße“, indem er sie materiell statt idealistisch begründete.
- Quote paper
- Cynthia Dittmar (Author), 2003, Grundzüge der Marxschen Theorie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/26934