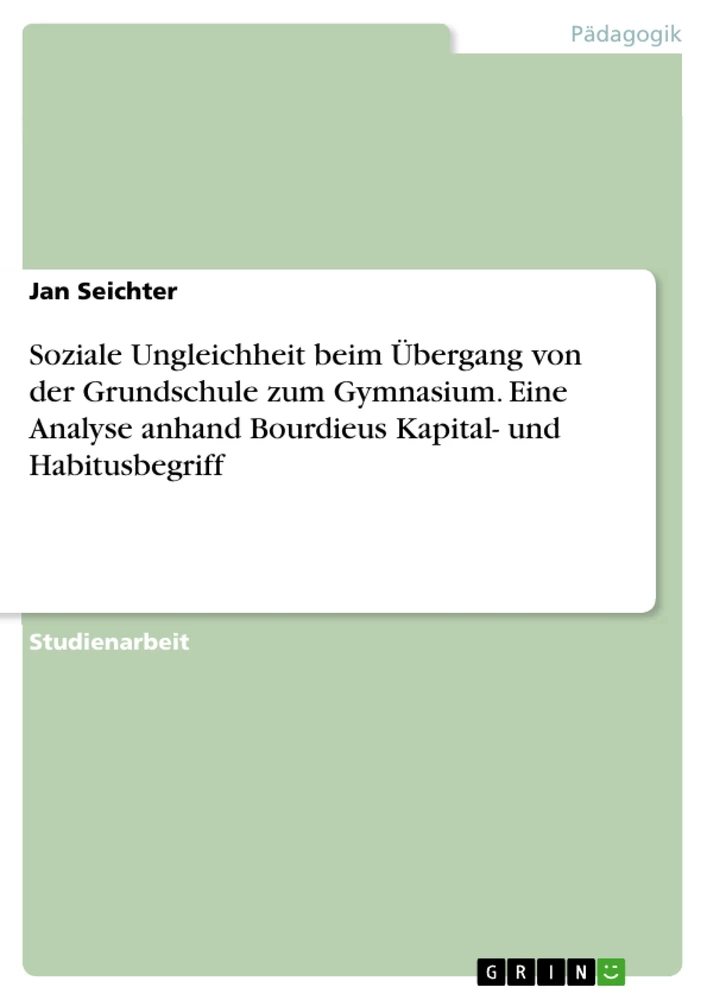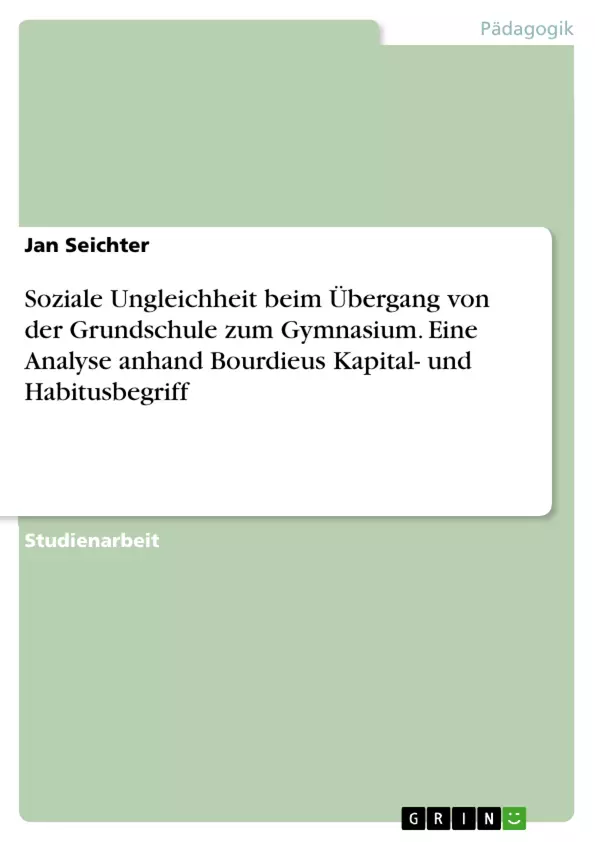Eine Möglichkeit Ungleichheitsstrukturen zu erklären, ist Pierre Bourdieus Modell verschiedener Kapitalarten, die gesellschaftliches Handeln und gesellschaftliche Teilnahme beeinflussen sowie den Habitus eines Menschen maßgeblich mit bedingen. Da die Thematik der sozial bedingten Ungleichheit in schulischen Strukturen auch in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung gewonnen hat, soll diese Arbeit dazu einen Beitrag leisten, indem diese Ungleichheit anhand von Bourdieus Erklärungsmodell zu einem bestimmten Zeitpunkt der Bildungskarriere analysiert wird. Die zugrundeliegende Fragestellung diesbezüglich lautet: Wie lassen sich mithilfe von Bourdieus Kapital- und Habitusbegriff die Beeinflussung des Übergangs von der Grundschule zum Gymnasien durch soziale Ungleichheiten erklären?
Der Schwerpunkt der Arbeit liegt auf dem Gymnasium, weil es die am stärksten besuchte Schulform der Sekundarstufe I darstellt und für eine vollwertige Teilhabe an der Gesellschaft immer mehr als selbstverständlich angesehen wird. Der Übergang von der Grundschule zur Sekundarstufe I wird dabei maßgeblich von sozialen Herkunftsbedingungen beeinflusst. Zu diesem Zweck soll zunächst die theoretische Basis für eine analytische Betrachtung gelegt werden, indem die Wahl des Betrachtungszeitpunktes kurz genauer erläutert wird und anschließend Bourdieus Konzepte des sozialen, ökonomischen und kulturellen Kapitals, des Habitus sowie des sozialen Feldes betrachtet werden. Um einen besseren Lesefluss zu gewährleisten werden keine geschlechtergetrennten Bezeichnungen für Personen gebraucht. Alle verwendeten Bezeichnungen verstehen sich stattdessen als geschlechtsneutral und umfassen sowohl weibliche als auch männliche Personen.
Als literarische Grundlage dieser Arbeit dienen vor allem Bourdieus Werke zu seiner Theorie, die dazu vorliegenden Erläuterungen von Jurt und Fröhlich sowie der einschlägige Aufsatz von Maaz, Baumert und Trautwein als maßgebliche Grundlage der Betrachtung der sozialen Ungleichheit.
Diese Arbeit reiht sich damit in das Feld der soziologischer Betrachtungen von Bildungsverläufen, der sozialen Ungleichheit und ihrer Auswirkungen sowie in die gerade in letzter Zeit wieder stark in den Vordergrund getretene Debatte der Chancengleichheit ein und bewegt sich demnach in einem äußerst politisch aufgeladenen Zusammenhang.
Gliederung
1. Einleitung
2. Theoretische Basis
2.1 Ungleichheitsmarkscheide am Übergang zum Gymnasium
2.2 Ungleichheitserklärungsmodell nach Bourdieu
3. Analyse der sozialen Ungleichheitsstruktur am Übergang zum Gymnasium
4. Fazit
5. Literaturverzeichnis
6. Anhang
- Quote paper
- Jan Seichter (Author), 2013, Soziale Ungleichheit beim Übergang von der Grundschule zum Gymnasium. Eine Analyse anhand Bourdieus Kapital- und Habitusbegriff, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/269444