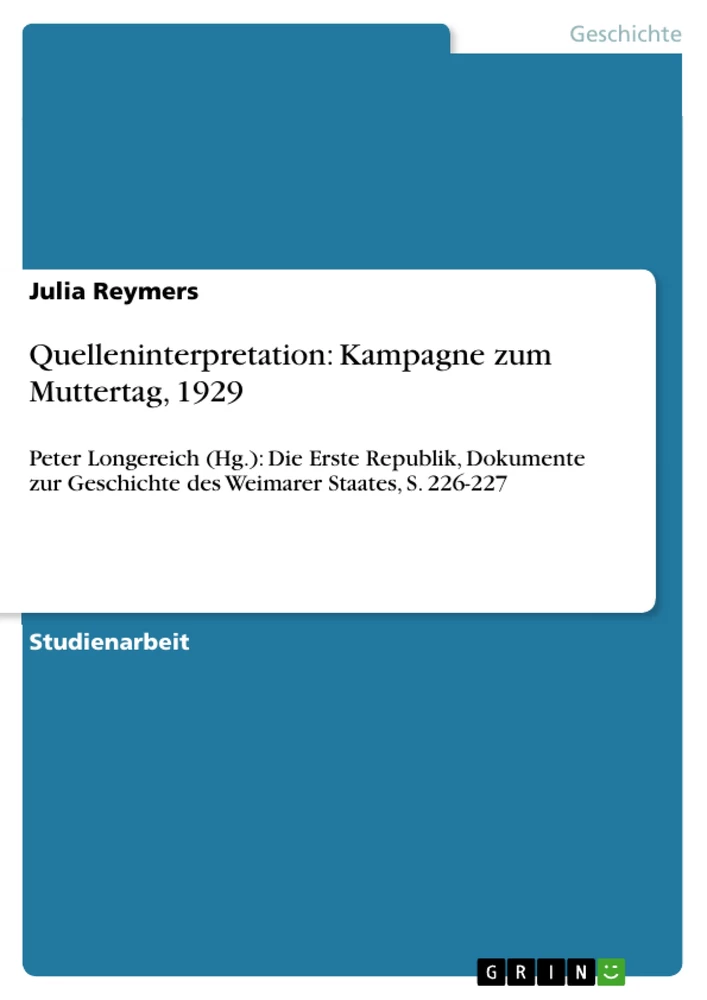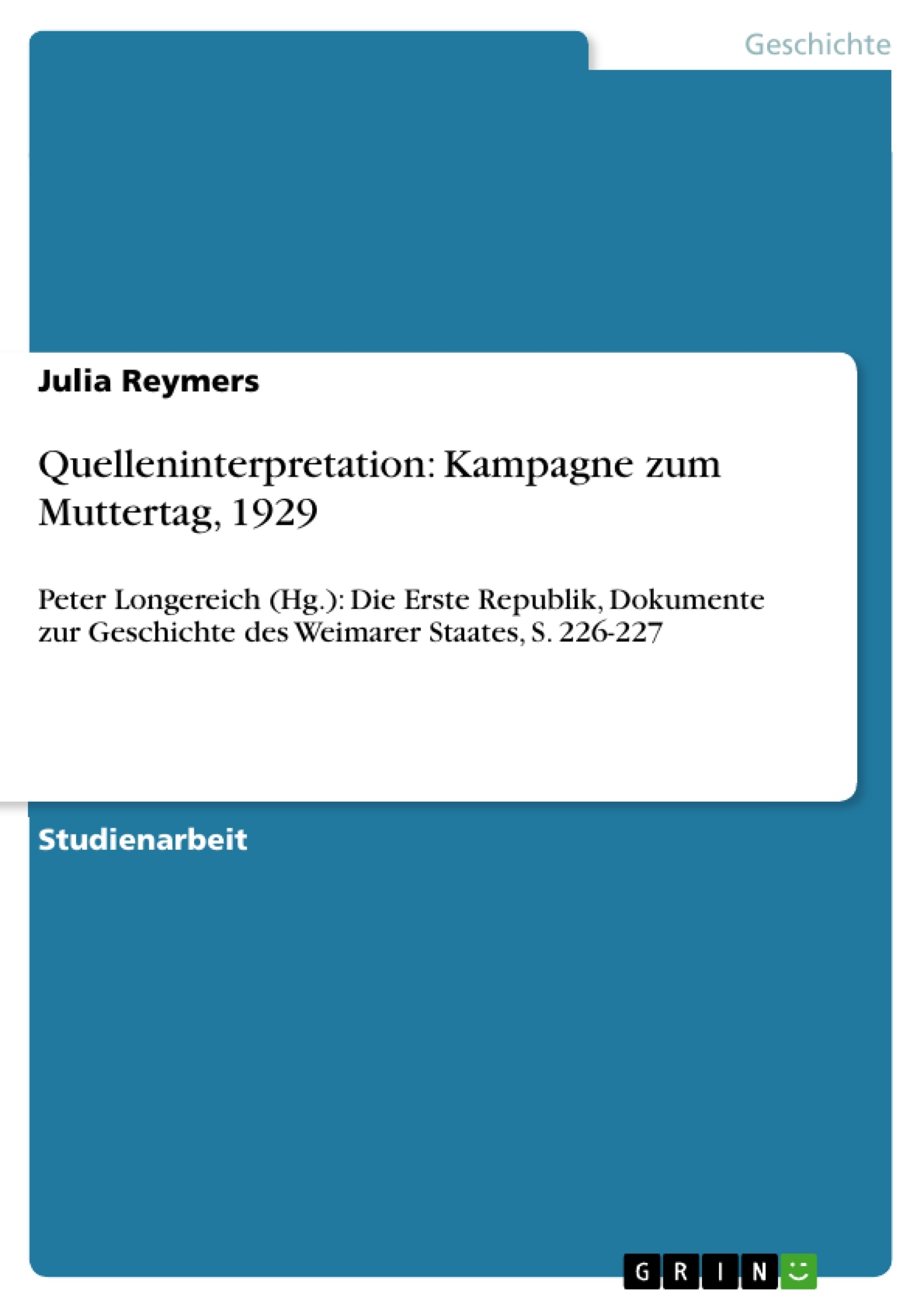Auch heutzutage beschenken wir unsere Mütter am zweiten Sonntag im Mai mit Blumen, ohne uns über den Ursprung dieser Tradition im Klaren zu sein. Welche Ziele die Muttertagspropaganda in der Weimarer Republik verfolgte und welches Frauenbild sich daraus ableiten lässt, möchte ich mit meiner Hausarbeit am Beispiel der Quelle „Kampagne zur Begehung des Muttertages 1929“ aufzeigen.
1. Einleitung
„ Zum siebten Mal ehrte München am zweiten Maisonntag die Mütter. Am Samstagnachmittag sah man viele mit Blumen und anderen Geschenken für die Mutter heimw ä rts eilen. [Der] Verband deutscher Blumengesch ä ftsinhaber bereitete wieder den alleinstehenden armen alten Müttern [ … ] durch Blumenspenden herrliche Freude. “ 1
Dieser Ausschnitt aus dem Bericht der Münchener Stadtchronik vom 12.Mai 1929 zeigt, dass der Muttertag schon in der Weimarer Republik ein inoffizieller Feiertag war, der sich einer zunehmenden Beliebtheit erfreute. Auch heutzutage beschenken wir unsere Mütter am zweiten Sonntag im Mai mit Blumen, ohne uns über den Ursprung dieser Tradition im Klaren zu sein. Welche Ziele die Muttertagspropaganda in der Weimarer Republik verfolgte und welches Frauenbild sich daraus ableiten lässt, möchte ich mit meiner Hausarbeit am Beispiel der Quelle „Kampagne zur Begehung des Muttertages 1929“2 aufzeigen.
2. Hauptteil
2.1 Inhaltsangabe der Quelle
In dem 1929 vom „Vorbereitenden Ausschuß zur Begehung des Muttertages“ veröffentlichten Aufruf „Kampagne zur Begehung des Muttertages“ wird der Muttertag als politisch neutrale Idee angepriesen, die zur Schlichtung des Parteien- und Konfessionenstreites beitragen und das Ansehen der Mütter und des Familienlebens stärken soll.
Die Quelle ist in drei wesentliche Abschnitte einzuteilen: Im ersten Teil (Z.1-17) wird die fehlende Wertschätzung der Frauen und Mütter in der Gegenwart beklagt und als Abhilfe eine strenge, ehrfurchtvermittelnde Erziehung der Kinder gefordert. Der zweite Teil (Z.18-28) bezieht sich auf die politische Situation: Der Ausschuß sieht in der Neutralität des Muttertages das Potential, den Streit der Parteien und Konfessionen zu besänftigen. Im letzten Abschnitt (Z.29-46) wird an alle Frauen appelliert, gegen die Auflösung des Familienlebens zu kämpfen, indem sie möglichst viele Kinder gebären.
2.2 Historischer Kontext
Die Wurzeln des Muttertages sind auf die Amerikanerin Ann Jarvis zurückzuführen, die sich dazu entschieden hatte, ihr ganzes Leben ihrer 1905 verstorbenen Mutter zu widmen.3 1907 organisierte sie die ersten „Mother’s day“-Feiern und propagierte ihre Idee so erfolgreich, dass mit dem „Mother’s day bill“ von 1914 der Muttertag zum amerikanischen Staatsfeiertag erklärt wurde.4 In Deutschland wurde der Muttertag zum ersten Mal 1923 von dem „Verband Deutscher Blumengeschäftsinhaber“ beworben. Ziel war es „im Volk die Meinung fest[zu]wurzeln, daß Muttertag und Blumengabe ein einheitlicher Begriff seien“.5 Rudolf Knauer, der Geschäftsführer des Verbandes, wollte jedoch den Muttertag von einer „gemeinnützigen Gesellschaft als neutraler Stelle verbreiten […] lassen“6, um die geschäftlichen Interessen des Verbandes zu verschleiern. Besonders bemühte sich Knauer um die Unterstützung der „Arbeitsgemeinschaft für Volksgesundung“7, die sich in „kirchlich- konservativen bis völkischen“8 Kreisen verortete. Die 1924 entstandene „Arbeitsgemeinschaft“ gehörte ursprünglich zur 1919 gegründeten „Volksgemeinschaft zur Wahrung von Anstand und Sitte“.9 Letztere hatte es als ihre Aufgabe formuliert, den Kampf „gegen Schmutz und Schund“ in den Medien und „gegen die Verwilderung des Sexuallebens“ aufzunehmen.10 Die „Arbeitsgemeinschaft“ sah sich als „öffentliche[s] Gewissen“11 und bestand aus mehreren Fachausschüssen, wie u.a. dem „Vorbereitenden Ausschuß für den Muttertag“.12 Dieser Ausschuß gab mehrere Schriften wie die mir vorliegende Quelle heraus, in denen der Muttertag und seine Gestaltung propagiert wurden. Diese Propaganda stieß in der Gesellschaft auf großes Interesse, da in der krisenhaften Nachkriegszeit eine erhöhte „Bereitschaft zur Betonung der Mütterlichkeit und Mutterehrung“13 vorhanden war. Um 1930 betrug die Geburtenrate nur noch 17.514, was vor allem durch Abtreibungen und Geburtenkontrolle begründen zu war15. Dazu stieg die Zahl der unehelich geborenen Kinder und der Ehescheidungen an. Witwen und alleinstehende Frauen waren auf Erwerbsarbeit angewiesen und konkurrierten mit Männern um die knappen Arbeitsplätze.16 Diese Situation verschärfte sich angesichts der Weltwirtschaftskrise 1929 dramatisch17. In dieser unsicheren Zeit sahen daher viele Menschen im Mutterdasein den „eigentlichen Beruf der Frau“18 und orientierten sich an traditionellen Wert des Familienlebens.
2.3 Die Ziele und das Frauenbild der Muttertagspropaganda
Im Folgenden möchte ich darlegen, welche Ziele der „Vorbereitende Ausschuß für den Deutschen Muttertag“ mit der Muttertagskampagne verfolgte und welches Frauenbild sich daraus ableiten lässt.
Gleich in den ersten Sätzen des Aufrufes stellt der Ausschuß sein zentrales Ziel heraus: Der Muttertag mit seiner „starke[n] aufbauenden Kraft“ soll den „mannigfachen Verfallserscheinungen der Gegenwart“ entgegenwirken (S.226). In dieser „suchenden und irrenden Zeit“ sei insbesondere das „Schwinden der Ehrfurcht“ und die „Geringschätzung“ gegenüber der „Hausfrau und Mutter“ ein ernstzunehmendes Problem (S.226). Ich nehme an, dass der Ausschuß in der „starken aufbauenden Kraft“ des Muttertags eine vorwiegend symbolische Kraft sieht: Durch die Ehrung der Frauen soll die in der Öffentlichkeit bereits vorhandene „Bereitschaft zur Betonung der Mütterlichkeit und Mutterehrung“19 stilisiert und ritualisiert werden. Es ist allerdings nicht der Muttertag an sich, sondern die Mutter selber, von der sich der Ausschuss eine Lösung der gesellschaftlichen Probleme verspricht: Die Mutter als „Seele des Hauses“ beeinflusse mit ihrer „Grundeinstellung“ die Familie und könne ihre Kinder zu „starken[n] Charaktere[n]“ erziehen, die „dienstwillig“ und ehrfürchtig seien (S.226). Die Mutter wird hier als „Hüterin des Familienlebens“20 dargestellt, die durch ihre Erziehung die heranwachsende Generation und somit die Gesellschaft beeinflusst.
Einen unerwarteten „Gedankensprung“ nimmt die Quelle, wenn der Ausschuß den Muttertag mit der Parteienzersplitterung der Weimarer Republik in Bezug setzt: Deutlich wird der „Verfall [der] Volksgemeinschaft in einzelne Parteien“ und der „Haß […] im traurigen Bruderkampf“ beklagt, dem der Muttertag als „überparteiliche“ und „neutrale Gedankenmacht“ entgegenwirken soll (S.226). Der Ausschuß erkennt die „ethische Grundkategorie“21
[...]
1 Bericht aus der Münchener Stadtchronik vom 12. Mai 1929 (http://www.muenchen.de/Rathaus/dir/stadtarchiv/chronik/1929/81269/1929.html), entnommen aus dem Internet am 15.02.2010
2 Peter Longereich (Hg.): Die Erste Republik, Dokumente zur Geschichte des Weimarer Staates, S. 226-227.
3 Vgl. Matter, Max: Entpolitisierung durch Emotionalisierung. Deutscher Muttertag - Tag der Deutschen Mutter - Muttertag, in: Symbole der Politik. Politik der Symbole, hg. v. Rüdiger Voigt, Opladen 1989, S. 124
4 Vgl. Weyrather, Irmgard: Muttertag und Mutterkreuz. Der Kult um die „deutsche Mutter“ im Nationalsozialismus, Frankfurt am Main 2003, S.18
5 Verbandszeitung Deutscher Blumengeschäftsinhaber (=VDB), 13.4.28, S.349f, zit. nach: Hausen, Karin: Mütter zwischen Geschäftsinteressen und kultischer Verehrung. Der „Deutsche Muttertag“ in der Weimarer Republik, in: Sozialgeschichte der Freizeit, hg. v. Gerhard Huck, Wuppertal 1980, S. 255
6 VDB, 20.3. 1923, S.68, zit. nach: Hausen (1980), S. 253
7 Matter, S. 125
8 Hausen (1980), S. 261
9 Hausen (1980), S. 259
10 Vgl. die Hefte der „Schriften zur Volksgesundung“ 1926-1932, zit. nach: Hausen (1980), S. 259
11 Vgl. den Tätigkeitsbericht der „Arbeitsgemeinschaft“ 1926, zit. nach: Hausen (1980), S. 260
12 Hausen (1980), S. 260
13 Matter, S. 126
14 Statistisches Jahrbuch für Preußen 30 (1934), zit. nach: Mouton, Michelle: From nurturing the nation to purifying the Volk. Weimar and Nazi family policy, 1918-1945, Wisconsin 2007, S.109
15 Vgl. Weyrather, S. 22
16 Vgl. Matter, S.128
17 Vgl. Schildt, Axel: Die Republik von Weimar. Deutschland zwischen Kaiserreich und „Drittem Reich“, Erfurt 2009, S. 124: Im Sommer 1929 gab es bereits 3,4 Millionen Arbeitslose in Deutschland.
18 Matter, S. 129
19 Matter, S. 126
20 Matter, S. 129
21 Matter, S. 127
- Citar trabajo
- Julia Reymers (Autor), 2009, Quelleninterpretation: Kampagne zum Muttertag, 1929, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/269461