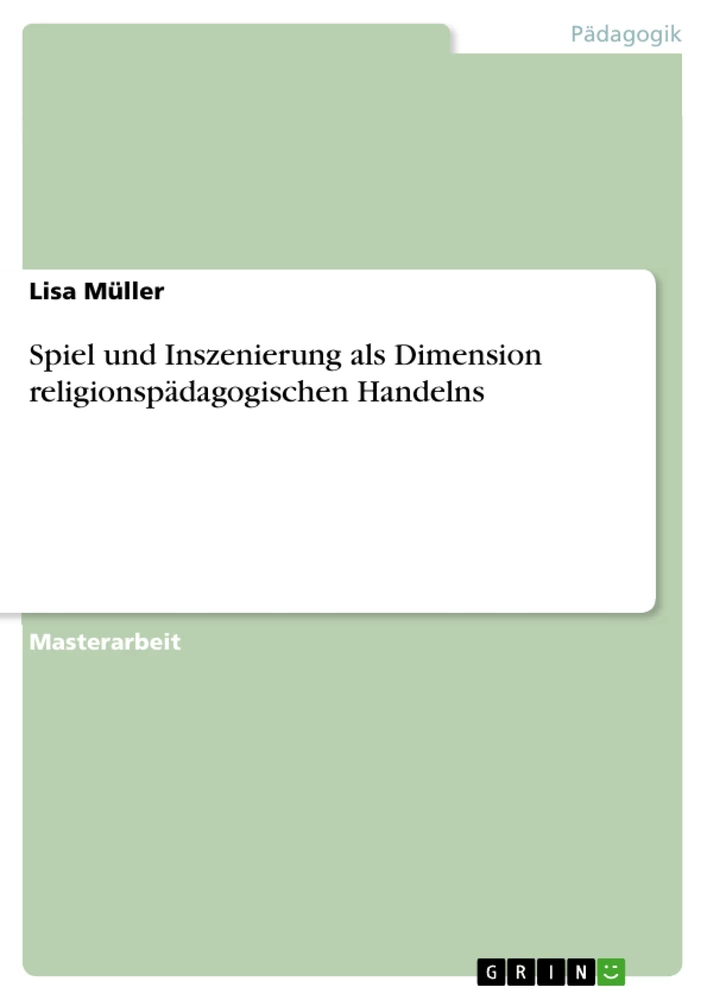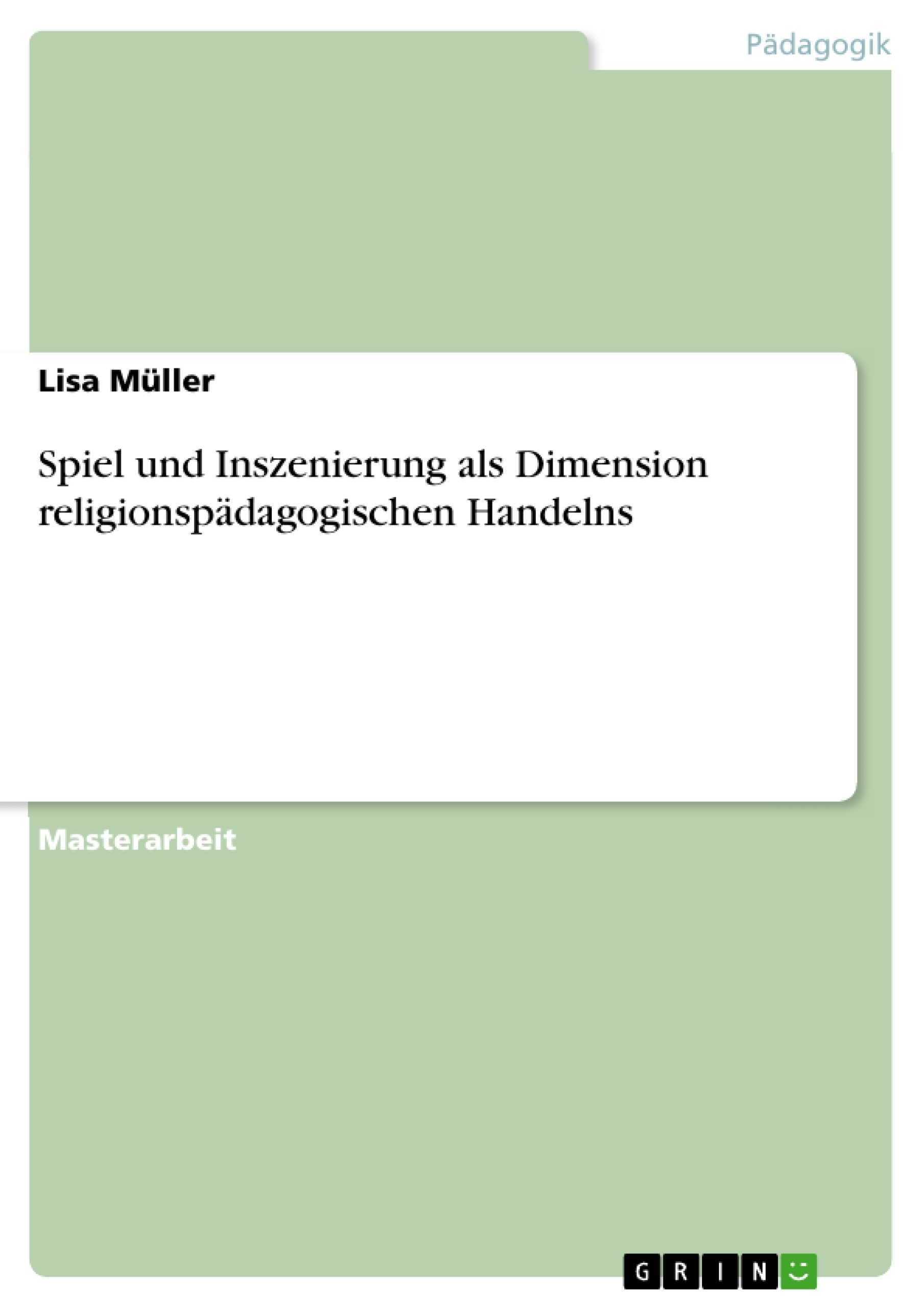Wie kann Religion heute noch Kindern und Jugendlichen im Religionsunterricht vermittelt werden, wenn deren Beziehung zu Religion eher befremdlich ist und sie Religion als etwas Altes und Unmodernes ansehen? Jugendlichen muss die Möglichkeit gegeben werden Religion zu erfahren, zu erleben und ihren eigenen Standpunkt, ihren eigenen Glauben zu finden. Jugendliche sind darauf angewiesen, dass sich ihnen Religion kenntlich macht. Der Religionsunterricht hat die Aufgabe, die SuS mit Religion bekannt zu machen und Kontakt anzubahnen.Die Schule als Lernort ist Ort unmittelbarer Erfahrungen und aktueller Lebensumstände. Ein großer Teil der aktuellen Lebenswelt der SuS spielt sich in der Schule ab. Hier finden positive Erlebnisse statt, wie gute Noten oder wachsende Kenntnisse und anwendungsbereites Können, ebenso das Treffen mit den Freunden oder das Leben ohne die Eltern, aber auch negative Erfahrungen bezüglich des Lernverhaltens und der sozialen Beziehungen der SuS, die eben auch geprägt sein können von Enttäuschung, Abweisung und Wut. In diesem Ort voller Emotionen, Gedanken und Erfahrungen kann Religion ausprobiert und verinnerlicht werden. Im Religionsunterricht bekommen diese Emotionen und Erlebnisse Raum, um sich zu äußern und auszudrücken.Da der Gegenstand dieser Arbeit das Spiel und die Inszenierung als Dimension religionspädagogischen Handelns ist, soll im ersten Teil anhand der performativen Religionsdidaktik untersucht werden, wie Religion sich angeeignet und gelernt werden kann. Das Psychodrama als Spiel- und Inszenierungsverfahren soll Grundlage dieser Arbeit sein. Im Psychodrama wird versucht, Dimensionen emotionaler Konflikte oder unausgesprochener Ängste und Irritationen im Spiel darzustellen. Vor allem bei Kindern und Jugendlichen ist das Verfahren des Psychodramas, das das Handeln vor das Reden stellt, eine effektive Methode, um innere Konflikte zu lösen sowie soziale Kompetenzen und individuelle Fähigkeiten zu fördern und zu stärken. Dass Verbindungen und Gemeinsamkeiten zwischen dem philosophischen Hintergrund des Psychodramas und der Theorie der performativen Religionsdidaktik bestehen, ist leicht zu erkennen. Hier stellt sich jedoch die Frage, ob das Psychodrama lediglich als ähnliches ´Verfahren` angesehen werden kann oder eben doch als eine Fortführung der performativen Religionsdidaktik.Im zweiten Teil dieser Arbeit steht das Psychodrama als Verfahren mit seinen Grundlagen im Mittelpunkt.
INHALTSVERZEICHNIS
0 Einleitung
I Religionspädagogisches Lernen
1 Aneignung von Religion
2 Grundlinien performativer Religionsdidaktik
2.1 Einführung in die performative Religionsdidaktik
2.2 Performative Religionsdidaktik nach Rudolf Englert
2.3 Ansätze zu performativer Religionsdidaktik
2.4 Lernen in Szenen
2.5 Grundlagen der Performanz und der philosophische Hintergrund des Psychodramas im Vergleich
2.5.1 Die Bedeutung des Körpers
2.5.2 Die Bedeutung des Raumes
2.5.3 Die Bedeutung des Ausdrucksmittels Sprache
2.5.4 Die Bedeutung der Liturgie
2.5.5 Die Bedeutung des Lernraumes Text
2.5.6 Die Bedeutung der Kunst
2.6 Der Zusammenhang von Lerngehalt und Lernhandlungen
II Das Psychodrama
1 Theoretische Grundlagen des Psychodramas
1.1 Die Begegnung als wesentlicher Begriff des Psychodramas
1.2 Der Mensch als Teil des Kosmos
1.3 Morenos Rollentheorie
1.3.1 Die Rolle
1.3.2 Das Soziale Atom
2 Das Psychodramaverfahren
2.1 Die fünf Grundelemente des Psychodramas
2.1.1 Die Bühne
2.1.2 Der Protagonist
2.1.3 Der Leiter
2.1.4 Das Hilfs-Ich
2.1.5 Die Gruppe
2.2 Die Gestaltung des Psychodramaprozesses
2.2.1 Erwärmungsphase und Soziometrie
2.2.2 Aktionsphase
2.2.3 Integrationsphase
2.2.3.1 Sharing
2.2.3.2 Rollenfeedback
2.2.4 Auswertungs- und Vertiefungsphase
2.3 Psychodramatische Handlungstechniken
2.3.1 Rollentausch
2.3.2 Doppeln
2.3.3 Spiegeln
2.4 Das psychodramatische Gruppenspiel
2.4.1 Besonderheiten des Gruppenspiels
2.4.2 Psychodramatische Arrangements
2.4.2.1 Längere psychodramatische Arrangements
2.4.2.1.1 Stegreifspiel
2.4.2.1.2 Bibliodrama und Sagen-, Mythen-, Helden- und Märchenspiel
2.4.2.1.3 Axiodrama
2.4.2.2 Kürzere psychodramatische Arrangements
2.4.2.2.1 Standbild
2.4.2.2.2 Vignette
2.4.2.2.3 Szenische Bilder
2.4.2.2.4 Triade
2.4.2.2.5 Axionssoziometrische Arrangement
3 Die Realitäten im psychodramatischen Spiel
3.1 Verschiedene Realitätsräume
3.2 Das Psychodrama im intermediären Raum
III Psychodrama, Religion und Religionsunterricht
1 Zur Theorie des Religionsunterrichts
1.1 Das Menschenbild im Psychodrama und in der Religion
1.2 Der Andere
2 Biblische Texte im Psychodrama
2.1 Begriffe verständlich machen
2.2 Das Bibliodrama
3 Der intermediäre Raum in der Schule
4 Psychodrama-Lernen
4.1 Das Lernen in der Gruppe
4.2 Psychodrama und szenisches Verstehen
4.3 Psychodrama als Lernform
4.3.1 Das Psychodrama als Lernform im Religionsunterricht
4.3.2 Möglichkeiten und Chancen des Psychodramas als Lernform
4.3.3 Gefahren und Grenzen des Psychodramas als Lernform
IV Mein Erkenntnisgewinn - Das Psychodrama ist anspruchsvoll
Literaturverzeichnis
Häufig gestellte Fragen
Was ist performative Religionsdidaktik?
Ein Ansatz im Religionsunterricht, bei dem Religion nicht nur theoretisch besprochen, sondern durch Handeln, Erleben und Erproben (z.B. in Szenen) angeeignet wird.
Welche Rolle spielt das Psychodrama in der Religionspädagogik?
Das Psychodrama dient als Spiel- und Inszenierungsverfahren, um emotionale Konflikte oder religiöse Themen durch Handeln statt nur durch Reden darzustellen.
Was sind die Grundelemente eines Psychodramas?
Die fünf Elemente sind: die Bühne, der Protagonist, der Leiter (Therapeut/Lehrer), das Hilfs-Ich und die Gruppe.
Was ist ein Bibliodrama?
Eine spezifische Form des Psychodramas, bei der biblische Texte und Geschichten szenisch erarbeitet werden, um sie für die Teilnehmer erfahrbar zu machen.
Welche Vorteile bietet das Psychodrama für Jugendliche?
Es fördert soziale Kompetenzen, stärkt individuelle Fähigkeiten und hilft dabei, innere Konflikte und Ängste in einem geschützten Rahmen auszudrücken.
Gibt es Gefahren bei der Anwendung dieser Methode im Unterricht?
Ja, die Arbeit thematisiert auch Grenzen und Gefahren, wie etwa die emotionale Überforderung von Schülern oder die Notwendigkeit einer professionellen Leitung.
- Citation du texte
- Lisa Müller (Auteur), 2008, Spiel und Inszenierung als Dimension religionspädagogischen Handelns, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/269674