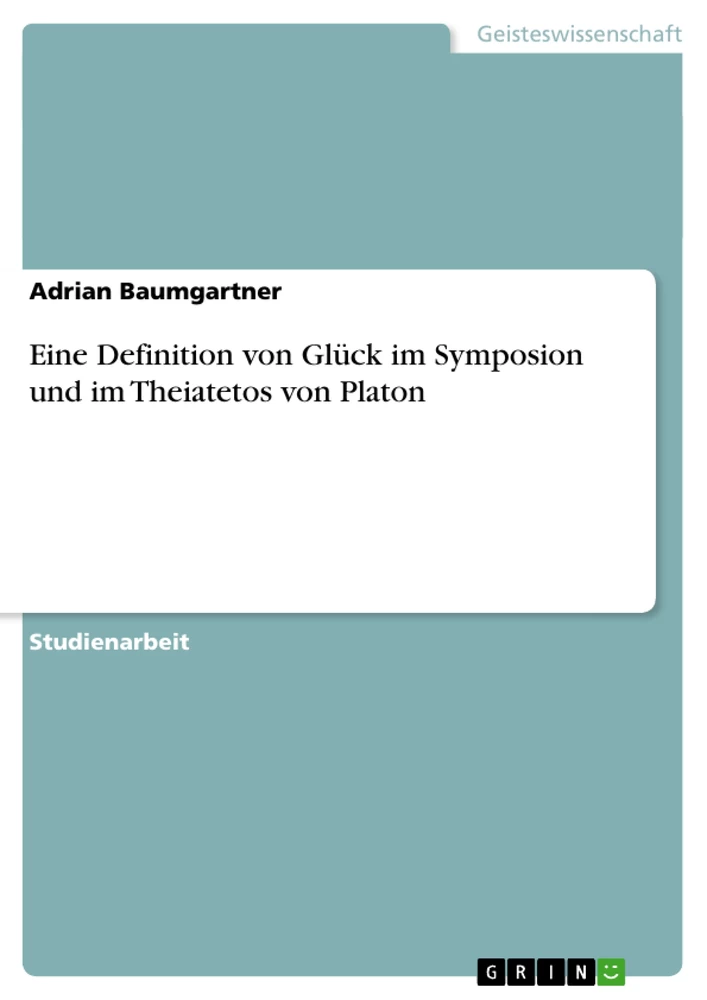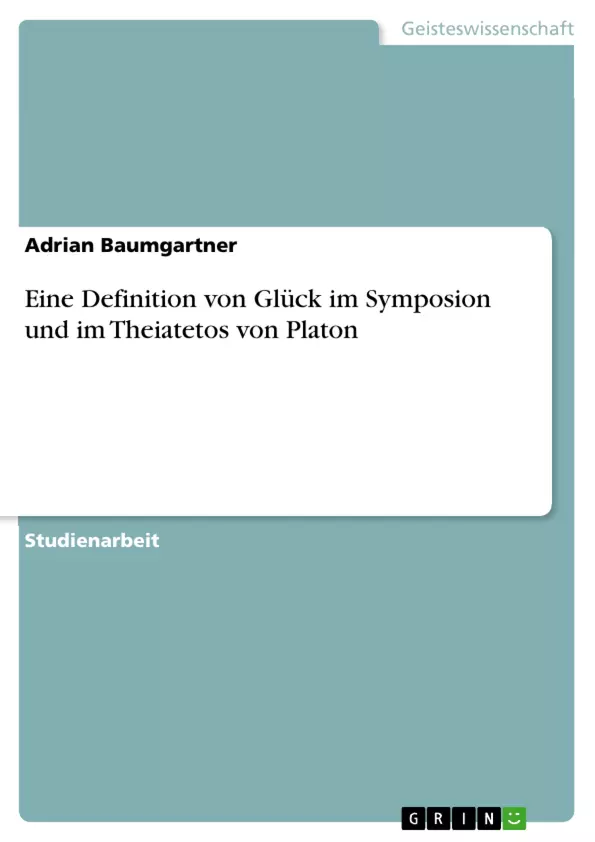In Platon „Symposion (gemeinsames, geselliges Trinken)“ halten einige Männer, vor allem die
Dichter Agathon und Aristophanes und Sokrates, aus der Athener Oberschicht Reden auf den
Eros. Die Rede des Sokrates, welche die Rede der Priesterin Diotima wiedergibt, bildet dabei
zunächst den Schluss. Doch dann kommt der betrunkene Alkibiades mit anderen Zechgenossen
und Flötenmädchen herein und lobt Sokrates in einer Rede. Die zentrale Stelle ist die Lobrede
Sokrates auf Eros.
Diotima ist die einzige weibliche Figur, die in einem platonischen Dialog zu Wort kommt. Sie
tritt aber nicht direkt auf, denn an dem Symposion, nimmt sie nicht teil. Sokrates berichtet von
einem Gespräch, in dem ihn Diotima über den Eros belehrt und ihn von ihrer Sichtweise
überzeugt. Sie war eine grosse Seherin und er hatte sie besucht, um ihre Weisheit zu empfangen,
als sie sich eine Weile in Athen aufhielt. Im Symposion rühmt er ihre Weisheit. Er gibt ihre
Äusserungen in direkter Rede wieder und identifiziert sich mit dem Inhalt, statt eine eigene
Theorie vorzutragen. Die Diotima-Rede bildet den philosophischen Höhepunkt des Gastmahls.
In seiner Wiedergabe des Gesprächs mit Diotima (Symposion 201d-212c) schildert Sokrates
zuerst das Wesen des Eros, dann sein Wirken. Dabei tritt er ihr gegenüber als Schüler auf. Indem
sie Fragen stellt, die ihm zu Erkenntnissen verhelfen sollen, übernimmt sie die maieutische Rolle,
die er sonst selbst in Platons Dialogen gegenüber seinen Gesprächspartnern spielt. Wo er
zugeben muss, keine Antwort zu wissen, enthüllt sie ihm die Wahrheit.
Inhaltsverzeichnis
- Teil 1 Ausschnitt aus dem Symposion
- Einleitung zum Symposion
- Übersetzung Plat. Smp. 204e-205a
- Grammatik- und Worterklärungen
- Persönliche Interpretation
- Aufbau des Abschnitts
- Teil 2 Ausschnitt aus Theätet (Ein Exkurs im Dialog)
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht Platons Konzeption von Glück, indem sie zwei zentrale Dialoge, das Symposion und den Theätet, analysiert. Der Fokus liegt auf der Interpretation der jeweiligen Textstellen und der Herausarbeitung der platonischen Philosophie zum Thema Glück.
- Platons Definition von Glück im Symposion
- Der Zusammenhang zwischen Glück und dem Guten bei Platon
- Die Rolle des Eros im Streben nach Glück
- Der Exkurs im Theätet und seine Relevanz für die Frage nach Glück und Gerechtigkeit
- Vergleich der Darstellung des Glücks in beiden Dialogen
Zusammenfassung der Kapitel
Teil 1 Ausschnitt aus dem Symposion: Dieser Abschnitt analysiert einen Textausschnitt aus Platons Symposion, in dem Sokrates, basierend auf Diotimas Ausführungen, Glück als das Erlangung des Guten beschreibt. Der Dialog zwischen Sokrates und Diotima verdeutlicht, dass das Streben nach dem Guten, und damit nach Glück, ein universelles menschliches Bedürfnis ist. Die genaue Analyse grammatischer und lexikalischer Aspekte des griechischen Originals unterstützt die Interpretation. Die persönliche Interpretation betont das Streben nach seelischer Harmonie und Lebensfreude als konstitutive Elemente des platonischen Glücksbegriffs. Der Aufbau des Dialogs, mit Sokrates als Fragesteller, wird ebenfalls beleuchtet.
Teil 2 Ausschnitt aus Theätet (Ein Exkurs im Dialog): Dieser Teil befasst sich mit einem Exkurs im Platonschen Dialog Theätet. Der Exkurs, dessen Funktion in der Forschung umstritten ist, wird als eine Kritik an der gesellschaftlichen Trennung von Gerechtigkeit und Nutzen interpretiert. Der Abschnitt diskutiert verschiedene wissenschaftliche Interpretationen des Exkurses, von der Einschätzung als „philosophisch ziemlich sinnlos“ bis zur Deutung als implizite Argumentation gegen Relativismus. Der Schwerpunkt liegt auf der ethischen Dimension des Exkurses und seinem Bezug zu den Begriffen Gerechtigkeit und Wissen. Die Bedeutung von Gerechtigkeit für das Glück wird diskutiert, wobei hervorgehoben wird, dass die Definition von Gerechtigkeit komplex und kontextabhängig ist und ihre Beziehung zum Glück nicht eindeutig geklärt ist. Der Abschnitt beinhaltet die Übersetzung und Analyse eines relevanten Textausschnitts aus dem Theätet (176a-e).
Schlüsselwörter
Platon, Symposion, Theätet, Glück (Eudaimonie), Eros, das Gute, Gerechtigkeit, Wissen (Gnosis), Unwissenheit (Agnoia), Seelische Harmonie, Relativismus, Ethik, Philosophie, Dialog, Interpretation.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu „Seminararbeit: Platons Konzeption von Glück“
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Diese Seminararbeit untersucht Platons Verständnis von Glück (Eudaimonie) anhand einer Analyse zweier zentraler Dialoge: des Symposions und des Theätets. Der Fokus liegt auf der Interpretation relevanter Textstellen und der Herausarbeitung der platonischen Philosophie zum Thema Glück.
Welche Textstellen werden im Detail analysiert?
Die Arbeit analysiert einen Textauszug aus Platons Symposion (204e-205a) und einen Exkurs im Theätet (176a-e). Die Analyse beinhaltet Übersetzungen, grammatische und lexikalische Erläuterungen sowie eine persönliche Interpretation der jeweiligen Textstellen.
Welche Themen werden in der Seminararbeit behandelt?
Die Arbeit beleuchtet Platons Definition von Glück im Symposion, den Zusammenhang zwischen Glück und dem Guten, die Rolle des Eros im Streben nach Glück, den Exkurs im Theätet und dessen Relevanz für die Frage nach Glück und Gerechtigkeit, sowie einen Vergleich der Darstellung des Glücks in beiden Dialogen. Es werden auch verschiedene wissenschaftliche Interpretationen des umstrittenen Exkurses im Theätet diskutiert.
Wie ist die Seminararbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in zwei Teile. Teil 1 analysiert den Textauszug aus dem Symposion, einschließlich Einleitung, Übersetzung, grammatikalischer und lexikalischer Erläuterungen, persönlicher Interpretation und einer Analyse des Text-Aufbaus. Teil 2 befasst sich mit dem Exkurs im Theätet, inklusive Übersetzung und Analyse, Diskussion verschiedener Interpretationen und der ethischen Dimension des Exkurses im Bezug auf Gerechtigkeit und Wissen.
Welche Schlüsselbegriffe sind zentral für die Arbeit?
Zentrale Schlüsselbegriffe sind Platon, Symposion, Theätet, Glück (Eudaimonie), Eros, das Gute, Gerechtigkeit, Wissen (Gnosis), Unwissenheit (Agnoia), seelische Harmonie, Relativismus, Ethik, Philosophie, Dialog und Interpretation.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Seminararbeit?
Die konkreten Schlussfolgerungen der Seminararbeit sind nicht direkt in diesem Überblick genannt. Die Arbeit zielt darauf ab, Platons Konzeption von Glück durch eine detaillierte Analyse der ausgewählten Textstellen zu verstehen und die verschiedenen Facetten dieses Begriffs in Platons Philosophie herauszuarbeiten, unter Berücksichtigung der komplexen Beziehung zwischen Glück, Gerechtigkeit und Wissen.
Für wen ist diese Seminararbeit gedacht?
Diese Seminararbeit ist für akademische Zwecke gedacht und richtet sich an Personen, die sich mit Platons Philosophie und insbesondere mit seinem Verständnis von Glück auseinandersetzen möchten.
- Arbeit zitieren
- Lic. theol. Adrian Baumgartner (Autor:in), 2012, Eine Definition von Glück im Symposion und im Theiatetos von Platon, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/269692