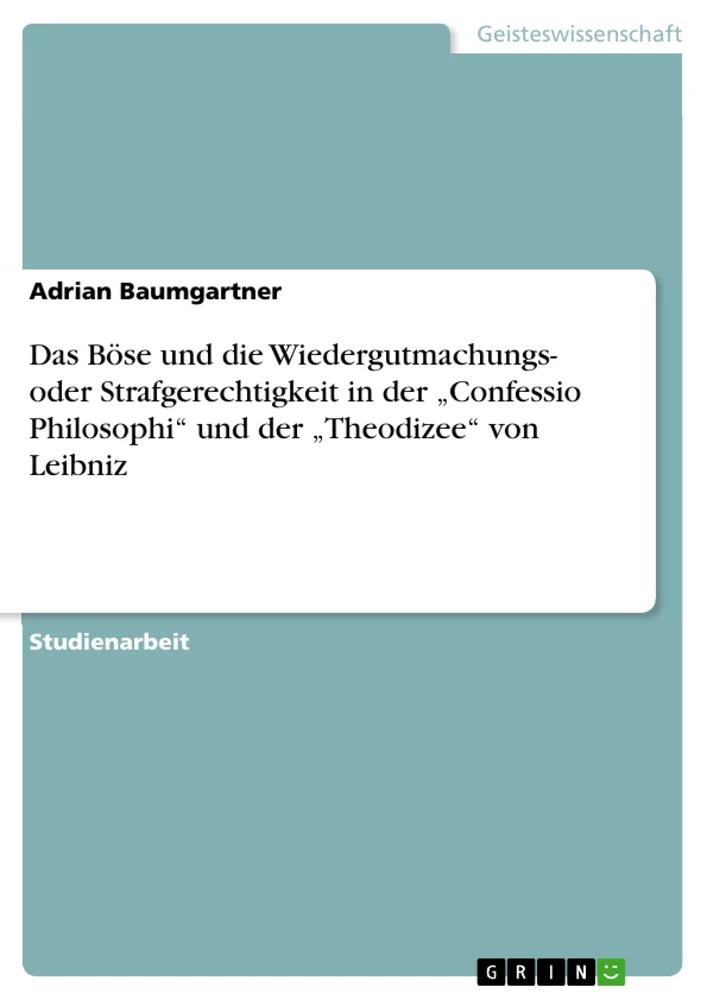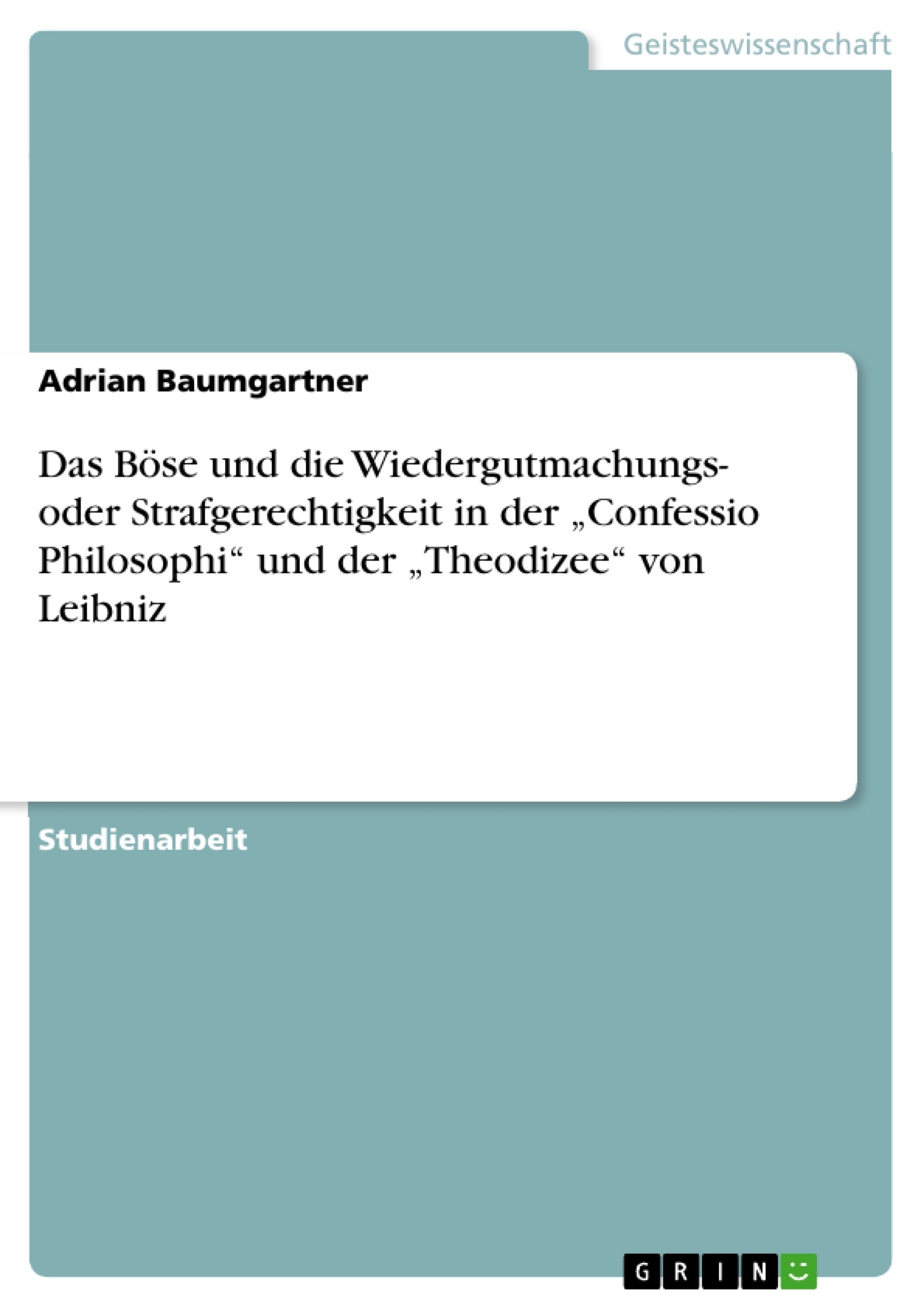Leibniz versucht in den beiden Werken darzustellen, dass unsere Welt trotz aller Übel die beste aller Welten ist. Gott ist nicht Urheber des Bösen, sondern er lässt dieses nur zu. Ich gebrauche die drei Begriffe Übel, Böses und Schlechtes in meiner Arbeit synonym.
Nach Leibniz rechtfertigt sich das durch den Menschen verursachte Böse dadurch, dass Gott die Menschen selbstverantwortlich und –bestimmt handeln lässt. Leibniz zeigt, dass die menschliche Freiheit auch die Möglichkeit zum Sündigen und zum sich Schuldigmachen beinhaltet und dass daraus Strafe und Verdammung folgen kann. Leibniz verwirft den Fatalismus und hält die Prädestination aufrecht.
Wille hat immer einen Grund und Gottes Wille ist immer vernünftig. Beim Menschen ist der Wille entweder durch Vernunft, Meinung oder Leidenschaft gelenkt. Der Wille ist nie grundlos. Leibniz wendet diesen Satz vom Grund sowohl auf den Menschen wie auch auf Gott selbst an. Das “Prinzipium rationis” hilft im Dialog „Confessio Philosophi“ die zentralen Fragen der Gerechtigkeit Gottes und der harmonischen Ordnung der Welt zu lösen; ebenso auch das rechte Verhalten des Menschen, das idealerweise im vollen Vertrauen auf die kosmische Weltordnung Gottes vernünftig sein soll.
Inhaltsverzeichnis
- Fragestellung
- Thesen
- Einleitung
- Methoden von Leibniz
- Die „Confessio Philosophi“
- Das Böse und die Verdammung
- Der Ursprung des Bösen und die Begründung seiner Nichtnotwendigkeit
- Das Böse und die Gerechtigkeit
- Freier Wille und Sünde
- Berechtigte Rechtfertigung der Verdammten oder nicht
- Das Bild des Bösen und die Freiheit
- „Theodizee“
- Das Böse
- Gibt es mehr böse vernunftbegabte Kreaturen als gute?
- Strafgerechtigkeit in der "Theodizee"
- Gott als Utilitarist oder als Meritokrator?
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die Behandlung des Bösen, der Strafgerechtigkeit und des freien Willens in Gottfried Wilhelm Leibniz' Werken „Confessio Philosophi“ (1673) und „Theodizee“ (1710). Ziel ist es, die Entwicklung von Leibniz' Position zu diesen Fragen über die Zeit zu analysieren und die Konsistenz seiner Argumentation zu bewerten.
- Das Problem des Bösen in Leibniz' Philosophie
- Der Zusammenhang zwischen Bösem, freiem Willen und göttlicher Gerechtigkeit
- Leibniz' Konzept der Weltharmonie und seine Auswirkungen auf die Frage nach dem Bösen
- Die Rolle der Strafgerechtigkeit in Leibniz' Gottesbild
- Vergleich der Argumentationsweisen in „Confessio Philosophi“ und „Theodizee“
Zusammenfassung der Kapitel
Fragestellung: Die Arbeit stellt die zentrale Forschungsfrage nach dem Verhältnis von Bösem, Strafgerechtigkeit und freiem Willen in Leibniz' „Confessio Philosophi“ und „Theodizee“. Sie leitet die Untersuchung der komplexen Interaktion dieser Konzepte in Leibniz' Philosophie ein und formuliert die Grundlage für die nachfolgende Analyse.
Thesen: Hier werden die zentralen Thesen der Arbeit formuliert, die im Verlauf der Arbeit untersucht und belegt werden sollen. Es wird die These aufgestellt, dass Leibniz das Problem des Bösen in beiden Werken direkt adressiert und dessen Verhältnis zur Strafgerechtigkeit von der Güte und Vollkommenheit Gottes abhängig macht. Weiterhin wird die These aufgestellt, dass Gottes Vollkommenheit durch die Strafgerechtigkeit nicht beeinträchtigt wird und diese auf der Weltharmonie basiert. Schließlich wird die These aufgestellt, dass Leibniz' Gottesbild entweder als utilitaristisch oder meritokratisch interpretiert werden kann.
Einleitung: Die Einleitung präsentiert Leibniz' These der „besten aller möglichen Welten“ und führt die zentralen Begriffe ein (Übel, Böses, Schlechtes). Sie skizziert Leibniz' Argumentation, dass das vom Menschen verursachte Böse durch die göttliche Gewährung der Selbstbestimmung und Selbstverantwortung gerechtfertigt wird. Die menschliche Freiheit beinhaltet somit die Möglichkeit zu sündigen und die daraus resultierende Strafe und Verdammung. Der Fokus liegt auf der Abweisung des Fatalismus und der Aufrechterhaltung des Prinzips der Prädestination. Die Anwendung des „Prinzipium rationis“ auf Gott und den Menschen wird ebenfalls vorgestellt.
Methoden von Leibniz: Dieses Kapitel beschreibt die von Leibniz angewandten Methoden, darunter den Satz vom Grund, das Gesetz der Kontinuität, das Prinzip des Besten und die Individuation. Es betont den rationalen und wissenschaftlichen Ansatz Leibniz' und dessen ökumenische Absicht. Der Vergleich zwischen der „Confessio Philosophi“ und der „Theodizee“ hinsichtlich ihrer Argumentationsstruktur und der Verwendung der Dialogform wird ebenfalls beleuchtet.
Die „Confessio Philosophi“: Dieses Kapitel beschreibt die „Confessio Philosophi“ als philosophischen Dialog und nicht als rein religiöses Bekenntnis. Es betont Leibniz' Anliegen, Vernunft und Glauben in Einklang zu bringen. Die zentralen Probleme, die Leibniz behandelt, werden herausgestellt, insbesondere die Frage nach dem freien Willen angesichts der Notwendigkeit zu sündigen und die Rechtmäßigkeit der Strafe.
Das Böse und die Verdammung: Dieses Kapitel beschreibt Leibniz’ Auseinandersetzung mit dem Ursprung des Bösen und seiner Nichtnotwendigkeit. Es analysiert die Anwendung des Prinzips des zureichenden Grundes auf das Problem des Bösen und erläutert die Rolle des menschlichen Irrtums und der subjektiven Veranlagung bei der Entstehung der Sünde. Die mathematischen Analogien werden aufgezeigt und das Argument wider ein manichäisches Gottesbild entwickelt.
Schlüsselwörter
Gott, Böse, freier Wille, Strafgerechtigkeit, Weltharmonie, „Confessio Philosophi“, „Theodizee“, Prinzip des zureichenden Grundes, Bestmögliche Welt, Utilitarismus, Meritokratie, Rationalität, Glaube.
Häufig gestellte Fragen zu Leibniz' Behandlung des Bösen in "Confessio Philosophi" und "Theodizee"
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Diese Seminararbeit analysiert Gottfried Wilhelm Leibniz' Auseinandersetzung mit dem Problem des Bösen, der Strafgerechtigkeit und des freien Willens in seinen Werken "Confessio Philosophi" (1673) und "Theodizee" (1710). Sie untersucht die Entwicklung seiner Positionen über die Zeit und bewertet die Konsistenz seiner Argumentation.
Welche zentralen Fragen werden behandelt?
Die Arbeit befasst sich mit dem Verhältnis von Bösem, freiem Willen und göttlicher Gerechtigkeit in Leibniz' Philosophie. Sie untersucht Leibniz' Konzept der Weltharmonie im Kontext des Bösen, die Rolle der Strafgerechtigkeit in seinem Gottesbild und vergleicht die Argumentationsweisen in beiden Werken. Die Kernfrage ist, wie Leibniz das Problem des Bösen in einer "besten aller möglichen Welten" erklärt.
Welche Thesen werden aufgestellt?
Die Arbeit stellt die These auf, dass Leibniz das Problem des Bösen in beiden Werken direkt adressiert und dessen Verhältnis zur Strafgerechtigkeit von der Güte und Vollkommenheit Gottes abhängig macht. Weiterhin wird argumentiert, dass Gottes Vollkommenheit durch die Strafgerechtigkeit nicht beeinträchtigt wird und diese auf der Weltharmonie basiert. Schließlich wird die These aufgestellt, dass Leibniz' Gottesbild entweder als utilitaristisch oder meritokratisch interpretiert werden kann.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in Kapitel zu Fragestellung, Thesen, Einleitung, Leibniz' Methoden, "Confessio Philosophi" (mit Unterkapiteln zu verschiedenen Aspekten des Bösen und der Verdammung), "Theodizee" (mit Unterkapiteln zu zentralen Aspekten des Bösen und der Strafgerechtigkeit in diesem Werk) und einem Fazit. Die Kapitelzusammenfassungen bieten einen detaillierten Überblick über den Inhalt.
Welche Methoden verwendet Leibniz?
Leibniz verwendet den Satz vom Grund, das Gesetz der Kontinuität, das Prinzip des Besten und die Individuation. Seine Argumentation ist rational und wissenschaftlich geprägt, mit dem Ziel, Vernunft und Glauben in Einklang zu bringen. Die Arbeit vergleicht auch die Argumentationsstruktur und die Verwendung der Dialogform in beiden Werken.
Wie behandelt Leibniz das Problem des Bösen in der "Confessio Philosophi"?
Die "Confessio Philosophi" wird als philosophischer Dialog verstanden, der Leibniz' Anliegen, Vernunft und Glauben zu versöhnen, verdeutlicht. Zentrale Fragen sind der freie Wille angesichts der Notwendigkeit zu sündigen und die Rechtmäßigkeit der Strafe. Die Arbeit analysiert Leibniz' Argumentation zum Ursprung des Bösen, seiner Nichtnotwendigkeit und der Rolle des menschlichen Irrtums.
Wie behandelt Leibniz das Problem des Bösen in der "Theodizee"?
In der "Theodizee" setzt sich Leibniz weiter mit dem Problem des Bösen auseinander. Die Arbeit analysiert Leibniz’ Argumentation zu Fragen wie der Existenz von mehr bösen als guten vernunftbegabten Kreaturen, der Strafgerechtigkeit und der Interpretation seines Gottesbildes als utilitaristisch oder meritokratisch.
Welche Schlüsselbegriffe sind zentral?
Zentrale Begriffe sind Gott, Böses, freier Wille, Strafgerechtigkeit, Weltharmonie, "Confessio Philosophi", "Theodizee", Prinzip des zureichenden Grundes, bestmögliche Welt, Utilitarismus, Meritokratie, Rationalität und Glaube.
Was ist das Fazit der Arbeit?
(Das Fazit selbst ist nicht im bereitgestellten Text enthalten und muss durch die Lektüre der vollständigen Seminararbeit ermittelt werden.)
- Citar trabajo
- Lic. theol. Adrian Baumgartner (Autor), 2012, Das Böse und die Wiedergutmachungs- oder Strafgerechtigkeit in der „Confessio Philosophi“ und der „Theodizee“ von Leibniz, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/269697