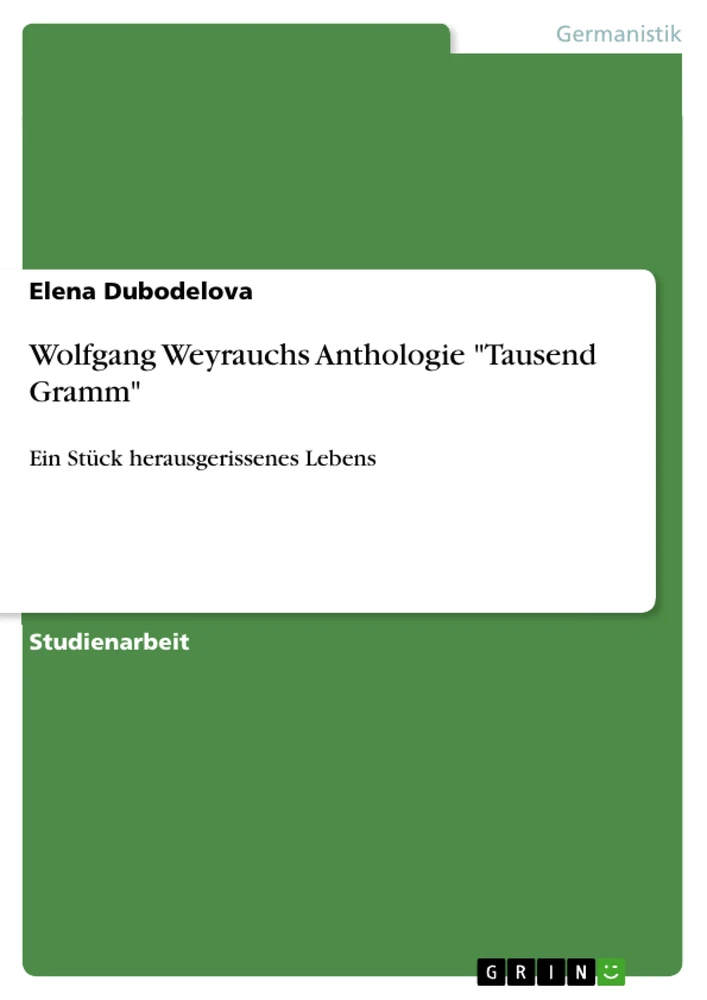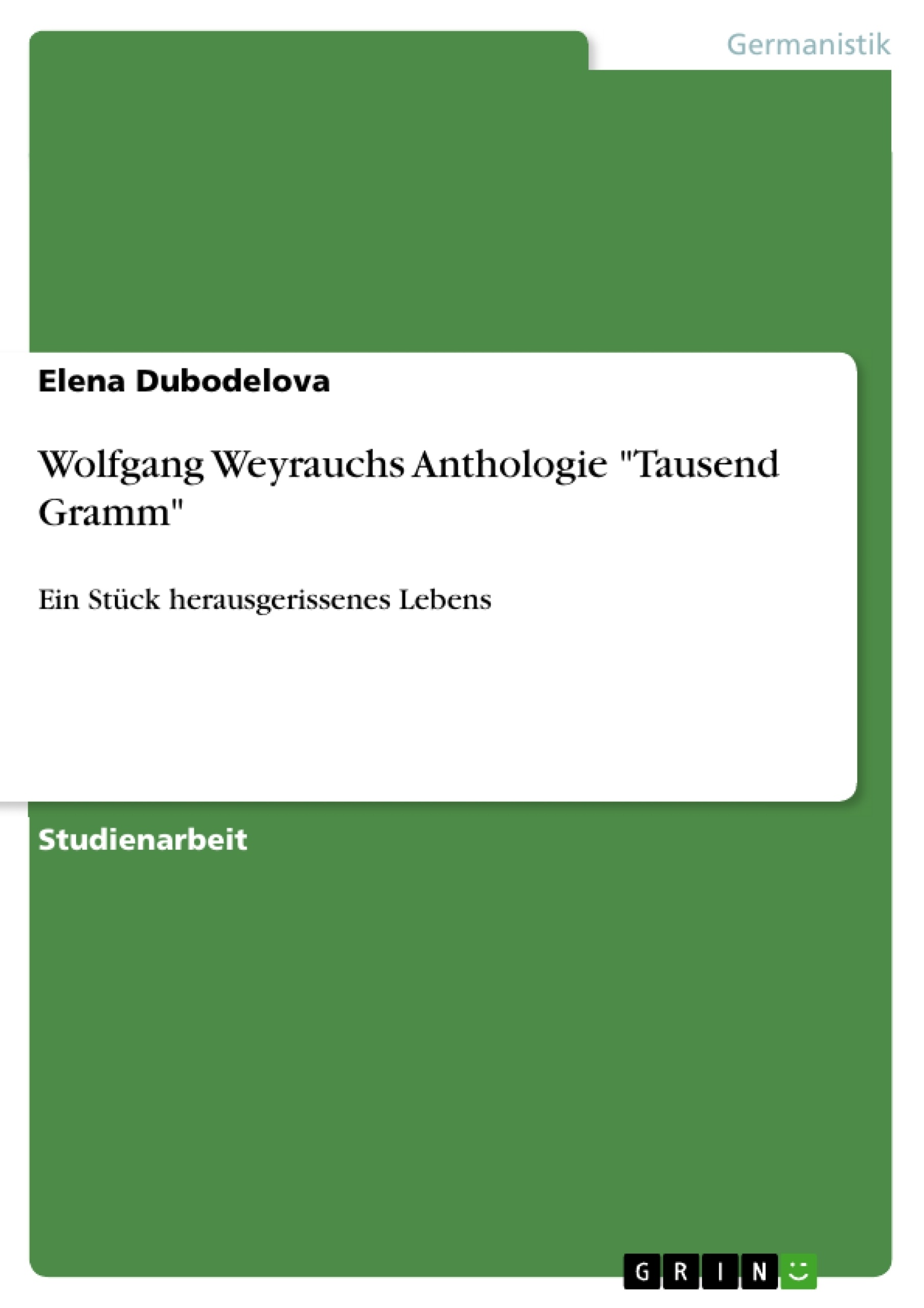Der Film „Deutschland im Jahre Null“ von Roberto Rossellini zeigt die innere Zerstörung der Überlebenden, die sich in der Trümmerwüste nicht zurechtfinden. Vergleichbare Szenen eines dokumentarischen Realismus finden sich in der westdeutschen Literatur der ersten Nachkriegsjahre kaum. Im Vorwort zum ersten Band des Buches Nachkriegsliteratur in Westdeutschland definieren die Verfasser die Situation folgenderweise: „Die Aufforderung zur Nüchternheit bleibt in der Nähe abgrundtiefer Beschwörungen der Wirklichkeit.“ Man schreibt, um das „Vakuum“ auszufüllen. Die Feststellung der Sinnleere wird überschrieben durch die Fülle der Alltagsmisere. „Das ideologisch deformierte Bewusstsein sucht Beruhigung in den Bildungswerten der Vergangenheit.“
Die literarischen Streiflichter lassen sich bereits erkennen, dass die großen Erwartungen eines Neubeginns im Medium der Literatur nicht haltbar waren. In der Erinnerung der Zeitgenossen wird die damalige Robinsonmentalität des Selbermachens und „Sichdurchschlagens“ als kulturelle Identität verklärt. Aus zeitgenössischer Sicht waren die Nachkriegsjahre eher eine Zeit des „Interregnums“ und der „Quarantäne“. Ein Gefühl der „Gesellschaftslosigkeit“ angesichts des „Zusammenbruchs“ lag über den historischen und politischen Verhältnissen. „Die Nachkriegszeit war eine Zeit der Okkupation. An diesem Faktum sind die kulturellen Aktivitäten zu messen.“ Aus diesem Zustand heraus entstanden die neuerlichen materiellen und ideologischen Verbindlichkeiten: die Wiederherstellung eines ‚freien’ Literaturmarkts, die Ausrichtung der literarischen Wertsetzung.
Die Literatur der ersten Nachkriegsjahre ist unter dem Gesichtspunkt ihrer historischen Gegenwärtigkeit zu betrachten bevor über die Frage von Kontinuität und Bruch – die problematische Faszination der Stunde Null – kategorial entschieden wird. Das Schicksal von Faschismus und Krieg war im Erfahrungshorizont vieler Schriftsteller und Leser auch das Nachkriegsschicksal. Umso wichtiger ist die Ermittlung markanter Inhalte und Formen, Haltungen und Wertungen, Bedürfnisse und Erwartungen unter den spezifischen Bedingungen der Nachkriegszeit. Die Institutionalisierung der Literatur gibt Aufschluss über die Wechselfälle des literarischen Lebens zwischen „geistiger Situation“, persönlicher Aktivität, ökonomischen Interessen und kulturellen Bedürfnissen.
Inhaltsverzeichnis
- Deutsche Gesellschaft und Literatur der Nachkriegszeit
- Zur deutschen Sprache der Nachkriegszeit
- Wolfgang Weyrauchs Anthologie Tausend Gramm
- Die Treue von Alfred Andersch
- Zusammenfassung
- Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert die deutsche Literatur und Gesellschaft der unmittelbaren Nachkriegszeit und untersucht, wie die Erfahrung des Krieges und der unmittelbaren Nachkriegszeit in den Werken der Zeit verarbeitet wurde. Sie beleuchtet die besonderen Bedingungen, unter denen Literatur entstand, und wie diese Bedingungen die Themen, Formen und Haltungen der Werke beeinflussten.
- Das Verhältnis von Kontinuität und Bruch in der deutschen Literatur und Gesellschaft nach 1945
- Die Rolle der Literatur im Umgang mit dem Trauma des Krieges und den Folgen der Naziherrschaft
- Die Entwicklung der deutschen Sprache in der Nachkriegszeit
- Die Bedeutung von "Tausend Gramm", einer Anthologie von Wolfgang Weyrauch, als Spiegel der Zeit
- Die literarische Verarbeitung von gesellschaftlichen und politischen Veränderungen in der Nachkriegszeit
Zusammenfassung der Kapitel
- Deutsche Gesellschaft und Literatur der Nachkriegszeit: Dieses Kapitel untersucht die unmittelbare Nachkriegszeit in Deutschland anhand der literarischen und gesellschaftlichen Entwicklungen. Es analysiert die Herausforderungen der Wiederaufbauphase und die Suche nach einer neuen Identität.
- Zur deutschen Sprache der Nachkriegszeit: Das Kapitel beleuchtet die Veränderungen in der deutschen Sprache und Literatur im Kontext der Nachkriegszeit. Es thematisiert die Abgrenzung von der nationalsozialistischen Sprache und den Einfluss der neuen politischen und sozialen Bedingungen auf den Sprachgebrauch.
- Wolfgang Weyrauchs Anthologie Tausend Gramm: Dieses Kapitel widmet sich der Analyse von Wolfgang Weyrauchs Anthologie "Tausend Gramm" als ein repräsentatives Beispiel für die literarische Produktion der Nachkriegszeit. Es untersucht die Auswahl der Texte und die Intentionen des Herausgebers.
Schlüsselwörter
Deutsche Nachkriegsliteratur, Sprache, Kultur, Erfahrung, Trauma, Identität, Kontinuität, Bruch, Wiederaufbau, "Tausend Gramm", Wolfgang Weyrauch, "Deutschland im Jahre Null", Roberto Rossellini, "Stillen im Lande", "Realismus des Unmittelbaren", "magischer Realismus".
- Citation du texte
- Elena Dubodelova (Auteur), 2004, Wolfgang Weyrauchs Anthologie "Tausend Gramm", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/269721