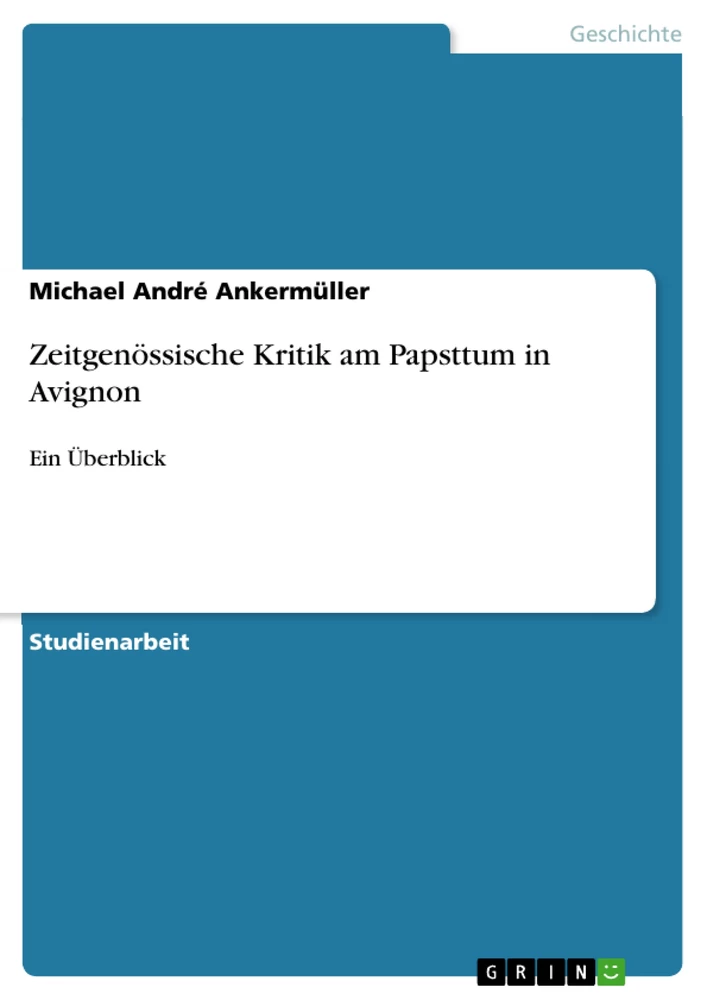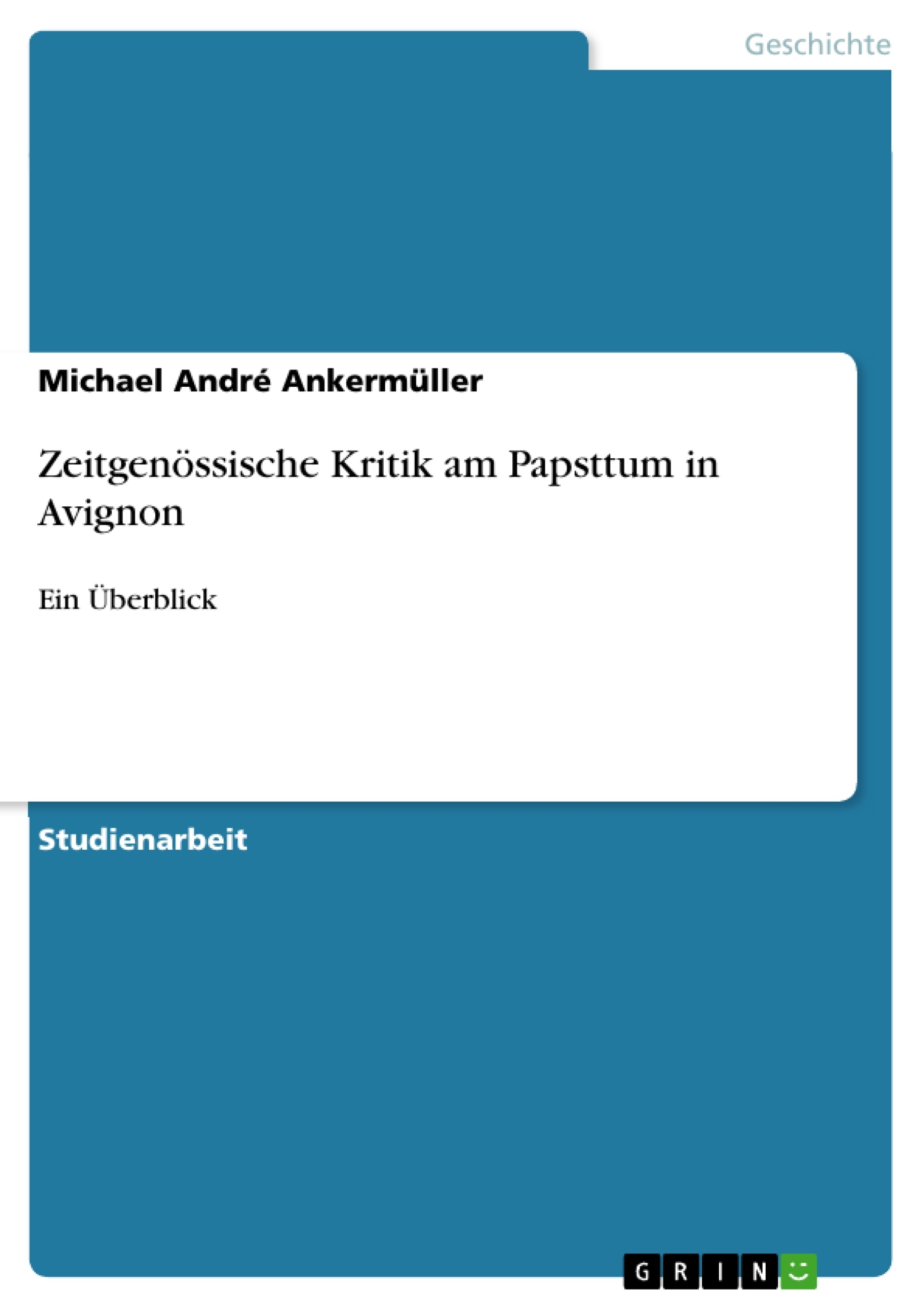Das Thema „Mittelalter“ ist in jeder Hinsicht in Mode gekommen. Zu einem dieser noch lange nicht erschöpften Themen der Geschichtsforschung zählt die Frage nach dem Papsttum in Avignon in der Historiographie des Mittelalters. Die Stellung des Papstes in der Kirche ist nicht erst in heutiger Zeit heftig umstritten und fragwürdig und wirft viele Fragen auf. Doch bereits damals entstanden im Mittelalter heftige Gegenbewegungen gegen die Kurie.
Hauptbestandteil der vorliegenden Arbeit ist das avignonesische Papsttum im Spiegel der zeitgenössischen Kritik, der unter Gliederungspunkt vier herausgearbeitet wird. Das Papsttum in Avignon- Ein chronlogischer Überblick möchte unter Punkt drei in die grundlegende Thematik einführen und grundlegende Strukturen erklären. Anhand von Francesco Petraca „ liber sine nomine“ als Paradebeispiel zeitgenössischer Kritik am Papsttum in Avignon, möchte Punkt fünf einen Einstieg für die Rechtfertigung der Kritik anhand von Originalquellen liefern. Die Quellen sind in der vorliegenden Arbeit lateinisch angegeben. Eine adäquate Übersetzung finden sie in Piur, P.: Petrarcas „ Buch ohne Namen“ und die päpstliche Kurie, Haale 1925. Der abschließende und letzte Punkt sechs– „Ein kritisches Bewusstsein entsteht- Eine Zusammenfassung“ möchte aufzeigen, welche Konsequenzen die antikurialen Strömungen im Spätmittelalter auf die Bevölkerung und die nachfolgenden Generationen und deren Denkweise hatten.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Forschungsstand
3. Das Papsttum in Avignon- Ein chronologischer Überblick
4. Das avignonesische Papsttum/ Exil im Spiegel der zeitgenössischen Kritik
5. Francescos Petrarcas Kritik am Papsttum in Avignon
6. Kritisches Bewusstsein entsteht- Eine Zusammenfassung
Literaturverzeichnis
- Quote paper
- Michael André Ankermüller (Author), 2010, Zeitgenössische Kritik am Papsttum in Avignon, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/269902