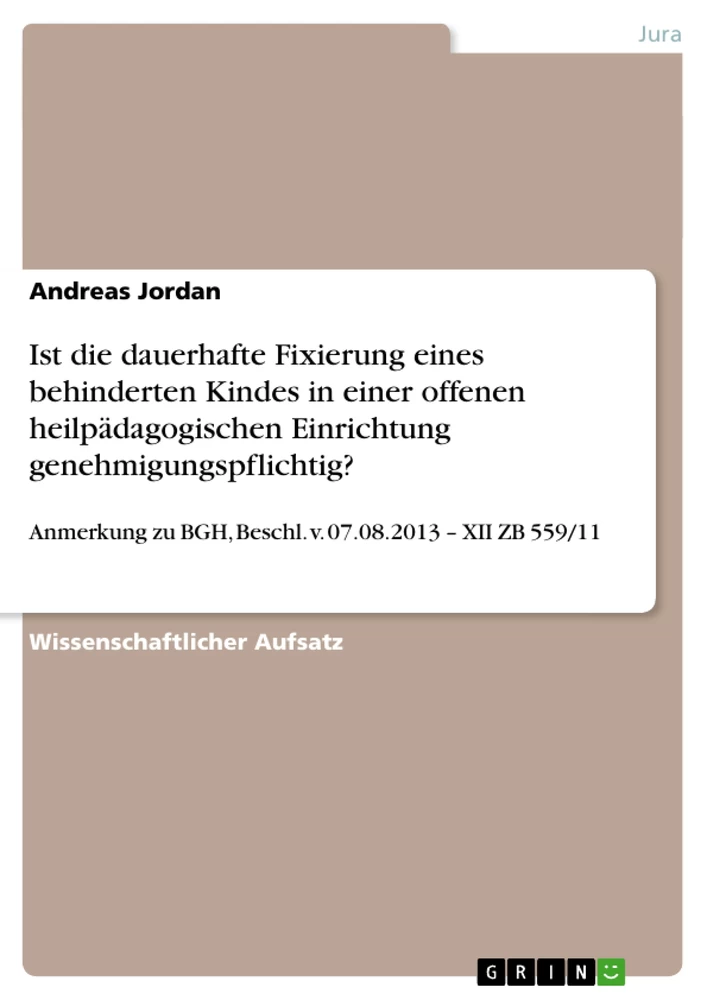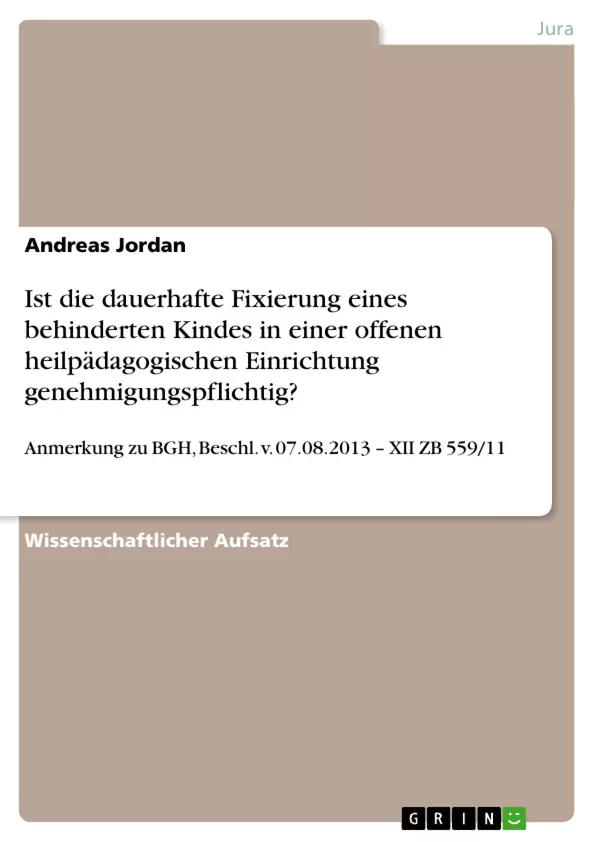Am 7.8.2013 hat der 12. Senat des Bundesgerichtshofs (BGH) entschieden, dass die nächtliche Fixierung eines behinderten Kindes keine genehmigungsbedürftige Maßnahme ist und ausschließlich von den Eltern bestimmt werden darf. Der BGH hat mit seinem Beschluss die Rechte von behinderten Kindern und Jugendlichen verkürzt und verpasst es, die Konventionen der UN zum Schutz von Kindern und behinderten Menschen zur Auslegung nationalen Rechts heranzuziehen.
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
I. Thesen des Autors
II. Wesentliche Aussagen des Urteils
III. Sachverhalt
IV. Würdigung / Kritik
1. Materieller Verstoß gegen Art. 2 Abs. 2 GG
2. Die analoge Anwendung von § 1906 Abs. 4 BGB ergibt sich aus der UN-BRK
3. § 1626 BGB ersetzt nicht den Genehmigungsvorbehalt
4. § 1631 Abs. 2 BGB untersagt entwürdigende Maßnahmen
5. Praktische Bedeutung des Beschlusses
Einleitung
Am 7.8.2013 hat der 12. Senat des Bundesgerichtshofs (BGH) entschieden, dass die nächtliche Fixierung eines behinderten Kindes keine genehmigungsbedürftige Maßnahme ist und ausschließlich von den Eltern bestimmt werden darf. Der BGH hat mit seinem Beschluss die Rechte von behinderten Kindern und Jugendlichen verkürzt und verpasst es, die Konventionen der UN zum Schutz von Kindern und behinderten Menschen zur Auslegung nationalen Rechts heranzuziehen.
I. Thesen des Autors
1. Für das Fixieren eines Kindes benötigt man eine gesetzliche Grundlage, da sie die Freiheit eines Kindes (Art. 2 Abs. 2 Grundgesetz – GG) einschränkt.
2. Der Beschluss des BGH hat eine große Relevanz für die Praxis, da die Handlungsfreiheit der helfenden Professionen in Einrichtungen eingeschränkt wird, die mit „schwierigen“ Kindern arbeiten.
3. Das dauerhafte Fixieren eines Kindes ist eine entwürdigende Erziehungsmaßnahme (§ 1631 Abs. 2 Bürgerliches Gesetzbuch – BGB).
4. Die elterliche Sorge umfasst nicht die Entscheidungsgewalt über das dauerhafte Fixieren eines behinderten Kindes, da die Freiheit eines Menschen unverletzlich ist (Art. 2 Abs. 2 S. 2 GG).
5. Der Beschluss beinhaltet die Gefahr, dass sich helfende Institutionen in Zukunft weigern, schwierige Kinder zu betreuen, wenn eine Fixierung erforderlich ist und die Genehmigung der Eltern ausbleibt.
II. Wesentliche Aussagen des Urteils
1. Die nächtliche Fixierung eines Kindes ist nicht genehmigungsbedürftig.
2. Ein Genehmigungsvorbehalt fällt nicht unter § 1631b BGB.
3. § 1906 Abs. 4 BGB kann im Kindschaftsrecht nicht analog angewendet werden.
4. Die Ausübung der elterlichen Sorge umfasst auch die Entscheidung über eine Fixierungsmaßnahme.
III. Sachverhalt
Auf Antrag der Eltern genehmigte das Amtsgericht Varel eine zweijährige Fixierungsmaßnahme eines behinderten Kindes aufgrund der analogen (entsprechenden) Anwendung von § 1906 Abs. 4 BGB. Das am 1.4.1999 geborene Kind hat frühkindlichen Autismus und eine geistige Behinderung. Es befindet sich seit 2008 in einer offenen heilpädagogischen Einrichtung. Der Grund für die Fixierungsmaßnahme waren ausgeprägte Unruhezustände und stark ausgeprägte Weglauftendenzen. Zum Schutz der Bewohner wurde das behinderte Kind nachts mit Hilfe eines Bauch- oder Fußgurtes am Bett fixiert. Das Amtsgericht lehnte einen weiteren Verlängerungsantrag der Eltern für diese Maßnahme mit der Begründung ab, dass die von dem Heim durchgeführte Maßnahme nicht genehmigungspflichtig sei. Die von dem Verfahrensbeistand eingereichte Rechtsbeschwerde vor dem Oberlandesgericht (OLG) Oldenburg blieb erfolgslos.
IV. Die Entscheidung
Der Bundesgerichtshof (BGH) hat die Entscheidung des OLG bestätigt. Geprüft wurde, ob die nächtliche Fixierung eines Kindes einem förmlichen Genehmigungsverfahren unterliegt.
Im ersten Schritt wurde § 1631b BGB geprüft, wonach eine freiheitsentziehende Unterbringung eines Kindes durch das Familiengericht genehmigt werden muss. In der Literatur wird die Ansicht vertreten, dass die regelmäßige Fixierung eines Kindes an Stuhl und Bett unter diesen Genehmigungsvorbehalt falle.[1] Diesem Ansatz wollte der 12. Senat jedoch nicht folgen. Zunächst arbeitete der BGH heraus, dass § 1631b BGB auf dem staatlichen Wächteramt basiere, da die „geschlossene“ Unterbringung eines Kindes der richterlichen Genehmigung durch das Familiengericht bedarf. Der Normzweck sei, zu verhindern, dass schwierige Kinder unbemerkt in einer geschlossenen Einrichtung verschwinden. Da der BGH in seinem Beschluss von einem „engen Unterbringungsbegriff“[2] ausging, kam er zu dem Ergebnis, dass die Fixierung eines Kindes nicht unter den Genehmigungsvorbehalt des § 1631b BGB fällt.
[...]
[1] Erman, Kommentar zum BGB § 1631b Rn. 3.
[2] BT-Drucks. 11/4528 S. 146.
Häufig gestellte Fragen
Ist die nächtliche Fixierung eines behinderten Kindes laut BGH genehmigungspflichtig?
Nein, der BGH entschied am 7.8.2013, dass eine solche Maßnahme nicht gerichtlich genehmigt werden muss und allein von den Eltern bestimmt werden darf.
Warum wird diese Entscheidung in der Facharbeit kritisiert?
Der Autor kritisiert, dass dadurch die Rechte behinderter Kinder verkürzt werden und UN-Konventionen zum Schutz von Behinderten nicht ausreichend berücksichtigt wurden.
Was war der konkrete Sachverhalt des Urteils?
Es ging um ein autistisches, geistig behindertes Kind in einer offenen Einrichtung, das nachts mit Gurten am Bett fixiert wurde, um Unruhezustände und Weglauftendenzen zu kontrollieren.
Welche gesetzliche Norm wurde vom BGH geprüft?
Geprüft wurde insbesondere § 1631b BGB (freiheitsentziehende Unterbringung), wobei der BGH einen engen Unterbringungsbegriff anwandte.
Welche Gefahr sieht der Autor in dem Beschluss?
Es besteht die Gefahr, dass Einrichtungen die Betreuung schwieriger Kinder ablehnen, wenn nötige Fixierungen ohne klare gesetzliche Absicherung erfolgen müssen.
- Citation du texte
- Dipl.-Sozialpädagoge und Sozialjurist (LL.M.) Andreas Jordan (Auteur), 2014, Ist die dauerhafte Fixierung eines behinderten Kindes in einer offenen heilpädagogischen Einrichtung genehmigungspflichtig?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/269926