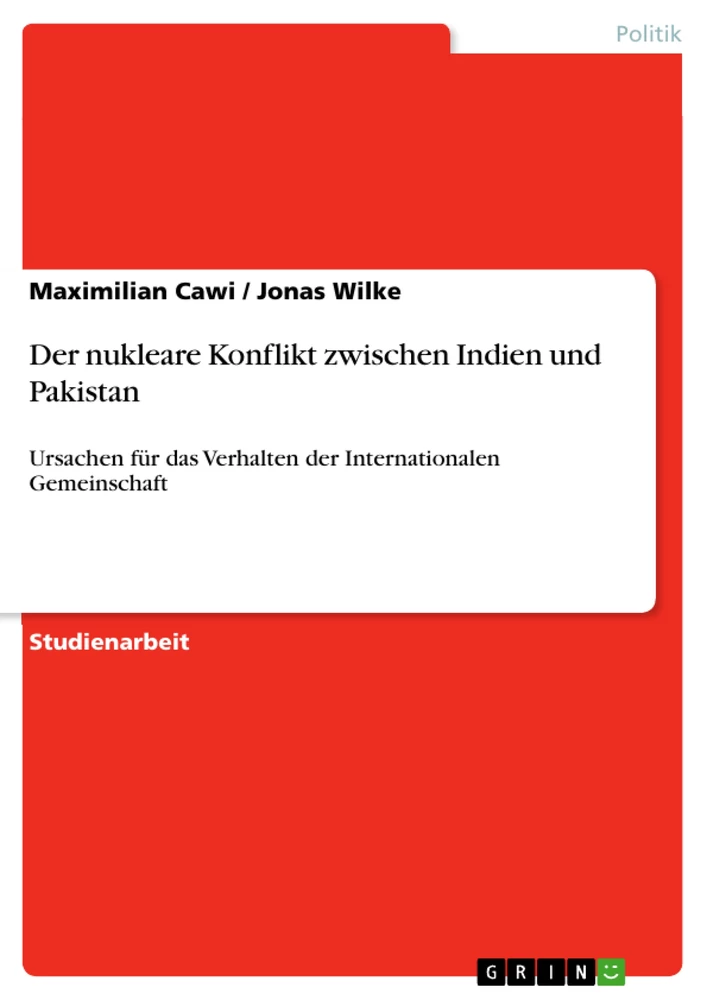Mit dem Kargil-Krieg standen sich 1999 erstmals in der Geschichte zwei nuklear
bewaffnete Staaten in einem regulären Konflikt um die Kashmir-Region gegenüber.
Trotz einer langen Historie zwischen Pakistan und dem unabhängigen Indien
ausgetragener Streitigkeiten kam es zu keiner nuklearen Eskalation. Die
internationale Gemeinschaft ergriff schnell für das demokratische Indien Partei unddie Darstellung Pakistans als atomarer bewaffneter Aggressor und möglicher Partnerfür Proliferation an fundamentalistische Organisation erhärtete sich.
Ein tieferer Blick in die Nuklearprogramme der beiden Staaten – mit der
gegenseitigen Provokation und häufigen tatsächlichen Konfrontation – zeigt eine
starke Diskrepanz zwischen internationaler Perzeption und den tatsächlichen
Bemühungen der Staaten um eine regionale Deeskalation. Beide Staaten verfügen
über gesichertes und fortan weiterentwickeltes nukleares Potential mit
entsprechenden Trägersysteme. Ebenso sind beide Staaten nicht bereit, sich den
Kontrollforderungen der internationalen Gemeinschaft in Gänze zu unterwerfen. So verzichten beide Staaten weder formal auf die Möglichkeit eines nuklearen
Erstschlages gegen den entsprechenden Konfliktgegner noch sind sie zu Gesprächen einer vollständigen nuklearen Abrüstung bereit.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Theorie
2.1 Realismus
2.2 Soziologischer Institutionalismus
3. Die indische Atombombe
3.1 Realistische Aspekte
3.1.1 Regionale Macht
3.1.2 Wirtschaftliche Kapazität
3.1.3 Offenes Bedrohungspotential gegen Pakistan
3.2 Aspekte des Soziologischen Institutionalismus
3.2.1 Fehlende Kooperation
3.2.2 Beziehung zu Pakistan
3.2.3 Perzeption als friedlicher Staat
4. Die pakistanische Atombombe
4.1. Aspekte des Realismus
4.1.1 Regionale Machtverhältnisse
4.1.2 Wirtschaftliche Kapazität
4.1.3 Offenes Bedrohungspotential gegenüber Indien
4.2 Aspekte des Soziologischen Institutionalismus
4.2.1 Kooperation mit der internationalen Gemeinschaft
4.2.2 Pakistans Rolle in Fällen nuklearer Proliferation
4.2.3 Blockbildung und Identitätsstiftung
5. Fazit
5.1 Realismus
5.2 Soziologischer Institutionalismus
6. Literaturverzeichnis
Häufig gestellte Fragen
Was war der Kargil-Krieg 1999?
Es war der erste reguläre militärische Konflikt zwischen Indien und Pakistan, nachdem beide Staaten offiziell über Nuklearwaffen verfügten.
Warum kam es bisher zu keiner nuklearen Eskalation?
Trotz Spannungen gibt es Bemühungen um regionale Deeskalation, obwohl beide Staaten formal nicht auf einen nuklearen Erstschlag verzichten.
Wie unterscheidet sich die Wahrnehmung Indiens und Pakistans?
Indien wird international oft als demokratischer, friedlicher Staat wahrgenommen, während Pakistan häufiger als Aggressor oder Risiko für Proliferation gesehen wird.
Was besagt die Theorie des Realismus in diesem Konflikt?
Der Realismus sieht Nuklearwaffen als Mittel zur Sicherung der nationalen Macht und zur Abschreckung in einem anarchischen internationalen System.
Sind Indien und Pakistan Teil internationaler Kontrollverträge?
Beide Staaten weigern sich, sich den Kontrollforderungen der internationalen Gemeinschaft vollständig zu unterwerfen und führen ihre Programme eigenständig fort.
- Quote paper
- Maximilian Cawi (Author), Jonas Wilke (Author), 2013, Der nukleare Konflikt zwischen Indien und Pakistan, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/269946