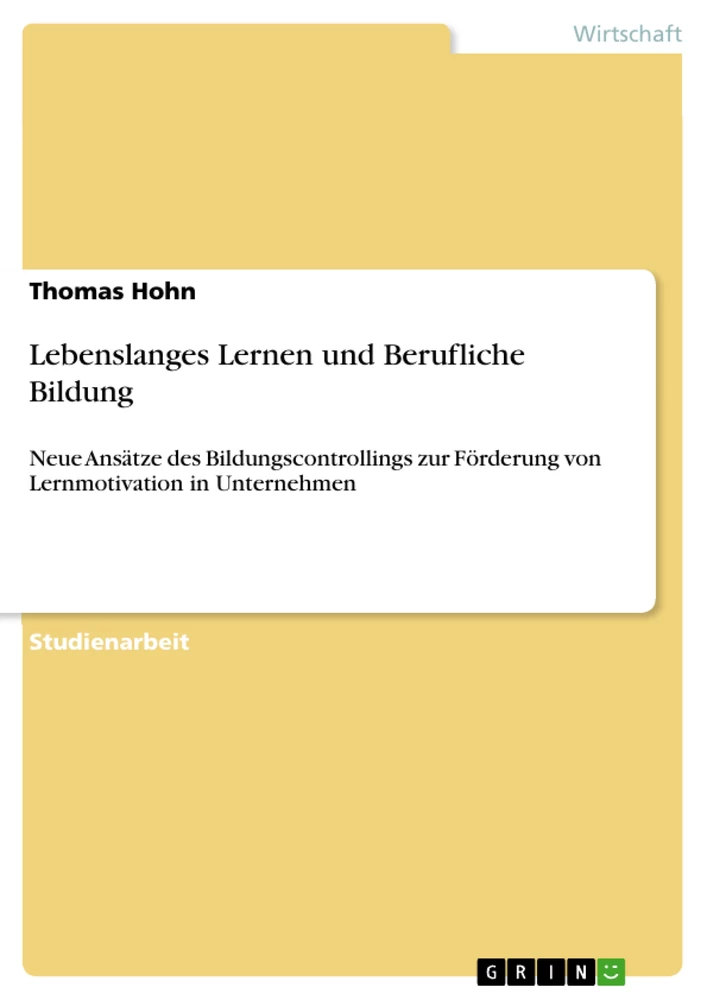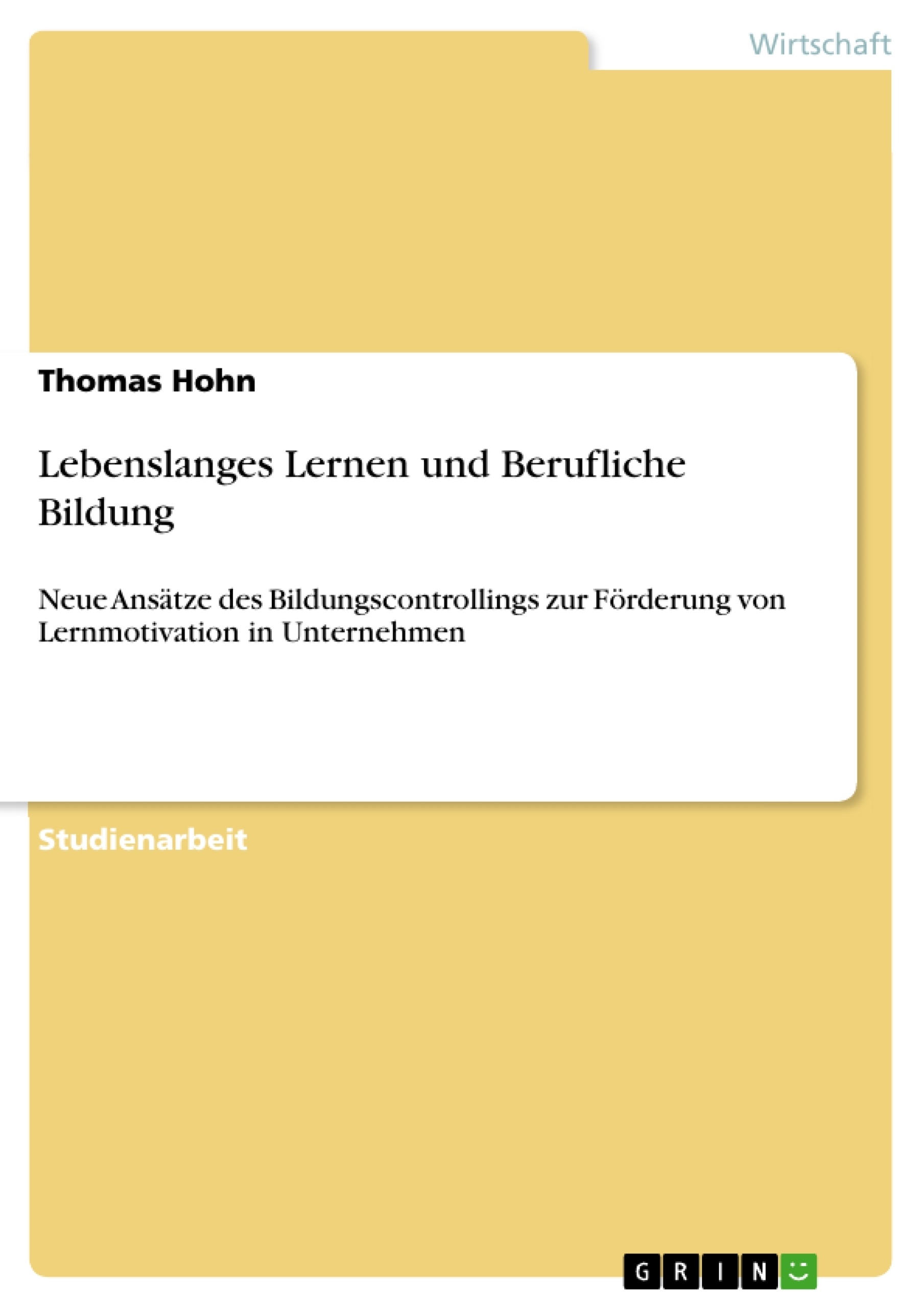In der Zusammenschau gegenwärtiger Defizite beim Lebenslangen Lernen einerseits und Bildungscontrolling andererseits liegt der argumentative Ausgangspunkt dieser wissenschaftlichen Hausarbeit. Der Autor stellt folgende Hypothese auf: „Die gegenwärtigen Bildungscontrolling-Konzeptionen deutscher Unternehmen zeichnen sich durch eine stark wirtschaftswissenschaftliche Ausrichtung aus, wodurch bildungs- und lerntheoretisch begründete Potenziale des Bildungscontrollings zur Förderung des Lebenslangen Lernens bislang weitgehend ungenutzt bleiben.“ Die der Hausarbeit zu Grunde liegende Forschungsfrage lautet dementsprechend: „Durch welche Entwicklungsmaßnahmen könnte das Bildungscontrolling in deutschen Unternehmen zukünftig stärker dazu genutzt werden, Bildungsbeteiligung und Lernmotivation in Bezug auf das berufliche Lernen zu fördern?“
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Begriffsbestimmungen
3. Lebenslanges Lernen in Deutschland – ausgewählte Befunde
4. Status quo des Bildungscontrollings in Deutschland
5. Theoretische Ansätze
5.1. Der Nutzen theoretischer Ansätze für zukünftige Bildungscontrolling-Konzeptionen
5.2. Humankapitaltheorie versus Bildungs- und lerntheoretische Ansätze
5.3. Theoretische Ansätze zum Bildungscontrolling
6. Zwischen Ökonomie und Pädagogik – ein Spannungsfeld für das Bildungscontrolling der Zukunft?
7. Fünf Gestaltungsimpulse für die zukünftige Bildungscontrolling-Praxis
7.1. Unternehmensinterne Nutzenkommunikation zur Förderung eines am Lerner orientierten Ziel- und Bedarfscontrollings
7.2. Ausweitung des Bildungscontrolling auf informelle Lernprozesse
7.3. Potenziale des Bildungscontrollings zur Förderung expansiven Lernens
7.4. Bildungscontrolling als Instrument zur Förderung von Selbststeuerungskompetenz und Reflexiver Handlungsfähigkeit
7.5. Bildungscontrolling als Führungsaufgabe verstehen
8. Grenzen zukünftiger Bildungscontrolling-Konzeptionen
9. Fazit
Literaturverzeichnis
Häufig gestellte Fragen
Was wird am aktuellen Bildungscontrolling in deutschen Unternehmen kritisiert?
Die Kritik lautet, dass es zu stark wirtschaftswissenschaftlich ausgerichtet ist und pädagogische Potenziale zur Förderung des Lernens ungenutzt lässt.
Wie kann Bildungscontrolling die Lernmotivation steigern?
Durch Entwicklungsmaßnahmen, die Bildungsbeteiligung und Motivation fördern, statt nur Kosten und Nutzen rein ökonomisch zu vergleichen.
Was ist der Unterschied zwischen Humankapitaltheorie und pädagogischen Ansätzen?
Die Humankapitaltheorie sieht Bildung als Investition in die Produktivität, während pädagogische Ansätze die individuelle Entwicklung und das lebenslange Lernen betonen.
Welche Rolle spielen informelle Lernprozesse?
Ein moderner Ansatz fordert die Ausweitung des Bildungscontrollings auf informelle Prozesse, da ein Großteil des Lernens außerhalb formeller Kurse stattfindet.
Ist Bildungscontrolling eine reine Führungsaufgabe?
Die Arbeit schlägt vor, Bildungscontrolling verstärkt als Führungsaufgabe zu verstehen, um Reflexivität und Selbststeuerungskompetenz der Mitarbeiter zu fördern.
- Quote paper
- Thomas Hohn (Author), 2011, Lebenslanges Lernen und Berufliche Bildung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/269974