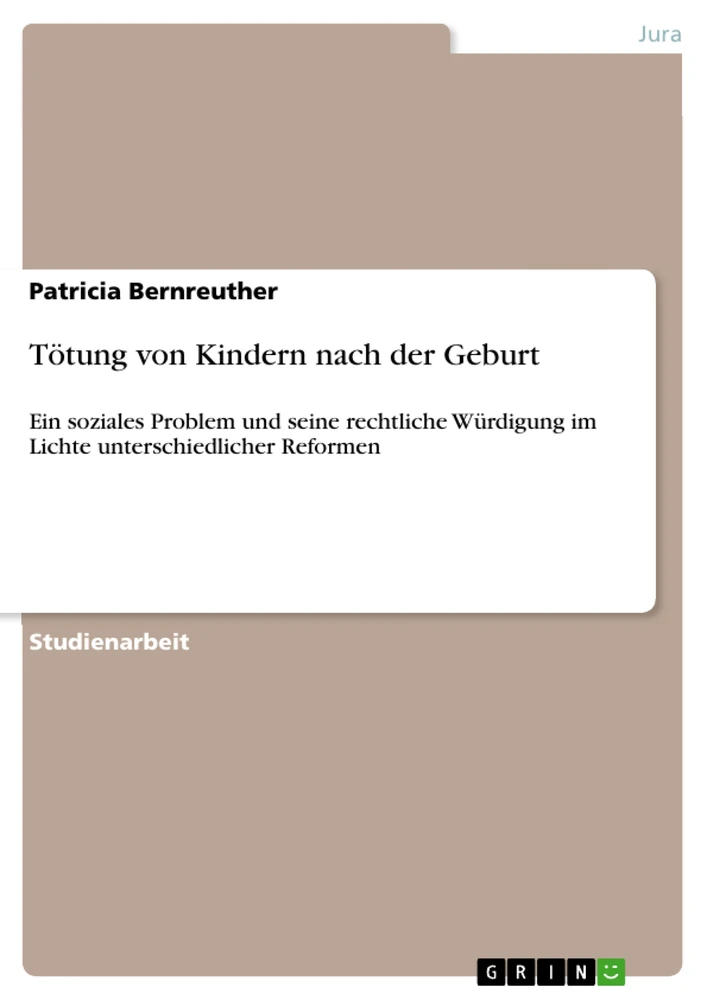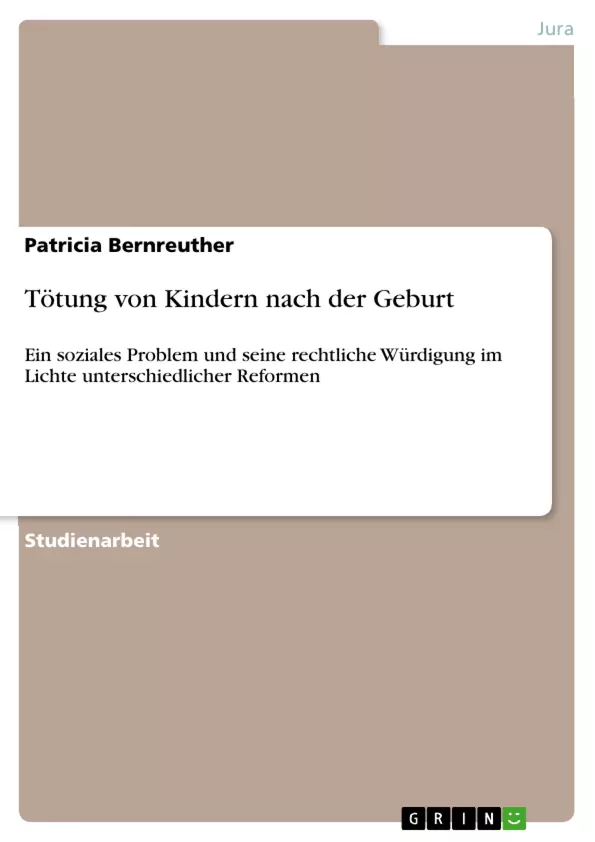„Welches sind die besten ausführbaren Mittel, dem Kindermord abzuhelfen, ohne die Unzucht zu begünstigen?“, so lautete eine Aufforderung der Zeitschrift „Rheinische Beiträge zur Gelehrsamkeit“ aus dem Jahre 1780 an ihre Leser sich mit der Thematik der Kindstötung auseinanderzusetzen. Der beste Vorschlag wurde mit einem Preisgeld von 100 Dukaten prämiert. Die Resonanz war mit 400 Zuschriften enorm. Die Thematik der Tötung von Kindern war auch zuvor und in der nachfolgenden häufig Gegenstand kontroverser Diskussionen. Handelte es sich bei den Tötungsopfern doch um Wesen, die mit das schwächste Glied einer Gesellschaft sind, auf deren Schultern aber große Hoffnungen für die Zukunft ruhen. Im Laufe der Jahrhunderte wurden unterschiedliche Wege beschritten, dem Delikt der Kindstötung Einhalt zu gebieten ohne auf Kosten der sittlichen Werte, die eine Gesellschaft ebenso prägen und zusammenhalten, zu handeln. Grundlage der Überlegungen waren die vermuteten Motive, weshalb eine Tötung von bestimmten Personen begangen wurde. Um die Entwicklung der Gesetzgebung nachvollziehen zu können, müssen auch die Umstände und Beweggründe dieser Tat betrachtet werden.
Inhaltsverzeichnis
- A. Einleitung
- B. Täterkreis
- C. Ausmaß
- D. Begehungsweise
- E. Motive für die Tötung
- I. Ehrennotstand
- II. Geschlechtszugehörigkeit
- III. Wirtschaftliche Not
- IV. Egoistische Gründe
- V. Ratlosigkeit
- VI. Geburtsaffekt
- VII. Negierte Schwangerschaft
- F. Historische Entwicklung
- I. Römische Antike
- II. Germanen
- III. Mittelalter
- IV. Constitutio Criminalis Carolina
- 1. Allgemeines
- 2. Tatbestand
- 3. Bestrafung
- V. Aufklärung
- VI. Partikulare Gesetzgebung bis 1871
- 1. Entwicklung in Preußen bis 1850
- 2. Entwicklung in anderen Staaten nach 1800
- 3. Entwicklung in Preußen nach 1850
- VII. Reichsstrafgesetzbuch von 1871
- VIII. Reformbestrebungen
- 1. Diskussionsgrundlage
- 2. Entwürfe
- IX. Zeit des Nationalsozialismus
- X. Zeit nach 1945
- XI. Lage nach dem 6. StrRG
- 1. § 212 Abs. 1 StGB
- 2. § 213 StGB
- 3. § 211 StGB
- a) Habgier
- b) Niedrige Beweggründe
- c) Heimtücke
- d) Grausam
- e) Verdeckungsabsicht
- f) §§ 20, 21 i. V. m. § 49 StGB
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem sozialen Problem der Tötung von Kindern nach der Geburt und dessen rechtlicher Würdigung im Lichte unterschiedlicher Reformen. Sie beleuchtet die historischen Entwicklungen der Gesetzesgebung, die sich immer wieder an die sich wandelnden gesellschaftlichen Verhältnisse anpassen musste. Zudem analysiert sie die verschiedenen Motive, die hinter der Kindstötung stehen können, sowie die Herausforderungen der Strafrechtsanwendung in Bezug auf dieses Delikt.
- Historische Entwicklung der rechtlichen Würdigung der Kindstötung
- Motivlage der Kindstötung: Ehrennotstand, Geschlechtszugehörigkeit, wirtschaftliche Not, egoistische Gründe, Ratlosigkeit, Geburtsaffekt, negierte Schwangerschaft
- Rechtliche Einordnung der Kindstötung im Lichte des heutigen Strafrechts
- Herausforderungen der Strafrechtsanwendung im Kontext der Kindstötung
- Diskussion um die angemessene rechtliche Würdigung der Kindstötung in einer modernen Gesellschaft
Zusammenfassung der Kapitel
- A. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Tötung von Kindern nach der Geburt ein und hebt deren Kontroversität und gesellschaftliche Relevanz hervor. Die Bedeutung der Motivlage für die Entwicklung der Gesetzgebung wird betont.
- B. Täterkreis: Dieses Kapitel beschreibt, dass in der Regel Mütter die Täterinnen sind, während Väter, nahen Angehörige oder nahe stehende Personen in seltenen Fällen beteiligt sind.
- C. Ausmaß: Hier wird die Schwierigkeit, verlässliche Zahlen zur Anzahl der Kindstötungen zu erheben, erläutert und die Dunkelziffer als hoch eingeschätzt. Es wird auf die statistische Aufbereitung durch die Polizeilichen Kriminalstatistik und die Schwierigkeit der Ermittlung genauer Zahlen eingegangen.
- D. Begehungsweise: Dieses Kapitel beschreibt die häufigsten Methoden der Kindstötung wie Ersticken, Erwürgen, Schütteln oder Ertränken und hebt das Unterlassen, wie das Unversorgt-Liegenlassen des Kindes, als häufiges Vorgehen bei Neonatiziden hervor.
- E. Motive für die Tötung: Dieses Kapitel erläutert verschiedene Motive für die Tötung von Kindern nach der Geburt, darunter Ehrennotstand, Geschlechtszugehörigkeit, wirtschaftliche Not, egoistische Gründe, Ratlosigkeit, Geburtsaffekt und negierte Schwangerschaft.
- F. Historische Entwicklung: Dieses Kapitel verfolgt die Entwicklung der Kindstötung durch die Jahrhunderte, beginnend mit der römischen Antike, den Germanen und dem Mittelalter, bis hin zur Constitutio Criminalis Carolina und der Aufklärung. Es beleuchtet die jeweiligen rechtlichen Rahmenbedingungen und die sich ändernde gesellschaftliche Wahrnehmung.
- I. Römische Antike: In der römischen Antike lag das Recht über Leben und Tod der Kinder beim Vater. Es wird auf die Voraussetzungen für eine rechtlich zulässige Kindstötung und die Bestrafung der Mutter eingegangen.
- II. Germanen: Bei den Germanen lag das Recht über das Leben des Kindes beim Vater, bis das Kind durch eine Art Taufe ein Recht auf Leben erlangte. Die Tötung durch die Mutter wurde unterschiedlich bestraft.
- III. Mittelalter: Im Mittelalter wurde die Kindstötung durch die Mutter als ein besonders schweres Delikt, als Verwandtenmord, angesehen, welches mit grausamen Todesstrafen bestraft wurde.
- IV. Constitutio Criminalis Carolina: Dieses Kapitel beschreibt die Peinliche Halsgerichtsordnung von 1532, welche erstmals ein einheitliches Strafgesetz für das gesamte deutsche Reich lieferte. Die Kindstötung durch die Mutter wurde zu einem eigenen Tatbestand und nicht mehr als Verwandtenmord gesehen. Der Artikel 131 der CCC beschreibt den Tatbestand und die Bestrafung, welche in der Regel mit dem lebendig Begraben oder Pfählen erfolgte.
- V. Aufklärung: Im 18. Jahrhundert kam es zu einem Bewusstseinswandel und die Hinrichtung der Täterin wurde immer mehr hinterfragt. Es wird auf alternative Methoden zur Vermeidung von Kindstötungen, wie verstärkte Polizeikontrollen und Gebäranstalten, eingegangen. Zudem wird der Fokus auf die Motive der Täterin und die Diskussion um die Milderung der Strafe gelegt.
- VI. Partikulare Gesetzgebung bis 1871: Dieses Kapitel behandelt die Entwicklung der Kindstötung in der Gesetzgebung der einzelnen Länder, insbesondere in Preußen, sowie in anderen Staaten, und verfolgt die Abschaffung der Todesstrafe, die Einführung von Freiheitsstrafen, die zunehmende Privilegierung der Mütter und die verschiedenen Kriterien, die für die Strafhöhe maßgeblich waren.
- VII. Reichsstrafgesetzbuch von 1871: Das Reichsstrafgesetzbuch von 1871 übernahm den Tatbestand der Kindstötung, § 217 RStGB, mit geringerer Mindeststrafe. Es wird die Definition des Tatbestandes erläutert und die unterschiedlichen Auffassungen der Rechtsprechung und Literatur über die rechtliche Einordnung der Kindstötung.
- VIII. Reformbestrebungen: Dieses Kapitel beschreibt die verschiedenen Strömungen, die zur Diskussion um die Kindstötung im frühen 20. Jahrhundert führten und die Begründungen für die fortdauernde Privilegierung der Mütter lieferten. Es werden verschiedene Entwürfe und Vorschläge zur Reform der Kindstötung vorgestellt.
- IX. Zeit des Nationalsozialismus: Während der Zeit des Nationalsozialismus stand der Schutz des Kindes im Mittelpunkt der Diskussion, da es als besonders wertvoll für die Volksgemeinschaft angesehen wurde. Es wird auf den Entwurf von 1933, der die Privilegierung der Kindstötung streichen wollte, eingegangen.
- X. Zeit nach 1945: Dieses Kapitel beschreibt die Entwicklung der Gesetzgebung zur Kindstötung nach 1945. Es wird auf die erste Änderung des § 217 RStGB durch das 3. Strafänderungsgesetz von 1953, die Senkung der Mindeststrafe bei mildernden Umständen, eingegangen.
- XI. Lage nach dem 6. StrRG: Dieses Kapitel erläutert die Aufhebung des § 217 StGB durch das Sechste Gesetz zur Reform des Strafrechts von 1998. Es wird auf die Anwendung der allgemeinen Tötungsdelikte, insbesondere § 212 Abs. 1 StGB, § 213 StGB und § 211 StGB, im Kontext der Kindstötung eingegangen und die Anwendung der Mordmerkmale sowie die Möglichkeit der Strafmilderung erläutert.
Schlüsselwörter
Kindstötung, Neonatizid, Totschlag, Mord, Strafrechtsgeschichte, Ehrennotstand, Geburtsaffekt, negierte Schwangerschaft, Strafmilderung, Privilegierung, Rechtssoziologie, Kriminalsoziologie, allgemeine Tötungsdelikte.
Häufig gestellte Fragen
Welche Motive führen historisch zur Tötung von Kindern nach der Geburt?
Häufige Motive waren Ehrennotstand (Scham bei unehelichen Kindern), wirtschaftliche Not, Ratlosigkeit, Geburtsaffekte oder die Negierung der Schwangerschaft.
Wie beurteilte die Constitutio Criminalis Carolina (1532) die Kindstötung?
Die CCC sah die Kindstötung als eigenes Delikt an, das oft grausam bestraft wurde, etwa durch lebendiges Begraben oder Pfählen.
Warum wurde die Kindstötung im Strafrecht lange Zeit privilegiert?
Man ging davon aus, dass Mütter unehelicher Kinder sich in einer extremen psychischen Ausnahmesituation (Ehrennotstand) befanden, was eine mildere Strafe als bei gewöhnlichem Mord rechtfertigte.
Wie ist die aktuelle Rechtslage in Deutschland seit 1998?
Mit dem 6. Strafrechtsreformgesetz wurde der spezielle Tatbestand der Kindstötung (§ 217 StGB a.F.) aufgehoben. Heute finden die allgemeinen Tötungsdelikte wie Mord oder Totschlag Anwendung.
Wer gehört meist zum Täterkreis bei Neonatiziden?
In der Regel sind die leiblichen Mütter die Täterinnen, oft in Verbindung mit einer verheimlichten oder verdrängten Schwangerschaft.
- Quote paper
- Patricia Bernreuther (Author), 2012, Tötung von Kindern nach der Geburt, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/270053