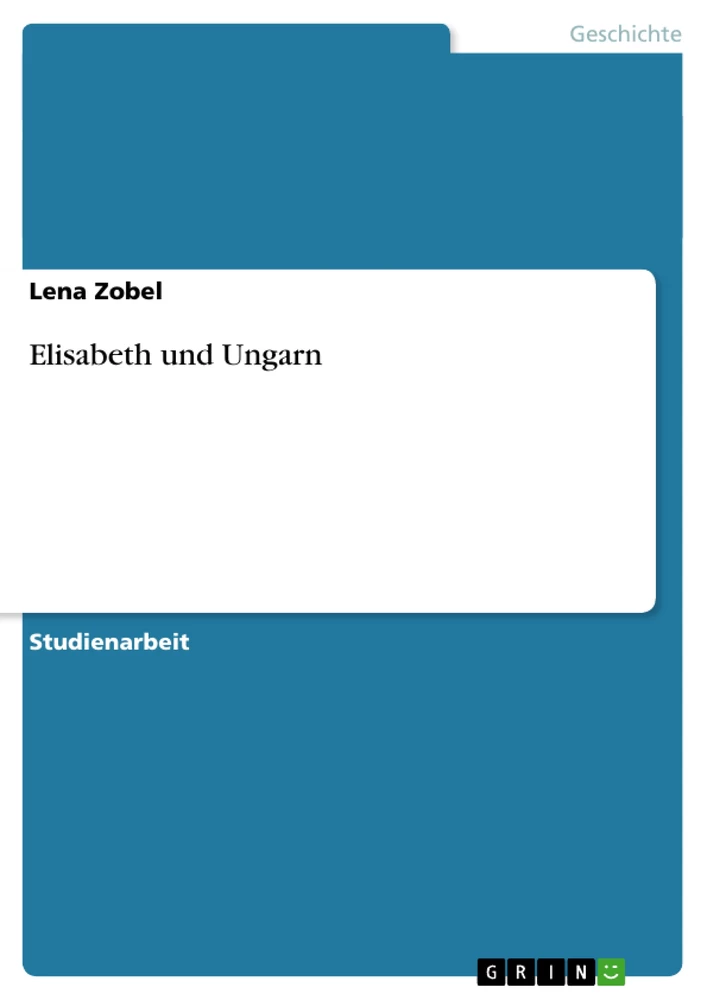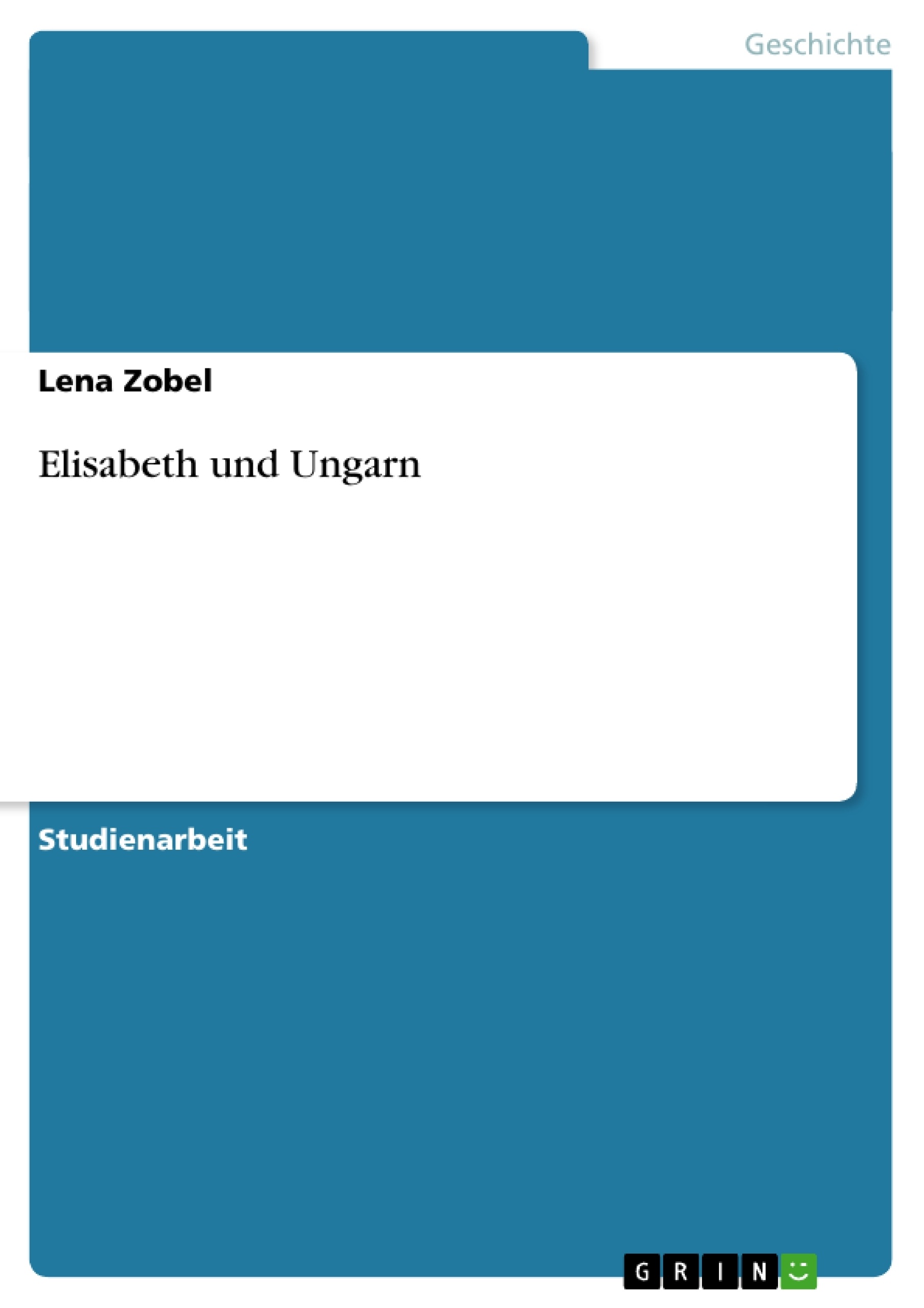„Sehen Sie, wenn des Kaisers Angelegenheiten in Italien schlecht gehen, so schmerzt es mich; wenn aber das gleiche in Ungarn der Fall ist, so tötet mich das.“
Diese Worte, die Elisabeth, Kaiserin von Österreich, an den Grafen Gyula Andrássy gerichtet haben soll, zeigen wie verbunden Sie sich mit Ungarn fühlte. Die folgende Arbeit beschäftigt sich mit dem Verhältnis der Kaiserin Elisabeth von Österreich mit Ungarn. Es soll dabei geklärt werden, wieweit die einzige politische Interaktion Elisabeths zur Entstehung des Doppelstaates Österreich-Ungarn 1867 beigetragen hat.
Die am 24.12.1837 in München geborene bayrische Prinzessin mit dem Spitznamen Sisi, heiratete am 24.4.1854 in Wien den Kaiser Franz Joseph von Österreich. Seit ihrem Einzug in die Wiener Hofburg bereitete ihr die Rolle als Repräsentantin des Kaiserhauses Probleme. Sie galt als Scheu und versuchte den öffentlichen Auftritten zu entfliehen. Für die Politik interessierte sie sich nie. Sie verbrachte die meiste Zeit mit Reisen um der Wiener Hofgesellschaft zu entkommen und ging in ihrem Schönheitskult auf. Sie gebar dem Kaiser insgesamt vier Kinder, drei Töchter und den Thronfolger Rudolf. Während der Kaiser seine Frau bis zum Ende ihres Lebens vorbehaltlos liebte, stand für Elisabeth ihre eigene Freiheit immer an erster Stelle. Nachdem Sie ihr Ziel für Ungarn erreicht hatte, zog sie sich immer weiter von dem Kaiser und dem Wiener Hofleben zurück und beschäftigte sich mit ihrer Schönheitspflege, dem Turnen, Reisen und schrieb Gedichte. Am 10.9.1898 wurde Elisabeth von dem italienischen Anarchisten Luigi Lucheni mit einer Feile erstochen. Der Einsatz für Ungarn war ihre einziges Eingreifen in die Politik.
Warum also stellte sie ihre Kraft in den Dienst der „ungarischen Sache“? Diese Frage soll in der Schlussbetrachtung an Hand der dargestellten Ereignisse geklärt werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Erste Annäherung mit Ungarn
- 3. Graf Andrássy
- 4. Krieg mit Preußen
- 5. Der Ausgleich
- 6. Die Krönung
- 7. Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Verhältnis zwischen Kaiserin Elisabeth von Österreich und Ungarn und klärt, inwieweit Elisabeths politische Interaktion zur Entstehung des Doppelstaates Österreich-Ungarn 1867 beitrug. Der Fokus liegt auf Elisabeths Motivation, sich für die „ungarische Sache“ einzusetzen, und den Umständen, die zu ihrem Engagement führten.
- Elisabeths persönliche Beziehung zu Ungarn
- Der Einfluss der Wiener Hofgesellschaft auf Elisabeths Haltung
- Die Rolle von Graf Andrássy
- Die Bedeutung Ungarns im Kontext der österreichischen Politik
- Elisabeths Beitrag zum Ausgleich von 1867
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt die zentrale Forschungsfrage nach Elisabeths Engagement für die ungarische Sache und deren Einfluss auf die Entstehung des Doppelstaates Österreich-Ungarn. Sie erwähnt ein Zitat Elisabeths, das ihre tiefe Verbundenheit mit Ungarn verdeutlicht und die Grundlage für die gesamte Arbeit bildet. Der biografische Kontext Elisabeths wird kurz skizziert, wobei ihre Abneigung gegen das Wiener Hofleben und ihr späterer Rückzug aus dem öffentlichen Leben hervorgehoben werden. Die Arbeit konzentriert sich auf Elisabeths einziges politisches Engagement – ihren Einsatz für Ungarn.
2. Erste Annäherungen mit Ungarn: Dieses Kapitel beschreibt die Entstehung von Elisabeths Sympathie für Ungarn. Ihre Abneigung gegen die Wiener Hofgesellschaft und deren Ablehnung gegenüber den Ungarn wird als wichtiger Faktor genannt. Der ungarische Aufstand von 1848/49 und die darauffolgende Unterdrückung Ungarns durch Österreich werden als historischer Hintergrund präsentiert. Die zunehmende Bedeutung Ungarns für Österreich nach dem Verlust der Lombardei und angesichts des drohenden Konflikts mit Preußen wird hervorgehoben. Die Einführung von Personen wie Lily Hunyády und Ida Ferenczy in Elisabeths Leben und deren Einfluss auf ihre Annäherung an die ungarische Sache werden detailliert beschrieben. Der Kapitel zeigt, wie Elisabeths Sprachstudium und die enge Freundschaft mit Ida Ferenczy – einer Verbindung mit Verbindungen zur ungarischen liberalen Bewegung – die politische Orientierung der Kaiserin prägten.
3. Graf Andrássy: Das Kapitel konzentriert sich auf die Figur Graf Gyula Andrássy, ein bedeutender ungarischer Politiker. Seine Beteiligung am Aufstand von 1848/49, sein Exil und seine spätere Rückkehr nach Ungarn werden detailliert dargestellt. Seine politischen Fähigkeiten und seine Rolle als Bindeglied zwischen der liberalen ungarischen Partei und dem Ausland werden betont. Die erste Begegnung zwischen Elisabeth und Andrássy wird erwähnt und legt den Grundstein für zukünftige Interaktionen und den Einfluss Andrássys auf die Kaiserin. Das Kapitel unterstreicht Andrássys diplomatische Fähigkeiten und sein Netzwerk, als Schlüssel zum Erfolg der ungarischen Anliegen.
Schlüsselwörter
Kaiserin Elisabeth, Ungarn, Österreich-Ungarn, Ausgleich 1867, Graf Andrássy, Wiener Hofgesellschaft, ungarischer Liberalismus, politisches Engagement, nationaler Widerstand.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Kaiserin Elisabeth und der Ausgleich von 1867
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht das Verhältnis zwischen Kaiserin Elisabeth von Österreich und Ungarn und klärt, inwieweit Elisabeths politische Interaktion zur Entstehung des Doppelstaates Österreich-Ungarn 1867 beitrug. Der Fokus liegt auf Elisabeths Motivation, sich für die „ungarische Sache“ einzusetzen, und den Umständen, die zu ihrem Engagement führten.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt Elisabeths persönliche Beziehung zu Ungarn, den Einfluss der Wiener Hofgesellschaft auf Elisabeths Haltung, die Rolle von Graf Andrássy, die Bedeutung Ungarns im Kontext der österreichischen Politik und Elisabeths Beitrag zum Ausgleich von 1867.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in sieben Kapitel: Einleitung, Erste Annäherungen mit Ungarn, Graf Andrássy, Krieg mit Preußen, Der Ausgleich, Die Krönung und Schlussbetrachtung. Die Zusammenfassung der Kapitel bietet detaillierte Einblicke in den Inhalt jedes Kapitels.
Welche Rolle spielte Graf Andrássy?
Graf Gyula Andrássy, ein bedeutender ungarischer Politiker, wird als Schlüsselfigur dargestellt. Seine Beteiligung am Aufstand von 1848/49, sein Exil, seine politische Fähigkeiten und seine Rolle als Bindeglied zwischen der liberalen ungarischen Partei und dem Ausland werden detailliert beschrieben. Seine Interaktion mit Kaiserin Elisabeth und sein Einfluss auf sie werden hervorgehoben.
Wie wird Elisabeths Engagement für die "ungarische Sache" erklärt?
Elisabeths Abneigung gegen die Wiener Hofgesellschaft und deren Ablehnung gegenüber den Ungarn, der ungarische Aufstand von 1848/49 und die darauffolgende Unterdrückung, sowie der Einfluss von Personen wie Lily Hunyády und Ida Ferenczy auf Elisabeth werden als wichtige Faktoren genannt, die zu ihrer Sympathie für die ungarische Sache führten.
Welche Bedeutung hat der Ausgleich von 1867?
Der Ausgleich von 1867 ist ein zentrales Thema der Arbeit. Elisabeths Beitrag zu diesem historischen Ereignis und die Umstände, die zu seiner Entstehung führten, werden umfassend analysiert.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Kaiserin Elisabeth, Ungarn, Österreich-Ungarn, Ausgleich 1867, Graf Andrássy, Wiener Hofgesellschaft, ungarischer Liberalismus, politisches Engagement, nationaler Widerstand.
Wie wird die Einleitung gestaltet?
Die Einleitung stellt die zentrale Forschungsfrage nach Elisabeths Engagement für die ungarische Sache und deren Einfluss auf die Entstehung des Doppelstaates Österreich-Ungarn. Sie erwähnt ein Zitat Elisabeths und skizziert den biografischen Kontext, wobei ihre Abneigung gegen das Wiener Hofleben und ihr späterer Rückzug aus dem öffentlichen Leben hervorgehoben werden.
- Quote paper
- Lena Zobel (Author), 2003, Elisabeth und Ungarn, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/27012