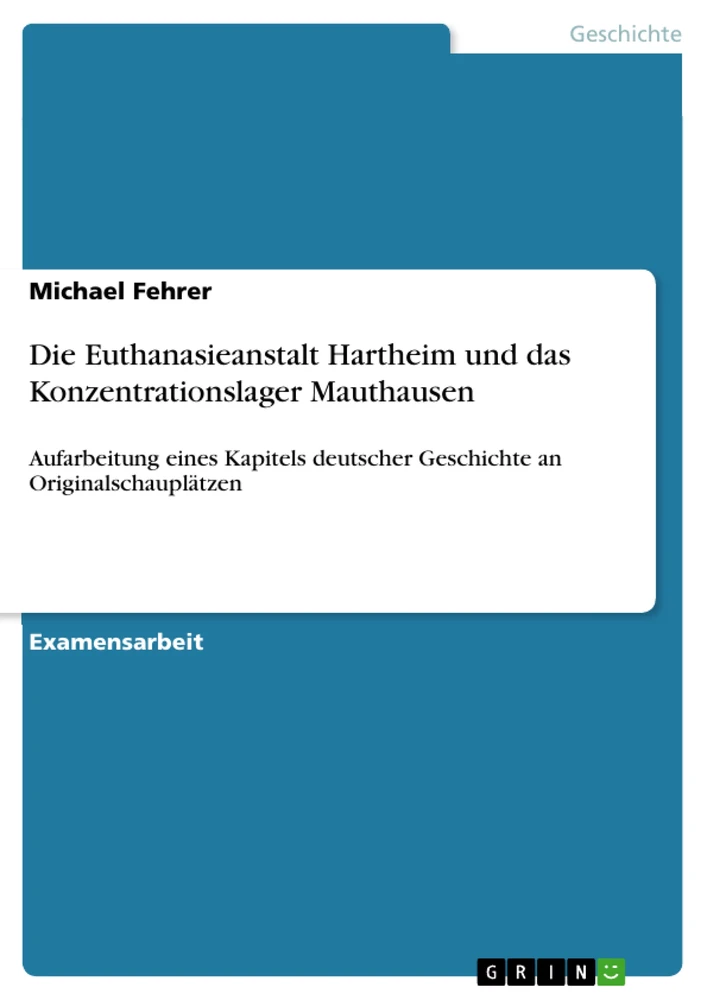Im Rahmen des GSE-Unterrichts der 8. Jahrgangsstufe wird der Themenbereich 8.6 Demokratie und NS-Diktatur behandelt. Ausgehend von einem demokratischen System, der Weimarer Republik, das ins Wanken gerät, erfahren die Schüler, wie allmählich die NS-Diktatur errichtet werden konnte und diese immer mehr Zustimmung in der Bevölkerung erhält. Den Jugendlichen wird das unermessliche Leid vieler Menschen, das durch Diskriminierung und Verfolgung hervorgerufen wurde, bewusst. Durch den Besuch der Euthanasieanstalt Hartheim und des Konzentrationslagers Mauthausen machen sich die Jugendlichen ein eigenes Bild von Überresten des vermutlich finstersten Kapitels deutscher Geschichte.
Im Abschnitt „Grundwissen und Kernkompetenzen“ ab der Jahrgangsstufe 8 führt der Lehrplan folgende Punkte auf:
- wissen, dass im Nationalsozialismus mit terroristischen, menschenverachtenden Mitteln Herrschaft gesichert und ideologische Vorstellungen durchgesetzt wurden
- wissen, dass der Zweite Weltkrieg (1939-1945) unsägliches Leid über die Menschen brachte
Inhaltsverzeichnis
- Vorbemerkung
- Theoretische Grundlegung
- Einblick in den geschichtlichen Hintergrund
- Historische Orte als Lernorte
- Unterrichtspraktische Umsetzung
- Lehrplanbezug
- Vorbereitung des Besuchs der Gedenkstätten
- Stellung von Behinderten in der Gesellschaft – heute und früher (1. UE)
- Das nationalsozialistische Euthanasieprogramm (2. UE)
- Lebensspuren in Hartheim (3. UE)
- Das Konzentrationslager Mauthausen (4. UE)
- Besuch der Gedenkstätten
- Schloss Hartheim
- Konzentrationslager Mauthausen
- Nachbereitung
- Bischof von Galen (5. UE)
- Fächerübergreifende Thematisierung
- Reflexion und Fazit
- Schülerbeobachtungen
- Persönliche Reflexion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit beschreibt die didaktische Konzeption und Umsetzung einer Exkursion zu den Originalschauplätzen der Euthanasieanstalt Hartheim und des Konzentrationslagers Mauthausen im Rahmen des Geschichtsunterrichts der 8. Jahrgangsstufe. Ziel ist es, den Schülerinnen und Schülern die Geschichte des Nationalsozialismus, insbesondere die Euthanasie und die Verbrechen in Konzentrationslagern, auf unmittelbare und eindrückliche Weise nahezubringen.
- Die Geschichte der nationalsozialistischen Euthanasiepolitik
- Die Rolle von Behinderten in der NS-Gesellschaft
- Das Funktionieren und die Auswirkungen des NS-Terrorsystems
- Die Bedeutung historischer Orte als Lernorte
- Methoden der Geschichtsvermittlung an Originalschauplätzen
Zusammenfassung der Kapitel
Vorbemerkung: Diese Einleitung betont die Bedeutung des respektvollen Umgangs mit behinderten Menschen im Kontrast zur menschenverachtenden Behindertenvernichtungspolitik des Nationalsozialismus. Sie verortet die Thematik auch im regionalen Kontext der Hauptschule Schöllnach, indem sie auf ein dort ansässiges Erbgesundheitsgericht und ein Städtisches Krankenhaus hinweist, wo Zwangssterilisationen und Abtreibungen durchgeführt wurden. Der Abschnitt dient als emotionale und faktische Einführung in die Thematik und unterstreicht die Notwendigkeit der Aufarbeitung dieser geschichtlichen Ereignisse.
Theoretische Grundlegung: Einblick in den geschichtlichen Hintergrund: Dieses Kapitel beleuchtet den historischen Kontext des nationalsozialistischen Euthanasieprogramms, beginnend mit Hitlers Geheimbefehl von 1939. Es beschreibt die Tarnorganisationen, die die Mordaktionen verschleierten, und die systematische Tötung von "lebensunwertem Leben". Die Vorgehensweise, von der Meldepflicht der Heilanstalten bis zur Ermordung in Gaskammern, wird detailliert dargestellt, inklusive der zynischen Tarnbegriffe und der erschreckenden Bilanz von über 70.000 ermordeten Menschen. Die hohe Opferzahl in Hartheim wird als Begründung für den Besuch dieser Gedenkstätte hervorgehoben.
Theoretische Grundlegung: Historische Orte als Lernorte: Dieses Kapitel befasst sich mit der didaktischen Bedeutung historischer Orte. Es diskutiert die Definition und das Potential historischer Orte für den Geschichtsunterricht, betont deren Authentizität, Anschaulichkeit und die Möglichkeit des multiperspektivischen Lernens. Die permanente Verfügbarkeit und die sinnliche Erfahrbarkeit vor Ort werden als entscheidende Vorteile gegenüber anderen Lernmaterialien herausgestellt. Es wird erklärt, wie die Imagination der Schüler durch den direkten Kontakt mit den historischen Überresten angeregt und gefördert werden kann. Der Abschnitt bereitet methodisch und didaktisch auf den Besuch der Gedenkstätten vor.
Unterrichtspraktische Umsetzung: Vorbereitung des Besuchs der Gedenkstätten: Dieser Abschnitt beschreibt detailliert die Vorbereitung der Schüler auf den Besuch der Gedenkstätten. Es werden die einzelnen Unterrichtseinheiten im Detail erläutert, die die Schüler auf die Thematik der Euthanasie und der Konzentrationslager vorbereiten. Die methodischen Ansätze, wie die Arbeit mit Originalgegenständen (Outreach-Koffer), die Auswertung von Dokumenten und die Arbeit mit Filmen werden beschrieben. Die Vorbereitung soll die Schüler emotional auf die Begegnung mit den Originalschauplätzen vorbereiten.
Unterrichtspraktische Umsetzung: Besuch der Gedenkstätten: Dieser Abschnitt beschreibt den Ablauf der Exkursionen nach Hartheim und Mauthausen. Die Führungen werden detailliert dargestellt, mit Fokus auf die nachvollziehbare Darstellung des Leidenswegs der Opfer. Die didaktischen Überlegungen, wie z.B. den Weg der Häftlinge nachzuempfinden, werden erläutert. Die Bedeutung der einzelnen Orte und die verschiedenen Ausstellungsstücke innerhalb der Gedenkstätten werden beschrieben. Der Besuch soll die zuvor vermittelten Informationen durch unmittelbare Erfahrung vertiefen.
Unterrichtspraktische Umsetzung: Nachbereitung: Die Nachbereitung des Besuchs der Gedenkstätten wird hier beschrieben, inklusive der emotionalen Aufarbeitung der Eindrücke und der Diskussion der Themen. Die Schüler sollen die Möglichkeit erhalten, ihre Gefühle und Gedanken zu dem Gesehenen auszudrücken. Die Person des Bischofs von Galen wird als Beispiel für den Widerstand gegen das NS-Regime vorgestellt und die Schüler sollen Argumente für und gegen Widerstand erarbeiten und diskutieren. Ein kreatives Projekt – die Erstellung eines symbolischen Buches der Opfer – soll die unfassbare Zahl der Opfer verdeutlichen.
Reflexion und Fazit: Dieser Abschnitt reflektiert die Erfahrungen mit dem Projekt. Die positive Resonanz der Schüler auf den Besuch der Gedenkstätten wird hervorgehoben. Es wird diskutiert, welche Aspekte besonders wirksam waren und wo es Verbesserungsbedarf gibt. Der Autor betont die Bedeutung des Gedenkstättenbesuchs als essentiellen Bestandteil der Geschichtsvermittlung zum Nationalsozialismus und die Kombination aus Faktenvermittlung und emotionaler Auseinandersetzung.
Schlüsselwörter
Euthanasie, Nationalsozialismus, Konzentrationslager Mauthausen, Euthanasieanstalt Hartheim, Behinderte, „lebensunwertes Leben“, Rassenhygiene, Gedenkstätte, Geschichtsdidaktik, Originalitätsprinzip, Schüleraktivitäten, Bischof von Galen, Widerstand.
Häufig gestellte Fragen zur Didaktischen Konzeption einer Exkursion nach Hartheim und Mauthausen
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Das Dokument beschreibt die didaktische Konzeption und Umsetzung einer Exkursion zu den Gedenkstätten Hartheim und Mauthausen für den Geschichtsunterricht der 8. Jahrgangsstufe. Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Kapitelzusammenfassungen, und Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf der Vermittlung der nationalsozialistischen Euthanasiepolitik und der Verbrechen in Konzentrationslagern durch einen unmittelbaren Kontakt mit den Originalschauplätzen.
Welche Themen werden behandelt?
Die zentralen Themen sind die nationalsozialistische Euthanasiepolitik, die Rolle von Behinderten in der NS-Gesellschaft, das Funktionieren und die Auswirkungen des NS-Terrorsystems, die Bedeutung historischer Orte als Lernorte und Methoden der Geschichtsvermittlung an Originalschauplätzen. Konkret werden die Euthanasieanstalt Hartheim und das Konzentrationslager Mauthausen behandelt, inklusive der Vorbereitung der Schüler, des Besuchs selbst und der anschließenden Nachbereitung.
Wie ist die Exkursion didaktisch aufgebaut?
Die Exkursion gliedert sich in drei Phasen: Vorbereitung, Besuch und Nachbereitung. Die Vorbereitung umfasst Unterrichtseinheiten zur Geschichte der Euthanasie und der Konzentrationslager, unter Verwendung verschiedener Methoden wie die Arbeit mit Originalgegenständen und Filmen. Der Besuch selbst beinhaltet geführte Touren durch die Gedenkstätten. Die Nachbereitung dient der emotionalen Aufarbeitung der Eindrücke und der Diskussion der Themen, inklusive der Auseinandersetzung mit dem Widerstand, beispielsweise anhand der Person des Bischofs von Galen.
Welche Rolle spielen die Gedenkstätten Hartheim und Mauthausen?
Die Gedenkstätten Hartheim und Mauthausen dienen als Originalschauplätze, um den Schülern die Geschichte des Nationalsozialismus auf unmittelbare und eindrückliche Weise nahezubringen. Der direkte Kontakt mit den historischen Orten soll die zuvor vermittelten Informationen vertiefen und die Schüler emotional stärker ansprechen als andere Lernmaterialien.
Welche Ziele werden mit der Exkursion verfolgt?
Die Exkursion zielt darauf ab, den Schülern die Geschichte des Nationalsozialismus, insbesondere die Euthanasie und die Verbrechen in Konzentrationslagern, auf unmittelbare und eindrückliche Weise nahezubringen. Sie soll das Verständnis für die NS-Verbrechen fördern und die Bedeutung des Gedenkens und des Umgangs mit der Geschichte verdeutlichen.
Wie wird die emotionale Verarbeitung der Schüler berücksichtigt?
Die emotionale Verarbeitung der Schüler wird sowohl in der Vorbereitung als auch in der Nachbereitung der Exkursion berücksichtigt. Die Vorbereitung soll die Schüler auf die emotional herausfordernden Inhalte vorbereiten. Die Nachbereitung bietet Raum für die Aufarbeitung der Eindrücke und die Diskussion der Gefühle und Gedanken der Schüler.
Welche Methoden werden eingesetzt?
Es werden verschiedene Methoden eingesetzt, darunter die Arbeit mit Originalgegenständen (Outreach-Koffer), die Auswertung von Dokumenten, die Arbeit mit Filmen, geführte Touren durch die Gedenkstätten und kreative Projekte wie die Erstellung eines symbolischen Buches der Opfer.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Text?
Schlüsselwörter sind: Euthanasie, Nationalsozialismus, Konzentrationslager Mauthausen, Euthanasieanstalt Hartheim, Behinderte, „lebensunwertes Leben“, Rassenhygiene, Gedenkstätte, Geschichtsdidaktik, Originalitätsprinzip, Schüleraktivitäten, Bischof von Galen, Widerstand.
- Arbeit zitieren
- Michael Fehrer (Autor:in), 2007, Die Euthanasieanstalt Hartheim und das Konzentrationslager Mauthausen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/270141