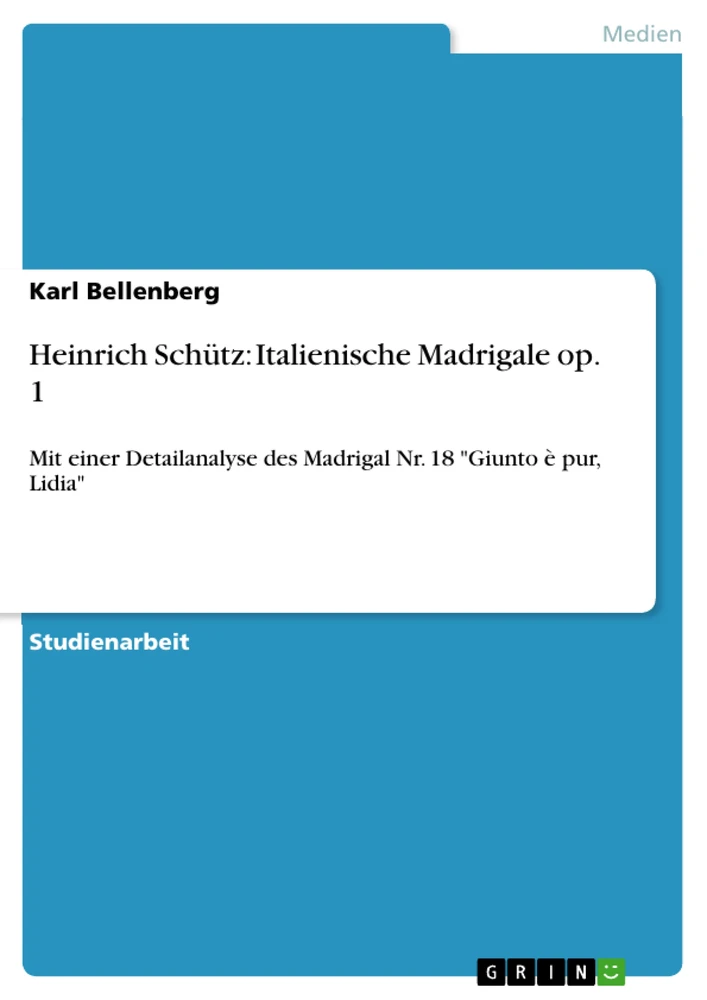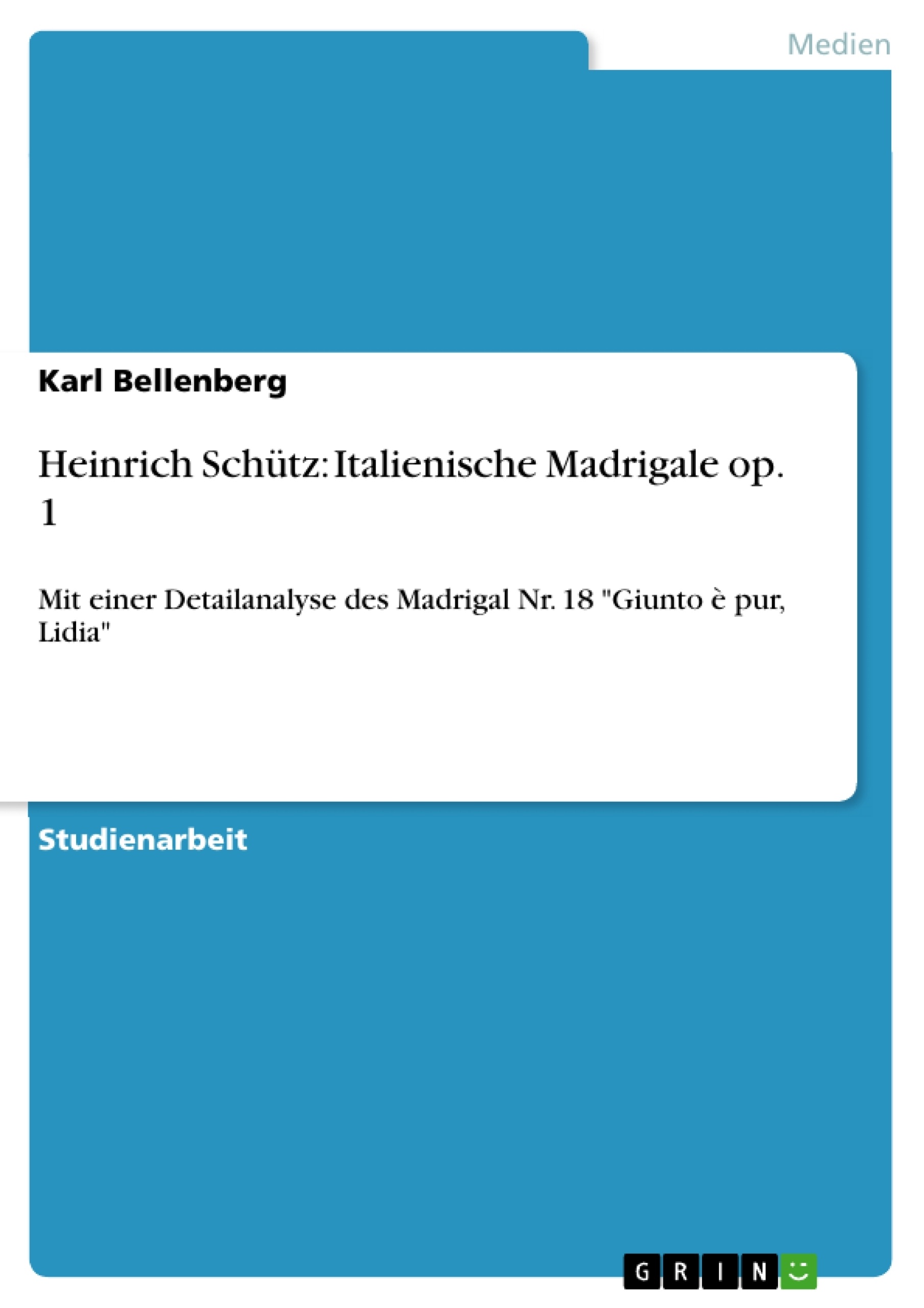Heinrich Schütz, der große musikalische Exeget vor J.S. Bach, prägte die Musik seiner komponierenden Zeitgenossen wie kein anderer. Früh bekam er "Bildungsurlaub" von seinem Dienstherrn Markgrafen Moritz von Hessen, der ihm einen vier Jahre währenden Venedig-Aufenthalt (1609 -1613) sponserte. Er ging in die Lehre bei Giovanni Gabrieli und lieferte als quasi "Meisterstück seiner Orgel- und Kompositionsstudien" seine Italienischen Madrigale op. 1 ab und legte sie am 1. Mai 1611 im Druck der staunenden Fachwelt vor.
Schütz versteht es, Worte und sprachliche Gesten in musikalische Rede zu wandeln, die unmittelbar für sich spricht. Dies zeichnet ihn vor allen Kompositionaskollegen seiener Zeit aus und wirkt auf sie prägend.
Das 18. Madrigal wird einer zunächst semantischen Analyse unterzogen. Sodann wird gezeigt, wie Schütz den Text feinsinnig musikalisch ausdeutet.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Der Werkzyklus und seine Position im Genre »Madrigal«.
- 1.1 Gegenstand und geschichtlicher Rahmen
- 1.2 Das italienische »Madrigal«, wesentliche Aspekte
- 2. Das 18. Madrigal »Giunto è pur Lidia«.
- 2.1 Textanalyse
- 2.2 Die äußere Form
- 2.3 Binnenstrukturen und die musikalische Rede.
- 2.3.1 Soggetto 1
- 2.3.2 Soggetto 2
- 2.3.3 Soggetto 3
- 2.3.4 Soggetto 4
- 2.3.5 Soggetto 5
- 2.3.6 Soggetto 6
- 3. Conclusio
- 4. Anhang.
- 4.1 Die sechs Soggetti des 18. Madrigals.
- 4.2 Die kommentierte Partitur des 18. Madrigals
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Heinrich Schütz' Italienische Madrigale op. 1, insbesondere das 18. Madrigal "Giunto è pur, Lidia". Die Zielsetzung ist eine detaillierte Analyse des Werkes im Kontext des italienischen Madrigal-Genres und der venezianischen Schule, unter Berücksichtigung der musikalischen und textlichen Aspekte.
- Schütz' Italienreise und seine Ausbildung bei Giovanni Gabrieli
- Das italienische Madrigal: stilistische Merkmale und Entwicklung
- Formale und musikalische Analyse des 18. Madrigals
- Beziehung zwischen Text und Musik in Schütz' Madrigalen
- Die Bedeutung von Schütz' Madrigalen für die Entwicklung der deutschen Musik
Zusammenfassung der Kapitel
1. Der Werkzyklus und seine Position im Genre »Madrigal«: Dieses Kapitel beleuchtet den geschichtlichen Kontext der Entstehung von Schütz' Italienischen Madrigalen. Es beschreibt die Entstehung des Zyklus als ein "Meisterstück" während Schütz' Venedigaufenthalts (1609-1613) und betont dessen hohe Qualität im Vergleich zu Arbeiten anderer Schüler Gabrielis. Der Fokus liegt auf der Widmung an den Markgrafen Moritz von Hessen, der im einleitenden Text überschwänglich gelobt wird. Das Kapitel erläutert zudem die Einflüsse Giovanni Gabrielis, insbesondere die Prinzipien der Wortausdeutung und der räumlichen Darstellung in der Musik, und ihren Niederschlag in Schütz' Werk. Schließlich wird die Bedeutung der Madrigale für die internationale Anerkennung deutscher Musik hervorgehoben und der Zweck der Beschäftigung Schütz' mit weltlicher Musik im Kontext seiner protestantischen Überzeugung diskutiert.
1.2 Das italienische »Madrigal«, wesentliche Aspekte: Dieses Kapitel gibt einen umfassenden Überblick über die Geschichte und die stilistischen Merkmale des italienischen Madrigals. Es verfolgt die Entwicklung des Genres vom frühen 14. Jahrhundert bis zum Ende des 16. Jahrhunderts, wobei die bedeutenden Vertreter wie Petrarca, Michelangelo und Tasso sowie die unterschiedlichen Stilepochen (Florentiner Madrigal, Venezianische Schule) beleuchtet werden. Der Wandel vom leichtfüßigen, akkordischen Stil zu einer dichteren, wort-imitierenden Polyphonie wird detailliert beschrieben. Der Kapitel erläutert auch die verschiedenen Formen des Madrigals, inklusive mehrstimmiger Kompositionen und Solomadrigale mit Instrumentalbegleitung, und deren Verwendung in Oper und Oratorien. Besonderes Augenmerk liegt auf dem Übergang von der "prima pratica" zur "seconda pratica" und den damit verbundenen stilistischen Veränderungen, die auch in Schütz' Werken erkennbar sind.
Schlüsselwörter
Heinrich Schütz, Italienische Madrigale, op. 1, Giovanni Gabrieli, Venezianische Schule, Madrigal, Polyphonie, Textvertonung, Wortausdeutung, prima pratica, seconda pratica, Stilwandel, deutsche Musikgeschichte.
Heinrich Schütz' Italienische Madrigale op. 1: Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert detailliert Heinrich Schütz' Italienische Madrigale op. 1, insbesondere das 18. Madrigal "Giunto è pur, Lidia". Die Analyse betrachtet das Werk im Kontext des italienischen Madrigal-Genres und der venezianischen Schule, unter Berücksichtigung der musikalischen und textlichen Aspekte.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die folgenden Themen: Schütz' Italienreise und Ausbildung bei Giovanni Gabrieli; das italienische Madrigal: stilistische Merkmale und Entwicklung; formale und musikalische Analyse des 18. Madrigals; Beziehung zwischen Text und Musik; die Bedeutung von Schütz' Madrigalen für die Entwicklung der deutschen Musik; der geschichtliche Kontext der Entstehung von Schütz' Italienischen Madrigalen; die Einflüsse Giovanni Gabrielis; die Prinzipien der Wortausdeutung und der räumlichen Darstellung in der Musik; der Übergang von der "prima pratica" zur "seconda pratica" und die damit verbundenen stilistischen Veränderungen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: 1. Der Werkzyklus und seine Position im Genre »Madrigal« (inkl. 1.1 Gegenstand und geschichtlicher Rahmen und 1.2 Das italienische »Madrigal«, wesentliche Aspekte); 2. Das 18. Madrigal »Giunto è pur Lidia« (inkl. Textanalyse, äußere Form, Binnenstrukturen und musikalische Rede mit detaillierter Analyse der sechs Soggetti); 3. Conclusio; 4. Anhang (inkl. Die sechs Soggetti des 18. Madrigals und Die kommentierte Partitur des 18. Madrigals).
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Zielsetzung ist eine detaillierte Analyse des 18. Madrigals "Giunto è pur, Lidia" im Kontext des italienischen Madrigal-Genres und der venezianischen Schule. Es soll die Beziehung zwischen Text und Musik untersucht und die Bedeutung der Madrigale für die Entwicklung der deutschen Musik aufgezeigt werden.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Heinrich Schütz, Italienische Madrigale, op. 1, Giovanni Gabrieli, Venezianische Schule, Madrigal, Polyphonie, Textvertonung, Wortausdeutung, prima pratica, seconda pratica, Stilwandel, deutsche Musikgeschichte.
Welche Aspekte des 18. Madrigals werden im Detail analysiert?
Das 18. Madrigal wird hinsichtlich seiner Textanalyse, äußeren Form und Binnenstrukturen (inkl. detaillierter Analyse der sechs Soggetti) untersucht. Die musikalische Rede und die Beziehung zwischen Text und Musik stehen dabei im Mittelpunkt.
Wie wird der historische Kontext der Madrigale dargestellt?
Der historische Kontext umfasst die Entstehung des Madrigalzyklus während Schütz' Venedigaufenthalt (1609-1613), die Widmung an den Markgrafen Moritz von Hessen, die Einflüsse Giovanni Gabrielis und die Bedeutung der Madrigale für die internationale Anerkennung deutscher Musik. Weiterhin wird die Entwicklung des italienischen Madrigals vom 14. bis zum 16. Jahrhundert, inklusive der verschiedenen Stilepochen (Florentiner Madrigal, Venezianische Schule) beleuchtet.
Welche Rolle spielt Giovanni Gabrieli in dieser Arbeit?
Giovanni Gabrieli wird als wichtiger Einfluss auf Schütz' Kompositionsweise dargestellt. Seine Prinzipien der Wortausdeutung und der räumlichen Darstellung in der Musik werden im Kontext der Analyse von Schütz' Madrigalen diskutiert.
- Arbeit zitieren
- Dipl. Ing. Karl Bellenberg (Autor:in), 2012, Heinrich Schütz: Italienische Madrigale op. 1, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/270347