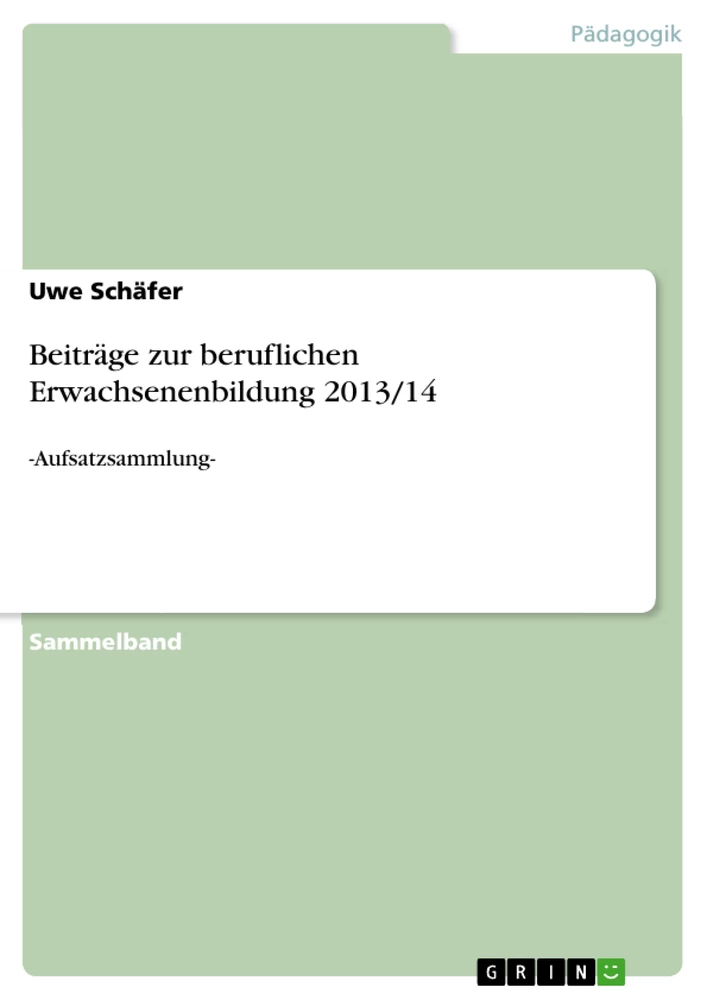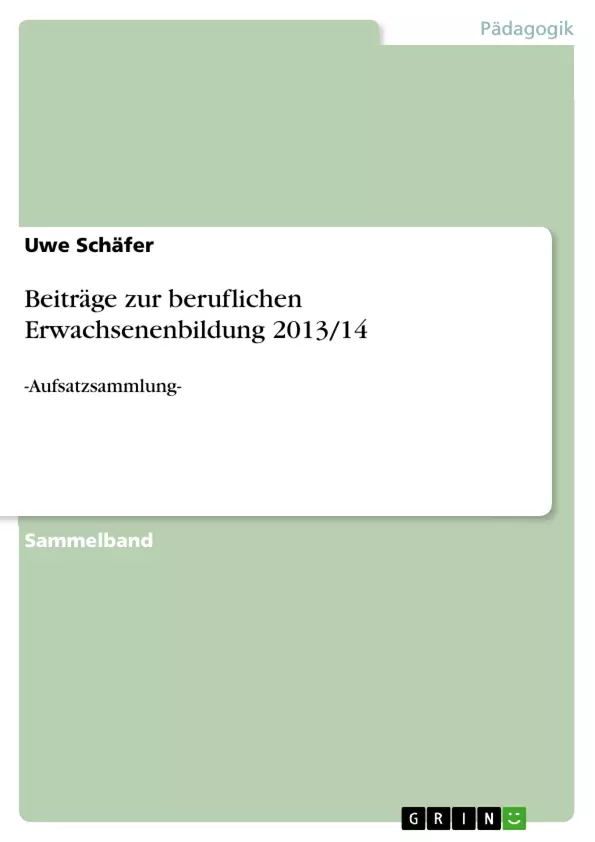Teil A: Die Studie wurde im Rahmen des Dissertationsstudiums der Wirtschaftspädagogik an der Johannes Kepler Universität, Linz im Wintersemester 2012/13 im Fach „quantitative Forschungsmethoden“ bearbeitet. Untersuchungsgegenstand waren Teilnehmer in Kursen zur Aktivierung und Orientierung im Rahmen arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen bei einem Bildungsinstitut in Wien. Sie untersucht den Zusammenhang zwischen einer belegten und von den Teilnehmern selbst gewählten Kursdauer und einer abschließend geäußerten Teilnehmerzufriedenheit. Es wird hinterfragt, ob ein Zusammenhang zwischen diesen Variablen besteht. Zur Anwendung kommen eine einfaktorielle Varianzanalyse (ANOVA) und entsprechende Hypothesentests. Die Daten wurden mittels des Statistikprogramms PSPP ausgewertet.
Teil B: Diese Arbeit wurde im Rahmen der Zertifizierung zum Fachtrainer nach ISO 17024 erstellt. Sie beschreibt in einem ersten Teil die makrodidaktische Planung der beschriebenen Fachkurse. In einem zweiten Teil wird die Planung und Umsetzung einer Trainingssequenz beschrieben.
Teil C: Das Essay beschreibt die kritische Auseinandersetzung mit einem Fachartikel sowohl bezüglich einer Genderperspektive als auch bezüglich den Zusammenhängen mit einer im Rahmen des didaktischen Handelns anzustrebenden erwachsenenbildnerischen Professionalität. Der diskutierte Artikel „Gender und Diversity gerechte Didaktik: ein intersektionaler Ansatz“ von G. Perko und C. Czollek erschienen 2008 im „Magazin erwachsenenbildung.at.“
Teil D: Diese wissenschaftliche Hausarbeit wurde im Wintersemester 2013/14 im Rahmen des Doktoratsstudiums der Wirtschaftspädagogik an der JKU Linz im Zusatzfach „Ausgewählte Aspekte der betrieblichen Bildung, Berufspädagogik u. Erwachsenenbildung“ zur Bewertung vorgelegt. Die Vorlesung beschäftigte sich zum einen mit der Fragestellung einer prinzipiellen Prüfbarkeit und Zertifizierbarkeit individueller (beruflicher) Kompetenzen. Zum anderen wurden Beratungsansätze im Rahmen der Erwachsenenbildungsberatung diskutiert und erläutert. Die vorliegende Hausarbeit beschreibt und diskutiert kritisch den Personenzertifizierungsprozess nach ISO 17024 zum/zur FachtrainerIn.
INHALT
TABELLEN UND ABBILDUNGEN
ABKÜRZUNGEN
Teil A - Lässt die Dauer einer Qualifizierungsmaßnahme Rückschlüsse auf die zu erwartende
Teilnehmerzufriedenheit zu?
A.1. Einführung
A.1.1. Die Situation
A.1.1.1. Kurse zur beruflichen Qualifizierung - die Gruppe
der Geringqualifizierten
A.1.1.2. Das Trainingsprogramm New Skills
A.1.2. Der Forschungsansatz
A.1.2.1. Voraussetzungen des Lernens
A.1.2.2. Teilnehmerzufriedenheit – Maß für eine Entschulung?
A.1.2.3. Kursevaluierung und Teilnehmerzufriedenheit aus
quantitativer Perspektive
A.1.2.4. Hypothesen
A.2. Untersuchungsaufbau
A.2.1. Ziele der Untersuchung
A.2.2. Der Fragebogen
A.2.2.1. Art und Weise der Befragung
A.3. Statistische Auswertung 18
A.3.1. Durchschnittlichen TeilnehmerInnenzufriedenheit
A.3.1.1. Berechnung der durchschnittlichen Zufriedenheit
A.3.1.2. Vergleich der Mittelwerte
A.3.1.3. ANOVA unter PSPP – Betrachtung der
durchschnittlichen Zufriedenheit
A.3.2. Hypothesentest
A.3.2.1. Formulierung der Hypothesen
A.3.2.2. Normalverteilung
A.3.2.3. Überprüfung der Varianzhomogenität
A.3.2.3.1. Levene Test zur Varianzgleichheit
A.3.2.3.2. T-Test – Gleichheit der Mittelwerte
A.4. Schlussbetrachtungen
A.4.1. Zusammenfassung der Ergebnisse
A.4.2. Diskussion
Anhang zum Teil A
Fragebogen
Codebuch
KS-Test (Normalverteilung)
T-Test
Teil B - Planung und Umsetzung von Qualifizierungskursen zur Vorbereitung auf die Facharbeiterprüfung im anerkannten Ausbildungsberuf „Maschinen- und AnlagenführerIn
– Fachrichtung Metall- und Kunststofftechnik“
B.1. Einleitung
B.1.1. Die Situation
B.1.2. Das Berufsbild „Maschinen- und AnlagenführerIn
Fachrichtung Metall und Kunststofftechnik“
B.1.3. Anforderungen und Ausnahmen zur beruflichen
Nachqualifizierung zum/zur MAF unter Berücksichtigung der Umschulungsregelung
B.1.4. Koordination der Qualifizierungsmaßnahme sowie
die Abschlussprüfung im Berufsbild MAF
B.2. Teil 1: Makrodidaktische Planung von Kursen zur
Nachqualifizierung zum/zur MAF unter besonderer Berücksichtigung
der Prüfungsgegenstände in den Prüfungsfächern
Produktionstechnik und Produktionsplanung.
B.2.1. Definition eines zur Anwendung kommenden Curriculums
B.2.1.1. Ermittlung der Prüfungsinhalte
B.2.1.2. Ergänzung der Prüfungsinhalte und Entwicklung von
Lehr-/Lerninhalten
B.2.1.3. Definition zu vermittelnder Lehr-/Lerninhalte
Grobplanung und Übersicht geforderter Fachkompetenzen
B.2.2. Festlegung des zeitlichen Rahmens
B.2.3. Eckdaten zur weiteren Planung und der
didaktisch-methodischen Trainingsvorbereitung
B.2.4. Persönliches Vorgehen im Hinblick auf die mikrodidaktische
Umsetzung im Rahmen der Fachkurse
B.3. Teil 2: Mikrodidaktische Umsetzung – Trainingssequenz:
Vielfalt der Werkstoffe unter Anwendung spezieller
Moderationsformen (Memorytechnik)
B.3.1. Fachdidaktischer Hintergrund und Lernziele
B.3.2. Trainingssituation
B.3.3. Gestaltung und Ablauf der Trainingssequenz
B.3.3.1. Phase 1 - Einstieg und Definition
B.3.3.2. Phase 2 - Entwicklung der Baumstruktur
moderierter Prozess
B.3.3.3. Phase 3 – Die Memorytechnik als Kognitionshilfe
zur Lernerfolgskontrolle
Anhang zum Teil B
Teil C - Textanalyse des Artikels: „Gender und Diversity
gerechte Didaktik: ein intersektionaler Ansatz“
C.1. Der Artikel
C.1.1. Thema des Textes
C.1.2. Die Autorinnen
C.1.3. Textaussagen und Argumentationslinien
C.1.3.1. Gesetzliche Richtlinien als Grundlage einer
gendergemäßen Didaktik
C.1.3.2. Erläuterungen zur Gleichheit und zur Gleichstellung
C.1.3.3. Der intersektionelle Ansatz
C.1.3.4. Handlungsempfehlungen und Checklisten
C.1.4. Zusammenfassung und Aussagen
C.2. Genderkompetenz als Merkmal erwachsenenbildnerischen
Handelns?
C.2.1. Was bedeutet Gender und Diversity gerechte Didaktik also?
C.2.2. Genderkompetenz auf Seiten
Erwachsenenbildungspersonals
C.2.2.1. Die Situation in Österreich tätiger Trainerinnen
und Trainer
C.3. Schlussbetrachtung
Teil D - Zertifizierung und Anerkennung von erworbenen Kompetenzen am Beispiel der Personenzertifizierung
zum/zur „FachtrainerIn“ nach ISO 17024
D.1. Einführung
D.1.1. Die Berufsrolle als soziales Phänomen
D.1.2. Berufsbezeichnung – wer definiert diese Bezeichnung?
D.2. Erwachsenenbildung als Beruf
D.2.1. Berufsbezeichnungen in der Erwachsenenbildung
D.2.2. Systeme zur beruflichen Aus- und Weiterbildung
D.2.3. Das Subsystem beruflicher Bildung im Rahmen
arbeitsmarktpolitische Maßnahmen in Österreich
D.3. Das Dilemma der Gleichwertigkeit und die Strategien
zur Anerkennung erwachsenenbildnerischer Kompetenzen
im Rahmen einer Kompetenzzertifizierung
D.3.1. Die Folgen dieser Definition
D.3.2. Die Personenzertifizierung nach ISO 17024
D.3.2.1. Der Zertifizierungsprozess
D.3.2.2. Zertifizierungsprozess zur/zum FachtrainerIn
D.3.2.3. Rezertifizierung
D.4. Zusammenfassung und kritische Reflexion
QUELLEN UND LITERATUR
TABELLEN UND ABBILDUNGEN
Tab. 1 – Skalenniveaus und Abhängigkeiten
Tab. 2 – Weitere Informationen zur Erhebung
Tab. 3 – Durchschnittliche Zufriedenheit aller TeilnehmerInnen
Tab. 4 – Vergleich der Mittelwerte
Tab. 5 – Levene Statistik und Signifikanzvergleich zwischen
den Gruppen
Tab. 6 – Fragebogen
Tab. 7 – Codebuch
Tab. 8 – Normalverteilung
Tab. 9 – T-Test
Tab. 10 – Kompetenzen im Bereich Produktionstechnik
Tab. 11 – Kompetenzen im Bereich Produktionsplanung
Tab. 12 – Voraussetzungen, Bedingungen
Teilnehmerstruktur der Fachkurse
Abb. 1 – Vielfalt der Werkstoffe
Abb. 2 – Vielfalt der Werkstoffe – Prüfungsfrage
Abb. 3 – Moderierter Prozess – Entwicklung der Baumstruktur
auf der Pinnwand
Abb. 4 – Prüfungskoffer mit verschiedenen Werkstoffen
Werkzeugen
Abb. 5 – Memorytechnik
Tab. 13 – Planungs- und Ablaufstruktur
Abb. 6 – Ablauf des Zertifizierungsverfahrens nach
ISO 17024 (Systemcert 2012)
ABKÜRZUNGEN
illustration not visible in this excerpt
A. Lässt die Dauer einer Qualifizierungsmaßnahme Rückschlüsse auf die zu erwartende Teilnehmerzufriedenheit zu?
Die vorliegende Studie wurde im Rahmen des Dissertationsstudiums der Wirtschaftspädagogik an der Johannes Kepler Universität, Linz im Wintersemester 2012/13 im Fach „quantitative Forschungsmethoden“ bearbeitet. Untersuchungsgegenstand waren Teilnehmer in Kursen zur Aktivierung und Orientierung im Rahmen arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen bei einem Bildungsinstitut in Wien. Sie untersucht den Zusammenhang zwischen einer belegten und von den Teilnehmern selbst gewählten Kursdauer und einer abschließend geäußerten Teilnehmerzufriedenheit. Es wird hinterfragt, ob ein Zusammenhang zwischen diesen Variablen besteht. Zur Anwendung kommen eine einfaktorielle Varianzanalyse (ANOVA) und entsprechende Hypothesentests. Die Daten wurden mittels des Statistikprogramms PSPP ausgewertet.
(Beurteilung der Arbeit – Note: 2,0 – Gesamtnote im Fach: 3,0)
A.1. Einführung
A.1.1. Die Situation
A.1.1.1. Kurse zur beruflichen Qualifizierung - die Gruppe der Geringqualifizierten
In der beruflichen Erwachsenenbildung kommt Weiterbildungskursen, welche die Qualifizierung von arbeitsuchenden Menschen zum Inhalt haben, eine stetig wachsende Bedeutung zu. Dies gilt insbesondere dann, wenn arbeitsuchende Personen einer der folgenden Zielgruppen zuzuordnen sind:
- An- und Ungelernte (geringqualifizierte) Arbeitsuchende
- Personen mit Migrationshintergrund
- ältere Arbeitnehmerinnen bzw. Arbeitnehmer
Quantitative Studien scheinen zu belegen, dass insbesondere Personen der sogenannten bildungsfernen Milieus besonders schwer wieder in Beschäftigung zu bringen, und deshalb besonders stark von Langzeitarbeitslosigkeit bedroht sind (vgl. Mosberger et al. 2008, S. 5). Eine Strategie zur Lösung des Problems scheint in modernen Bildungs- und Sozialsystemen die berufliche Nachqualifizierung dieser Personengruppe darzustellen. Dies gilt insbesondere dann, wenn sich diese Personen bereits in der Arbeitslosigkeit befinden. Sowohl in Deutschland als auch in Österreich werden seitens staatlicher Stellen (Arbeitsamt, Jobcenter bzw. AMS) Versuche unternommen, die Chancen arbeitsuchender Personen auf dem Arbeitsmarkt durch Maßnahmen zur Aktivierung, Orientierung und Qualifizierung zu erhöhen. Strittig scheint hierbei der zu erwartende Erfolg dieser Maßnahmen zu sein, begeben sich die betreffenden Personen durch die Belegung der Kurse sowie eine zuvor erfolgte Beratung durch das AMS doch oft in einen gefühlten Zwangskontext, aufgrund dessen der eigentliche Sinn und Zweck einer Qualifizierungsmaßnahme so wie der zu erwartende Erfolg zumindest kritisch zu hinterfragen ist (vgl. Kähler 2005, S. 123).
Am BPI der ÖJAB wird seit Anfang 2012 die Kursreihe New Skills – Maschinen, Kfz, Metall im Auftrag des AMS Wien durchgeführt (vgl. AMS 2012).
A.1.1.2. Das Trainingsprogramm New Skills
Im Rahmen des Qualifizierungsprogramms New Skills sollen arbeitsuchende Personen neue Perspektiven auf dem Arbeitsmarkt eröffnet werden.
„Das Kursangebot New Skills richtet sich an arbeitsuchende Personen mit oder ohne Berufsausbildung – also auch an Anlern- und Hilfskräfte, welche bereits über Berufserfahrung innerhalb der/den Branchen Maschinen, Kfz, Metall verfügen. Die Personen müssen beim AMS für entsprechende Weiterbildungskurse vorgemerkt sein. Das Angebot richtet sich insbesondere an Personen, welche der Altersgruppe „45+“ zuzurechnen sind. […] Zur Durchführung der Kurse sind seitens des AMS zwei Kursvarianten vorgesehen. Im Rahmen der Variante Basic (5 Wochen Vollzeitkurs – 35 Unterrichtseinheiten pro Unterrichtswoche a 50 Minuten) sollen die innerhalb des Curriculums definierten Fachinhalte in ihren Grundzügen vermittelt werden. Des Weiteren sollen etwaige Vorkenntnisse der TN aufgefrischt, so wie Wissen-, Qualifikations-, und Kompetenzlücken […] geschlossen werden.
Die Kursvariante Intensiv (14 Wochen Vollzeitkurs – 35 Unterrichtseinheiten pro Unterrichtswoche a 50 Minuten) vertieft und ergänzt die fachlichen Inhalte. Sie beinhaltet darüber hinaus weitere Fachmodule (Wirtschaftskompetenz und Verbesserung betrieblicher Abläufe) sowie vertiefende praktische Projektarbeiten (Schäfer 2012, S. 2) “.
Die vorliegende Forschungsarbeit befasst sich mit der quantitativen Auswertung der TeilnehmerInnenzufriedenheit im Vergleich der Belegung der beiden Kursvarianten Basic und Intensiv.
Vor Beginn der Maßnahme entscheiden die teilnehmenden Personen im Rahmen eines Informationstages weitestgehend selbständig welche Kursvariante sie belegen möchten. Von bildungswissenschaftlichem Interesse scheint hierbei zu sein, woraus sich die individuellen Motive einer Entscheidung zu einer längeren bzw. kürzeren Kursdauer zusammensetzen. Die Unterrichtsräume sowie das TrainerInnenpersonal unterscheiden sich bei einem Vergleich der beiden Kurskonzepte nicht.
Lediglich die Kursdauer der Kursvarianten ist unterschiedlich. Die längere Kursvariante (intensiv) unterscheidet sich hinsichtlich der Unterrichtsinhalte der Veranstaltung B asic dadurch, dass die zu behandelnden Fachinhalte im Rahmen der Trainingsveranstaltungen vertieft, so wie durch einige zusätzliche Themen ergänzt werden.
A.1.2. Der Forschungsansatz
A.1.2.1. Voraussetzungen des Lernens
In der modernen Lehr- bzw. Lernforschung wird davon ausgegangen, dass kompetenzerweiternde Prozesse nicht von außen initiierbar sind, sondern dass das mutmaßlich lernende Individuum in Form eines didaktisch und methodisch zu gestaltenden Prozesses beim Kompetenzerwerb unterstützt, und das Lernen somit ermöglicht werden kann (vgl. Arnold 2010a, S. 79-80).
Die Basis einer erfolgreichen Weiterbildung stellt deshalb grundsätzlich die Lernerin bzw. der Lerner selbst dar. Ihre bzw. seine Motive, Grundeinstellungen, Reflexionsfähigkeiten und vorhandenen Grundkompetenzen sind demnach maßgeblich für den Bildungserfolg verantwortlich. Gelingt es der Trainerin/ dem Trainer nicht, im Verlauf des didaktischen Prozesses genau diese Selbstreflexionsfähigkeit auf Seiten der teilnehmenden Personen zu fördern bzw. zu entwickeln, wird eine Plausibilität zum Kompetenzerwerb schwer zu beobachten sein. Die Rolle des Weiterbildungspersonals wandelt sich deshalb mehr und mehr von der Rolle der Dozentin/Lehrerin bzw. des Dozenten/Lehrers zur Rolle der Lernbegleitung und zur Rolle der Trainerin bzw. des Trainers.
In Zusammenhang mit einem Individualisierungsansatz der Bildung scheint es somit maßgeblich zu sein, welch individuellen Voraussetzungen seitens der Teilnehmerinnen/ der Teilnehmer bereits vor Beginn des jeweiligen Kurses zu beobachten sind (vgl. Egloff 2010, S. 147-148). Ein Maß in vorliegendem Fall könnte die Entscheidung auf Seiten der teilnehmenden Personen für oder gegen eine längere bzw. kürzere Kursdauer sein.
A.1.2.2. Teilnehmerzufriedenheit – Maß für eine Entschulung?
Innerhalb der Personengruppe geringqualifizierter Personen ist zunächst anzunehmen, dass Weiterbildungsangebote, wenn nicht gleich prinzipiell abgelehnt, so doch zumindest kritisch betrachtet werden. Schlechte Schulerfahrungen, sowie schlechte Erfahrungen innerhalb klassischer verschulter Systeme, können für diese kritische Haltung maßgebliche Faktoren sein. Schlechte Schulerfahrungen sind bei beschriebenem Personenkreis durchaus ein zu beobachtendes Phänomen (vgl. Schäfer 2012, S. 27). Des Weiteren findet innerhalb andragogischer Thesen auch eine radikale Teilnehmerorientierung ihren Platz, die einer verschulten Weiterqualifizierung eine prinzipielle Absage erteilt und somit das Lernen und die Weiterbildung stets ausschließlich innerhalb eines individuellen Lebensweltbezuges statt zu finden hat (vgl. Arnold 2003, S. 41).
Innerhalb einer quantitativen Betrachtung könnte m.E. eine Zufriedenheitsmessung auf Seiten der teilnehmenden Person diesbezüglich entscheidende Auskünfte geben. Es stellt sich u.a. die Frage, in wie weit die vermeintlich weiter zu qualifizierenden Personen sich nach Abschluss einer Bildungsmaßnahme in ihrer bereits vor Veranstaltungsbeginn festgesetzten negativ kritischen Meinung gegenüber der Maßnahme bestätigt fühlen. Bei einer entsprechenden Hypothesenkonstruktion wird also im Folgenden davon ausgegangen, dass besonders schulresistente Personen sich eher für eine kürzere Kursdauer entscheiden, da diese in ihren Augen ein kleineres Übel darzustellen scheint.
A.1.2.3. Kursevaluierung und Teilnehmerzufriedenheit aus quantitativer Perspektive
Es ist mittlerweile Standard, dass Weiterbildungskurse nach deren Abschluss mittels eines Fragebogens (u.a. zur Teilnehmerzufriedenheit) ausgewertet werden. Diese Feedbackbögen finden starke Anwendung in Bezug auf eine Kursevaluierung. In wie weit eine wissenschaftliche Auswertung der Bögen nach quantitativen Regeln stattfindet, bleibt jedoch meist in Verborgenen.
Insbesondere im Hinblick auf anzuwendende Qualitätsmanagementsysteme innerhalb des Weitebildungssegments wird seitens entsprechender Richtlinien oft eine derartige TeilnehmerInnenbefragung gefordert. Die TeilnehmerInnenbefragung (auch im Hinblick auf eine subjektiv empfundene Zufriedenheit) ist aus meiner Erfahrung das am häufigsten gewählte Hilfsmittel zur Erfassung relevanter Daten.
A.1.2.4. Hypothesen
Im vorliegenden Fall sollen also Rückschlüsse gezogen werden, in wie weit im Rahmen einer zu messenden TeilnehmerInnenzufriedenheit (nach Abschluss des Kurses) Zusammenhänge mit der belegten Kursdauer (die belegte Kursvariante) zu beobachten sind. Es soll also die Annahme getroffen werden, dass teilnehmende Personen des längeren Kursen (Variante Intensiv) grundsätzlich gegenüber einer längeren Weiterbildungsphase aufgeschlossener sind, und sie sich somit nach Abschluss eher zufrieden erklären. Die Teilnehmer der Variante Basic hingegen neigen eher dazu sich in ihren Urteilen bestätigt zu fühlen. Sie erklären sich mit dem Kursverlauf also eher unzufrieden
Formulierung der Nullhypothese:
Die Teilnehmerzufriedenheit nach Kursabschluss bei teilnehmenden Personen der „Kursvariante intensiv“ ist höher als bei TeilnehmerInnen der „Basic-Variante“.
Demgegenüber lässt sich bei einer Nichtbestätigung folgende Alternativhypothese formulieren:
Formulierung der Alternativhypothese:
Es lässt sich kein signifikanter Unterschied bezüglich der TeilnehmerInnenzufriedenheit im Vergleich der beiden Personenkreise „TeilnehmerInnen Intensiv“ und „TeilnehmerInnen Basic“ feststellen.
A.2. Untersuchungsaufbau
A.2.1. Ziele der Untersuchung
Die zu erwartenden Untersuchungsergebnisse dienen einem praktischen Zweck. Sie sollen dem Bildungsträger neben den bereits zur Anwendung kommenden Evaluierungswerkzeugen helfen, den bildungswissenschaftlichen Blick auf die von ihm angebotene Maßnahme zu schärfen, und somit auch die Qualität der Trainingsergebnisse im Sinne einer Teilnehmerorientierung und somit einer kontinuierlichen Verbesserung weiter zu entwickeln. Es ist geplant die Ergebnisse innerhalb einer Präsentationsveranstaltung der Leitung und den mitarbeitenden Personen des Instituts zur Verfügung zu stellen. Des Weiteren können die Untersuchungsergebnisse auch dem Auftraggeber (AMS Wien) entsprechend zur Verfügung gestellt werden. Dies ist durchaus im Sinne einer weiteren Planung, ist der Bildungsträger doch verpflichtet Bildungsveranstaltungen und deren Ergebnisse ständig zu evaluieren und ggf. Maßnahmen zu deren Verbesserung einzuleiten und umzusetzen.
A.2.2. Der Fragebogen
Um für die Studie entsprechend Daten zu generieren, wird der Fragebogen des AMS so wie die darin fixierte Skalierung verwendet (vgl. Anhang). Dies geschieht einerseits um die Teilnehmer nicht mit einem zusätzlich entwickelten Frageschema zu belasten, und andererseits etwaige unterschiedliche Ergebnisse (verschiedene Teilnehmeraussagen zu verschiedenen Zeitpunkten) und somit Störeinflüsse zu verhindern. Des Weiteren können mit der Standardisierung der Fragen ähnliche Untersuchungen und Auswertungen zu einem späteren Zeitpunkt wiederholt, sowie Daten ggf. rückwirkend ausgewertet werden. Für die Auswertung der vorliegenden Arbeit werden ausschließlich die innerhalb des Fragebogens fixierten Aussagen bezüglich der TeilnehmerInnenzufriedenheit ausgewertet. Diese Zufriedenheitsfragen stellen zwar den Hauptteil des Fragebogens dar – der Originalfragebogen des AMS wird jedoch noch durch weitere Befragungsschwerpunkte ergänzt.
Diese weiteren Fragestellungen bleiben aber im weiteren Untersuchungsverlauf außer Acht. Tab. 1 beschreibt das Verhältnis und die Struktur der ermittelten Daten (vgl. auch Anhang – Codebuch und Fragebogen).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
(Tab. 1 – Skalenniveaus und Abhängigkeiten)
A.2.2.1. Art und Weise der Befragung
Üblicherweise (so auch hier bei Abschluss der 4 Kurse des beschriebenen Befragungssamples) findet eine Befragung an einem der letzten beiden Kurstage statt. Hierbei geben die TeilnehmerInnen ihr Rating direkt über einen Befragungsdialog am PC auf den Internetseiten des AMS ab. Bei vorliegender Stichprobe wurden die TeilnehmerInnen gebeten vor der Onlineeingabe ihre Ergebnisse auf einem Fragebogenausdruck zu vermerken (schriftlich). Die Ergebnisse wurden dann durch die TeilnehmerInnen in die Onlinebefragung übernommen, und die ausgefüllten Fragebögen zur Auswertung eingesammelt. Die jeweiligen Ergebnisse zur Zufriedenheit wurden anschließend nochmals zur statistischen Auswertung in das Statistikprogramm PSPP übernommen, und die Fragebögen (die schriftliche Form) anschließend vernichtet. Zuvor erfolgte nochmals eine Überprüfung der Richtigkeit der Datenübernahme durch eine unabhängige Person.
Weitere Informationen zur Erhebung:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
(Tab. 2 – Weitere Informationen zur Erhebung)
A.3. Statistische Auswertung
In vorliegendem Fall wird zunächst mit Hilfe der einfaktoriellen Varianzanalyse (einfaktorielle ANOVA) der etwaige Zusammenhang eines Mittels PSPP pro Datensatz berechneten durchschnittlichen Zufriedenheitswerts mit der Gruppenbelegung überprüft. Es wird ermittelt, ob sich signifikante Unterschiede bezüglich den Aussagen zur TeilnehmerInnenzufriedenheit im Vergleich der beiden Gruppen Basic- bzw. Intensivkursteilnehmerinnen feststellen lassen.
A.3.1. Durchschnittliche TeilnehmerInnenzufriedenheit
A.3.1.1. Berechnung der durchschnittlichen Zufriedenheit
Aus den Befragungswerten wurde zunächst zu jedem Datensatz eine Allgemeinaussage (durchschnittlicher Zufriedenheitswert) als arithmetischer Mittelwert der jeweiligen Zufriedenheitswerte ermittelt.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
(Tab. 3 – Durchschnittliche Zufriedenheit aller TeilnehmerInnen)
A.3.1.2. Vergleich der Mittelwerte
Die zu erwartenden Ergebnisse aller statistischen Ergebnisse wurden nach den beiden Fällen (unabhängigen Variablen) TeilnehmerIn Intensiv (2) bzw. TeilnehmerIn Basic (1) auf der PSPP Ausgabenseite als getrennt auszugebend eingestellt.
Ein Vergleich der Mittelwerte ergibt zunächst einen niedrigeren (also besseren) durchschnittlichen Zufriedenheitswert (als Mittelwert aller Zufriedenheitswerte) auf Seiten der KursteilnehmerInnen Intensiv.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
(Tab. 4 – Vergleich der Mittelwerte)
A.3.1.3. ANOVA unter PSPP – Betrachtung der durchschnittlichen Zufriedenheit
Es wird nun unter PSPP das Signifikanzniveau mit Hilfe einer einfaktoriellen Varianzanalyse ermittelt. Desweiteren wird mit Hilfe des Levene-Tests die Homogenität der Varianzen festgestellt.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
(Tab. 5 – Levene Statistik und Signifikanzvergleich zwischen den Gruppen)
Da der Signifikanzwert > 0,05 ist, kann in dieser Betrachtung nicht von einem signifikanten Unterschied zwischen den beiden Gruppen ausgegangen werden. Der durchschnittliche Zufriedenheitswert lässt also keine Gültigkeit der Nullhypothese zu – somit gilt an dieser Stelle die Alternativhypothese:
Es lässt sich kein signifikanter Unterschied bezüglich der durchschnittlichen TeilnehmerInnenzufriedenheit im Vergleich der beiden Personenkreise „TeilnehmerInnen Intensiv“ und „TeilnehmerInnen“ Basic feststellen.
A.3.2. Hypothesentest
Im Folgenden sollen die einzelnen Zufriedenheitswerte mit Hilfe von Hypothesentests auf signifikante Unterschiede im Vergleich der beiden TeilnehmerInnengruppen überprüft werden. Hierbei werden Verfahren zur Überprüfung von unabhängigen Unterschiedshypothesen angewendet. Eine Intervallskalierung liegt vor. Es gilt die Überprüfung der Normalverteilung (KS-Test), und die Überprüfung der Varianzhomogenität (T-Test) vorzunehmen.
A.3.2.1. Formulierung der Hypothesen
Im Vergleich zum bereits geschilderten Vorgehen während der Varianzanalyse (vgl. Kapitel A.3.1.3.) müssen im Folgenden die beiden gegensätzlichen Hypothesen negiert werden. Der folgende Hypothesentest überprüft
H0´:
Es lässt sich kein signifikanter Unterschied bezüglich der TeilnehmerInnenzufriedenheit im Vergleich der beiden Personenkreise „TeilnehmerInnen Intensiv“ und „TeilnehmerInnen“ Basic feststellen
H1´:
Die TeilnehmerInnenzufriedenheit nach Kursabschluss bei teilnehmenden Personen der „Kursvariante intensiv“ unterscheidet sich von der TeilnehmerInnenzufriedenheit bei TeilnehmerInnen der „Basic-Variante“.
A.3.2.2. Normalverteilung
Der KS-Test weist bei folgenden Zufriedenheitswerten eine Normalverteilungs- wahrscheinlichkeit von >5% auf (Asypt. Signifikanzwert > 0,05):
Zufriedenheit mit:
- dem Umfang des Lehrstoffes
- den Übungsmöglichkeiten während des Unterrichts sowie der:
- Durchschnittszufriedenheit
Diese Aussagen werden im Folgenden weitere Tests unterzogen. Alle übrigen ermittelten Daten besitzen keine ausreichende Normalverteilung (vgl. Anhang).
A.3.2.3. Überprüfung der Varianzhomogenität
Die 3 verbleibenden Messwerte (Variablen) werden nun mit Hilfe des T-Tests für unabhängige Stichproben auf ihre Varianzhomogenität überprüft.
A.3.2.3.1. Levene Test zur Varianzgleichheit
Signifikanzwerte:
Unterrichtstempo [Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten] 0,23 ist >0,1
Übungsmöglichkeiten [Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten] 0,45 ist >0,1
Durchschnittszufriedenheit [Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten] 0,95 ist >0,1
Hiermit ist zunächst die Voraussetzung gleicher Varianzen erfüllt (vergleiche Anhang).
A.3.2.3.2. T-Test – Gleichheit der Mittelwerte
Robustheit (Bedingung): nmax/nmin
Hier: 20/19=1,05 [Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten] robust
Signifikanzwerte (2-seitig):
Unterrichtstempo [Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten] 0,17 ist >0,05 [Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten] t(37)=1,41; p= .17 [Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten] Es gilt
Übungsmöglichkeiten [Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten] 0,05 ist = 0,05 [Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten] t(37)=2,02; p= .05 [Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten] Es gilt
Durchschnittszufriedenheit [Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten] 0,31 ist >0,05 [Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten] t(37)=1,02; p= .31 [Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten] Es gilt
(vergleiche Anhang).
Hiermit wird die H1´ Hypothese in Fällen bezüglich der TeilnehmerInnenzufriedenheit „Unterrichtstempo“ und „Durchschnittszufriedenheit“ verworfen.
Dies bedeutet, einzig und allein bezüglich der angebotenen Übungsmöglichkeiten lässt sich ein Unterschied der beiden Teilnehmergruppen feststellen (grenzwertig, da der Signifikanzwert genau 0,05 beträgt). Die TeilnehmInnenzufriedenheit liegt hier bei der Gruppe Intensiv signifikant höher als bei der Gruppe Basic (gemessen an den errechneten Mittelwerten) .
A.4. Schlussbetrachtungen
A.4.1. Zusammenfassung der Ergebnisse
- Die einfaktorielle Varianzanalyse liefert keine signifikanten Unterschiede bezüglich einer generell unterschiedlichen durchschnittlichen TeilnehmerInnenzufriedenheit im Vergleich der beiden Personengruppen
- Im Rahmen weiterer Hypothesentests wird dieses Ergebnis bestätigt
- Der einzige Messwert, in welchem ein signifikanter Unterschied zu erkennen ist (im Vergleich der beiden Personengruppen), bezieht sich auf die Zufriedenheit bezüglich der angebotenen Übungsmöglichkeiten
These:
Die teilnehmenden Personen an Intensivkursen sind generell zufriedener mit dem Angebot an Übungsmöglichkeiten (im Rahmen der Kurse).
A.4.2. Diskussion
Es kann nun davon ausgegangen werden, dass die durchgeführte Befragung und die anschließende Auswertung keine hinreichende Signifikanz des Zusammenhangs der TeilnehmerInnenzufriedenheit mit der persönlichen und individuellen Entscheidung der teilnehmenden Personen für oder gegen eine längere bzw. kürzere Kursdauer zulässt. Dies gilt insbesondere mit dem Zusammenhang bezüglich einer in Kapitel 1.2.2. beschriebenen Entschulungstheorie. Insbesondere bleibt auch zu hinterfragen, ob die gewählte Größe des Stichprobensamples für diesbezügliche Betrachtungen ausreichend ist. Im Jahr 2012 wurden am BPI 15 Kurse (beider Kursvarianten) durchgeführt. Bei einer maximalen TeilnehmerInnenzahl von 15 Personen beträgt die Personenanzahl insgesamt 225 TeilnehmerInnen pro Kalenderjahr. Im Jahr 2013 wird dasselbe Personenkontingent erwartet. 2014 wird das Programm auslaufen.
Das Befragungssample (geht man von einer TeilnehmerInnenanzahl von ca. 500 Personen in 2 Jahren aus) beträgt 39/500 – das entspricht einer Befragungstiefe von lediglich 7,8%. In Betracht zu einer anzustrebenden Validität wissenschaftlicher Aussagen ist dieser Querschnitt also als gering zu betrachten, ließe sich durch eine stetige Auswertung der Fragebögen (bezüglich der beschriebenen Fragestellung) doch eine Befragungstiefe von annähernd 100% erreichen (Längsschnitt – über die Dauer von 2 Jahren). Für die in Kapitel 1.2. geschilderten Fragestellungen ist ebenfalls kritisch zu hinterfragen, in wie weit quantitativ empirische Ansätze als einzige Forschungsmethoden sinnvoll sind, oder ob diese (zumindest unterstützend) durch qualitative und theoretische Ansätze ergänzt werden müssen.
Im Hinblick auf eine Kursevaluierung ist prinzipiell zu hinterfragen, in wie weit die TeilnehmerInnenzufriedenheit überhaupt in den Fokus von Kursevaluation zu stellen ist, betrachtet Sie doch nur einen Teil der relevanten Fragestellungen, denn:
„Zufriedenheitserfolg tritt beim Teilnehmer ein, nicht jedoch Lernerfolg,
Transfererfolg und Erfolg für die Organisation. Damit wird verdeutlicht, dass der
Zufriedenheitserfolg losgelöst von den übrigen Erfolgsgrößen vorliegen kann.
Sein Vorhandensein ist somit keine zwingende Voraussetzung für das
Wirksamwerden der übrigen Erfolgsgrößen (Hoss 2010, S. 35).“
Die Fragestellungen des Lern- und des (zu erwartenden) Transfererfolgs, so wie die Auswirkungen des Kurses und der Kursinhalte auf die zukünftig am Arbeitsplatz handelnde Person, bleiben also bei reinen TeilnehmerInnenzufriedenheits- betrachtungen gänzlich unbeantwortet. Allerdings bleiben unabhängigen Bildungsträgern kaum wesentliche (quantitative) Werkzeuge um diese weiteren Fragestellungen (bezüglich Lern- und Transfererfolg) in den Mittelpunkt von Evaluierungsbemühungen zu stellen.
Bezüglich der im Lauf dieser Auswertungen ermittelten Ergebnisse betreffs der Zufriedenheit mit den Übungsmöglichkeiten lässt sich aber m.E. eine sehr pragmatische Erklärung heranziehen. Die signifikanten Unterschiede könnten sich einzig und allein daraus begründen, dass bei einer längeren Kursdauer auch mehr Übungen stattfinden (können), und diese auch von TeilnehmerInnenseite bewusster wahrgenommen werden.
Anhang zum Teil A
Fragebogen
Wie zufrieden waren Sie…. (1=sehr zufrieden 6=überhaupt nicht zufrieden)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
(Tab. 6 – Fragebogen)
Codebuch
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
(Tab. 7 – Codebuch)
KS-Test (Normalverteilung)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
(Tab. 8 – Normalverteilung)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
(Tab. 9 – T-Test)
B. Planung und Umsetzung von Qualifizierungskursen zur Vorbereitung auf die Facharbeiterprüfung im anerkannten Ausbildungsberuf „Maschinen- und AnlagenführerIn – Fachrichtung Metall- und Kunststofftechnik“
Die vorliegende Arbeit wurde im Rahmen der Zertifizierung zum Fachtrainer nach ISO 17024 erstellt. Sie beschreibt in einem ersten Teil die makrodidaktische Planung der beschriebenen Fachkurse. In einem zweiten Teil wird die Planung und Umsetzung einer Trainingssequenz beschrieben.
(Die Zertifizierung zum Fachtrainer wurde im Frühjahr 2013 erfolgreich durchgeführt)
B.1. Einleitung
B.1.1. Die Situation
In den letzten Jahren wurde seitens der Politik immer mehr die Notwendigkeit erkannt, Personen, welche über keinen ordentlichen Berufsabschluss verfügen diese berufliche Nachqualifizierung in verstärktem Maß zu ermöglichen. Diese Wende ist umso bemerkenswerter, wenn man berücksichtigt, dass die Möglichkeit einen entsprechenden Abschluss zu erlangen für beschriebenen Personenkreis im beruflichen Bildungssystem der BR Deutschland nicht vorgesehen war/ist. Nur in Ausnahmefällen werden Personen (unter Berücksichtigung entsprechender Bedingungen) als Externe seitens der prüfenden zuständigen Stelle (im vorliegenden Fall der IHK) zur Facharbeiterprüfung zugelassen(vgl. Agentur für Arbeit 2012b).
Um dem beschriebenen Personenkreis eine berufliche Nachqualifizierung in verstärktem Ausmaß zu ermöglichen war es seitens der Politik zunächst notwendig entsprechende Fördergelder für Qualifizierungsprogramme zur Verfügung zu stellen. Im Jahr 2006 wurde dies u.a. durch das WeGebAU Programm ermöglicht. Das Programm sieht vor, dass an- und ungelernte Arbeitnehmer innerhalb bestehender Beschäftigungsverhältnisse die Möglichkeit erhalten durch eine entsprechende Weiterqualifizierung an einer Facharbeiterprüfung teilzunehmen (vgl. Agentur für Arbeit, 2012a).
WeGebAU sieht des Weiteren vor, dass die Qualifizierung innerhalb des Berufsfeldes bzw. des Aufgabenbereichs stattzufinden hat, in dem die angestellte und sich weiterbildende Person ohnehin bereits beschäftigt ist, und deshalb davon auszugehen ist, dass eine entsprechende Berufspraxis (in der Regel als an- bzw. ungelernte Hilfskraft) seitens der Teilnehmerinnen und Teilnehmer vorgewiesen werden kann.
Unter diesen Umständen (Nachweis entsprechender Berufspraxis und das Vorhandensein eines Praxisbetriebs zur Abnahme der praktischen Facharbeiterprüfung) steht einer Anmeldung der KursteilnehmerInnen bei der IHK zur Abschlussprüfung nichts im Wege – Rechtsgrundlage hierbei sind die in den meisten Ausbildungsverordnungen verankerten Richtlinien zur beruflichen Umschulung, sowie der §45, Abs.2, Satz 3 des Berufsbildungsgesetzes der BR Deutschland (vgl. BBIG 2005, S.16).
B.1.2. Das Berufsbild „Maschinen- und AnlagenführerIn – Fachrichtung Metall und Kunststofftechnik“
Der/die „Maschinen- und AnlagenführerIn“ ist ein ordentlicher Ausbildungsberuf gemäß §25 BBIG der BR Deutschland. Richtlinien zur Ausbildung sind in der entsprechenden Ausbildungsverordnung des Berufsbilds geregelt (vgl. Bundesministerium der Justiz 2004). Die Regelausbildungsdauer innerhalb des dualen Ausbildungssystems beträgt 2 Jahre.
Zuständige Stelle (zur Kontrolle der Ausbildungsaktivitäten sowie zur Koordination und Abnahme der Zwischen- und Abschlussprüfungen) sind die IHKs. Das duale Ausbildungssystem wird bei Regelausbildungen wie folgt sichtbar:
- Der/die Auszubildende erhält seitens eines Ausbildungsbetriebes eine fundierte praktische Ausbildung, welche in eine Vorbereitung auf die praktische Abschlussprüfung mündet
- Gleichzeitig erfolgt eine ergänzende (überwiegend durch theoretische Lehr-/Lerninhalte geprägte) Ausbildungsphase, welche in den Berufsschulen durchgeführt wird. Im Falle der MAF-Ausbildung werden BerufsschülerInnen in den 2 Ausbildungsjahren denjenigen Berufsschulklassen zugeteilt, welche durch die Teilnahme anderer Berufsbilder geprägt sind (z.B. Werkzeug- bzw. IndustriemechanikerInnen). Bei diesen Berufsbildern beträgt die Regelausbildungszeit (und somit die Berufsschuldauer) 3-4 Ausbildungsjahre. MAF Auszubildende sind also i.d.R. Mitläufer an den Berufsschulen
(vgl. Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg 2004)
Des Weiteren ist in der Ausbildungsverordnung u.a. folgendes geregelt:
- Die bzw. der Auszubildende hat (zur etwa der Hälfte der Ausbildungsdauer) an einer Zwischenprüfung teil zu nehmen
- Die bzw. der Auszubildende muss ein Berichtsheft (Ausbildungsnachweis) führen. Das Vorhandensein ist Bedingung zur Zulassung zur Abschlussprüfung (vgl. Bundesministerium der Justiz 2004, S.
Die bzw. der MAF ist ein vollwertiger Ausbildungsberuf. Nach Abschluss der Ausbildung berechtigt dieser sowohl zur Fortsetzung der Berufsausbildung im Rahmen eines Ausbildungsverhältnisses zu einem 3-4 jährigen (Regelausbildungszeit) verwandten Ausbildungsberuf (z.B. Industrie- bzw. WerkzeugmechanikerIn), als auch zum Besuch von Fachschulen (z.B. im Rahmen einer Meister- oder Technikerausbildung) nach entsprechend vorzuweisender Berufspraxis. Die zu vermittelnden Lehr-/Lerninhalte sind im Ausbildungsrahmenplan geregelt. Neben der Spezialisierung Metall- und Kunststofftechnik sind noch weitere Schwerpunktrichtungen definiert, die aber im Rahmen der vorliegenden Arbeit nicht relevant sind, und denen deshalb keine weitere Beachtung zukommt.
Im Rahmen der Ausbildungsverordnung wird aber nur das Eintreten eines normalen Ausbildungsverhältnisses geschildert. Diese Normalität geht davon aus, dass die bzw. der durchschnittliche Auszubildende:
- ca.15-17 Jahre alt
- somit Berufsschulpflicht besteht
- ein Ausbildungsbetrieb vorhanden
Im vorliegenden Fall (zur Nachqualifizierung bzw. Umschulung von Erwachsenen) ist dies jedoch nicht der Fall.
B.1.3. Anforderungen und Ausnahmen zur beruflichen Nachqualifizierung zum/zur MAF unter Berücksichtigung der Umschulungsregelung
Die Regelungen innerhalb des Ausbildungsrahmenplans werden im vorliegenden Fall dem entsprechenden Ausbildungspersonal – also den zum Einsatz kommenden Trainerinnen und Trainern, nur teilweise hilfreich sein. Lediglich zu den darin geschilderten Prüfungsmodalitäten und Prüfungsinhalten (zu Fragen der Abschlussprüfung) herrscht uneingeschränkte Vergleichbarkeit. Im vorliegenden Fall werden die PrüfungsteilnehmerInnen alle samt über die Umschulungsregelung zur Abschlussprüfung zugelassen. Dies ist dann der Fall, wenn eine entsprechende praktische Berufserfahrung seitens der Teilnehmerinnen und Teilnehmer vorgewiesen
werden kann (z.B. als Anlern- bzw. Hilfskraft im Rahmen einer Tätigkeit bei einem Unternehmen der produzierenden Industrie bzw. des Metall-, Kunststoff- oder Maschinenbaugewerbes). Nur in diesem Fall können auch entsprechende Förderungen (z.B. im Rahmen des WeGebAu-Projekts) in Anspruch genommen werden. Aus theoretischer Sicht könnte sich also jede Person, auf welche diese Bedingungen zutreffen, selbständig bei der zuständigen Stelle zur Abschlussprüfung (ohne entsprechende Bedingungen eines Ausbildungsverhältnisses) anmelden.
Da dies aber meist mit einem sehr hohen Bürokratieaufwand verbunden ist, wird diese Möglichkeit aus meiner Erfahrung selten bis gar nicht genutzt. Im Gegensatz zu einer regulären Berufsausbildung entfällt also:
- Die Teilnahme an einer Zwischenprüfung
- die Berufsschulpflicht
- das Führen und der Nachweis eines Berichtsheftes
Die Prüfungsteilnehmerin bzw. der Prüfungsteilnehmer muss bei der Anmeldung zur Prüfung folgende Rahmenbedingungen nachweisen:
- Entsprechende Berufserfahrung (innerhalb einer dem Berufsbild der/des MAFs verwandten Tätigkeitsbereichs – die Entscheidung hierrüber trifft die zuständige Stelle)
- das Vorhandensein eines (zugelassenen) Ausbildungs- oder Praktikumsbetriebs zur Abnahme bzw. zur Teilnahme an der fachpraktischen Prüfung
B.1.4. Koordination der Qualifizierungsmaßnahme sowie die Abschlussprüfung im Berufsbild
Im Rahmen der Nachqualifizierung zur bzw. zum MAF sind somit lediglich die Durchführung und die Inhalte der FacharbeiterInnenprüfung ohne Einschränkung mit einer ordentlichen Berufsausbildung (im Rahmen des dualen Systems) vergleichbar. Zur Planung entsprechender Vorbereitungskurse gerät somit die Abschlussprüfung
den alleinigen Fokus (bei der Gestaltung der Lehr-/Lerninhalte), handelt es sich demnach doch bei den Kursen lediglich um Kurse zur Prüfungsvorbereitung.
Die Abschlussprüfung besteht aus 2 Teilen. Sie wird von den zuständigen Stellen (IHKs) abgenommen.
- Einer theoretischen Abschlussprüfung in den Fächern: Produktionsplanung, Produktionstechnik so wie Wirtschafts- und Sozialkunde
- einer fachpraktischen Prüfung im Rahmen eines sogenannten betrieblichen Auftrages und eines inkludierten Fachgesprächs direkt beim zuständigen Ausbildungsbetrieb. Die fachpraktische Prüfung wird durch extern gebildete Prüfungsausschüsse und entsprechend beauftragte Prüfer im Auftrag der zuständigen Stelle (IHK) abgenommen (vgl. Bundesministerium der Justiz 2004, S.2-5)
Diese ermöglicht eine Kooperation von Bildungsträgern, Ausbildungsfirmen, der Bundesagentur für Arbeit sowie den zuständigen Stellen zur Berufsausbildung (IHKs). Diese Kooperation stellt sich meist wie folgt dar:
- Ein Bildungsträger (öffentlich, privat oder staatlich) übernimmt die Akquise der Teilnehmerinnen und Teilnehmer bzw. der beteiligten Ausbildungsbetriebe. Der Bildungsträger übernimmt die makrodidaktische Planung der Maßnahme bezüglich Kursdauer, Trainer, Trainingsinhalte usw.. Des Weiteren koordiniert der Bildungsträger die Anmeldemodalitäten bei der zuständigen Stelle, so wie die Beantragung etwaiger Fördergelder. Seitens der Bildungsträger werden die Prüfungsteilnehmer innerhalb einer mikrodidaktischen Umsetzungsphase auf die theoretische FacharbeiterInnenprüfung vorbereitet
- Die Ausbildungsbetriebe unterdessen, unterstützen den Bildungsträger in der makrodidaktischen Planung. Insbesondere bei der fachpraktischen Prüfungsvorbereitung übernehmen diese eine entscheidende Rolle. ( U.a. Definition eines betrieblichen Auftrages als Prüfungsgegenstand, Vorbereitung der PrüfungsteilnehmerInnen auf die praktische Abschlussprüfung und die Benennung einer Ausbilderin bzw. eines Ausbilders so wie einer Prüferin bzw. eines Prüfers. Die benannten Personen zur Prüfungsabnahme werden entsprechend in den zuständigen Prüfungsausschuss berufen
Eine gesetzliche Regelung z.B. zur Kursdauer existiert nicht. Die Bildungsträger und die Ausbildungsbetriebe besitzen also viele Freiheiten zur didaktischen und methodischen Planung und der Umsetzung entsprechender Maßnahmen.
B.2. Teil 1: Makrodidaktische Planung von Kursen zur Nachqualifizierung zum/zur MAF unter besonderer Berücksichtigung der Prüfungsgegenstände in den Prüfungsfächern Produktionstechnik und Produktionsplanung
Unter normalen Umständen fällt der Berufsschule bei der Prüfungsvorbereitung der teilnehmenden Personen zur fachtheoretischen Abschlussprüfung eine wichtige Rolle zu. Im vorliegenden Fall entfällt dieser wichtige Teil der dualen Berufsausbildung. Dieser Beitrag ist nun also von den Bildungsträgern, welche im Bereich der beruflichen Nachqualifizierung tätig sind, zu leisten.
Kann im Rahmen eines Berufsschulunterrichts doch auf bestehende Lehrpläne und Vorschriften zurückgegriffen werden, so ist die im vorliegenden Fall beschriebene Planung der Lehr-/Lerninhalte doch mit einem nicht zu unterschätzenden Aufwand verbunden.
Als ich Ende 2008 im Auftrag eines Bildungsträgers innerhalb beschriebener Strukturen tätig geworden bin, konnte ich auf keinerlei Erfahrungen bezüglich der Kursdurchführung sowohl auf Seiten des Bildungsträgers als auch aus meiner beruflichen Trainerpraxis zurückgreifen.
Zwischenzeitlich (bis Ende 2011) habe ich (gemeinsam mit Trainerkolleginnen und Trainern) 4 Kurse zu einem jeweils erfolgreichen Abschluss gebracht. Ca. 50 Erwachsene wurden auf die Facharbeiterprüfung vorbereitet – alle zur Prüfung angemeldeten Personen haben die theoretische Prüfung bestanden (teilweise mit sehr guten Prüfungsergebnissen). Die Planung der theoretischen Fachinhalte basierte bei allen Kursen auf die im Folgenden beschriebene Vorgehensweise.
B.2.1. Definition eines zur Anwendung kommenden Curriculums
Zunächst gilt es nochmals festzuhalten, dass die zur Anwendung kommenden Lehr-/Lerninhalte innerhalb aller ordentlichen Berufsbilder (gemäß BBIG) im Rahmen gültiger Ausbildungsrahmenpläne definiert sind. Dies gilt auch in vorliegendem Fall. Bei der Begutachtung des entsprechenden Rahmenplans der bzw. des MAFs wird folgendes deutlich:
- Die definierten Rahmenpläne beziehen sich maßgeblich auf die praktisch und fachlich zu vermittelnden Kompetenzen
- Der praktische Anteil der Ausbildung entfällt aber größtenteils, da den TeilnehmerInnen gemäß Umschulungsverordnung bereits Berufspraxis unterstellt wird
- Auf einen MAF gerechten Lehrplan für Berufsschulen kann aus beschriebenen Gründen nicht zurückgegriffen werden (vgl. Kap. B.1.2., S.30)
B.2.1.1. Ermittlung der Prüfungsinhalte
Aus pragmatischer Sicht bleibt den Bildungsträger und somit den eingesetzten Trainerinnen und Trainern der im Folgenden dargestellte Weg. Sämtliche Lehr-/Lerninhalte müssen anhand existierender (vergangener) und käuflich zu erwerbender Abschlussprüfungen des Berufsbildes rückwirkend ermittelt werden! Dem beteiligten Ausbildungspersonal wird (beim Durcharbeiten des Prüfungsmaterials) ebenfalls
deutlich, mit welchen fachlichen Anforderungen die zukünftigen Prüfungsteilnehmerinnen und Prüfungsteilnehmer konfrontiert werden sollen.
Die Trainerin bzw. der Trainer lernt dabei im Selbststudium das anzustrebende Kompetenzniveau kennen (Fachkompetenz und geforderte Problemlösungskompetenz).
Neben den fachlichen Inhalten trägt diese Vorgehensweise auch dazu bei, die Prüfungsmodalitäten und die Prüfungsanforderungen richtig einschätzen zu können. Eine kritische Auseinandersetzung zur Art und Weise der Prüfung sowie zur fachlichen Tiefe des Materials wird hierbei die Folge sein. Dies lässt zukünftige Rückkopplungen zur mikrodidaktischen Umsetzung der Kurse zu – eine offene Diskussion mit den Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmern über die Durchführung und den Anspruch der theoretischen Abschlussprüfung wird dabei die Folge sein. Auch zu meiner persönlichen Entwicklung als Trainer hat dieser Reflexionsprozess einen positiven Beitrag geleistet.
Die theoretische Abschlussprüfung vor der IHK stellt sich gemäß Ausbildungsverordnung wie folgt dar:
„[…]. Die schriftliche Prüfung dauert höchstens:
1. im Prüfungsbereich Produktionstechnik 120 Minuten,
2. im Prüfungsbereich Produktionsplanung 60 Minuten,
3. im Prüfungsbereich Wirtschafts- und Sozialkunde 60 Minuten.
[…]. Innerhalb des schriftlichen Teils der Prüfung sind die Prüfungsbereiche wie folgt zu gewichten:
1. Produktionstechnik 50 Prozent,
2. Produktionsplanung 30 Prozent,
3. Wirtschafts- und Sozialkunde 20 Prozent
(Bundesministerium der Justiz, 2004, S.5)“
Des Weiteren bleibt zu erwähnen, dass jeweils die Hälfte der maximalen Punktzahl durch Aufgaben in programmierter Form (Multiple Choice) erreicht werden kann. Die andere Hälfte der Punktzahl setzt sich aus den Ergebnissen einer freien Fragestellung und deren Beantwortung in schriftlicher Form zusammen.
B.2.1.2. Ergänzung der Prüfungsinhalte und Entwicklung von Lehr-/Lerninhalten
Im folgenden Prozess wurden die ermittelten Ergebnisse mit dem beteiligten Ausbildungspersonal, den Vertreterinnen und Vertretern der Ausbildungsbetriebe so wie dem beteiligten Fachpersonal des Bildungsträgers diskutiert. Diese Ergebnisse werden bzw. wurden durch Inhalte des Ausbildungsrahmenplans sowie noch fehlenden aber für wichtig erachteten Fachinhalten ergänzt.
B.2.1.3. Definition zu vermittelnder Lehr-/Lerninhalte – Grobplanung und Übersicht geforderter Fachkompetenzen
Zusammenführend wurde ein Curriculum erarbeitet, welche zugleich die inhaltliche Grobplanung und die Kompetenzziele definiert. Dieses stellte sich
folgt dar (vgl. Tab. 10/Tab. 11):
[...]
Häufig gestellte Fragen
Besteht ein Zusammenhang zwischen der Kursdauer und der Teilnehmerzufriedenheit in der Erwachsenenbildung?
Die Studie in Teil A untersucht diesen Zusammenhang mittels Varianzanalyse (ANOVA) bei Teilnehmern arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen in Wien, konnte jedoch keine einfache Korrelation als gesetzt voraussetzen.
Was beinhaltet der Personenzertifizierungsprozess nach ISO 17024?
Die Arbeit diskutiert kritisch den Prozess zur Zertifizierung als FachtrainerIn nach ISO 17024, einschließlich der Anforderungen an Kompetenznachweise und der Rezertifizierung.
Was versteht man unter einem intersektionalen Ansatz in der Didaktik?
In Teil C wird ein Ansatz erläutert, der Gender- und Diversity-Aspekte verknüpft, um eine gerechte Didaktik in der Erwachsenenbildung zu gewährleisten.
Welche Rolle spielt die makrodidaktische Planung bei Fachkursen?
Teil B beschreibt die Planung von Nachqualifizierungskursen für Maschinen- und Anlagenführer, wobei Curriculumsentwicklung und Prüfungsinhalte im Fokus stehen.
Was ist die Memorytechnik im Kontext des Trainings?
Es handelt sich um eine mikrodidaktische Methode zur Lernerfolgskontrolle, die als Kognitionshilfe in der Metall- und Kunststofftechnik-Ausbildung eingesetzt wird.
- Arbeit zitieren
- Dipl.-Ing.(FH); M.A. Uwe Schäfer (Autor:in), 2014, Beiträge zur beruflichen Erwachsenenbildung 2013/14, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/270384