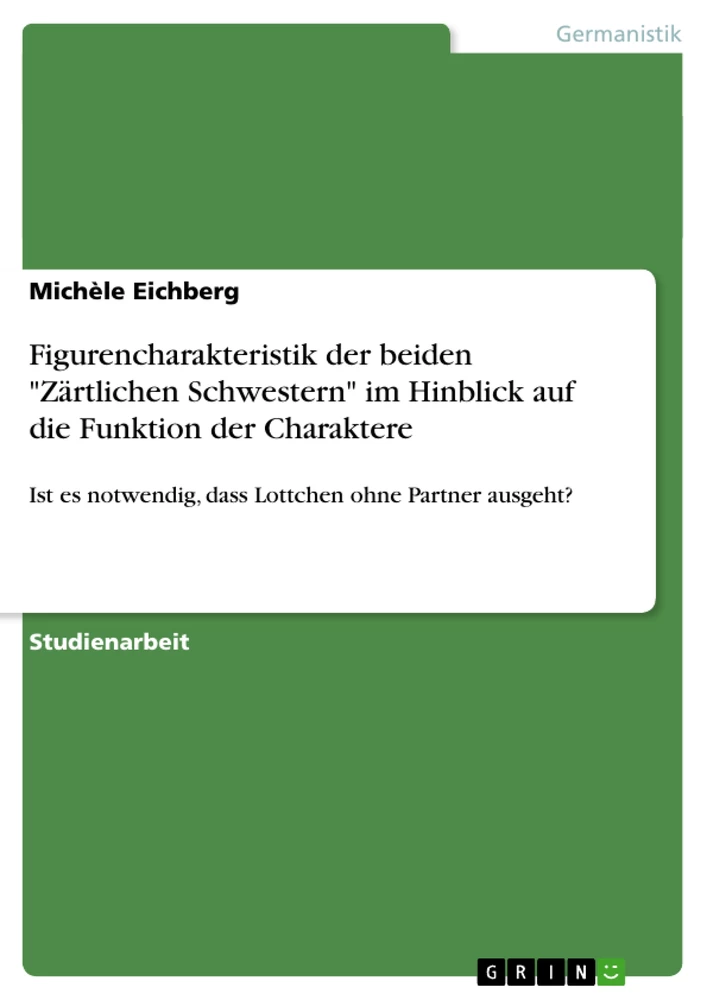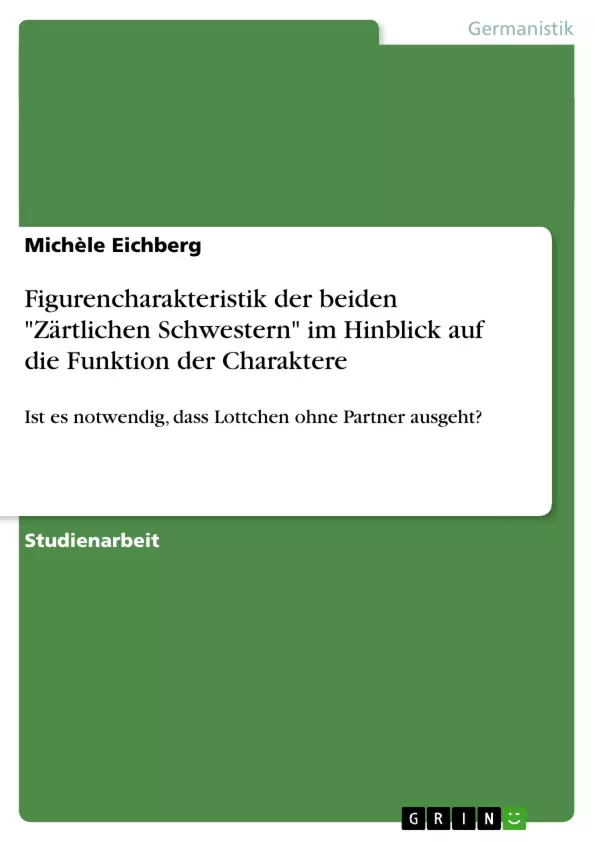Die „Zärtlichen Schwestern“ von Christian Fürchtegott Gellert erschien 1747 im Zeitalter der Aufklärung und ist der Empfindsamkeitsströmung zuzuordnen. Im Mittelpunkt dieser Strömung steht der Versuch, mithilfe der Vernunft auch Empfindungen klären zu können. Höchstes Ziel des Daseins sei eine Erlangung moralischer Zufriedenheit, welche entstünde, wenn man sich durch „gute Affekte“ (Sympathie, Freundschaft, Liebe etc.) leiten ließe.
Als rührendes Lustspiel liegt das Stück an der Grenze zwischen Komödie und Tragödie. Gellert beschrieb das Ziel hinsichtlich dieser Grenzüberschreitung seines Werkes folgendermaßen:
„Abschilderungen guter Personen [..] zeigen uns das Gerechte, das Schöne und Löbliche. Jene schrecken von den Lastern ab, diese feuern zu der Tugend an und ermuntern die Zuschauer, ihr zu folgen.“
Inwieweit diese intendierte Funktion des Autors bei den Protagonistinnen Lottchen und Julchen herausgestellt werden kann, soll Gegenstand der folgenden Ausführungen sein. Schließlich soll im Weiteren zu erarbeiten sein, ob eine Notwendigkeit darin besteht, dass das äußerst tugendhafte Lottchen ohne Partner ausgeht.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Inhalt
3. Die Schwestern
3.1 Vorstellung der Figur ‚Lottchen’:
3.2 Vorstellung der Figur ‚Julchen’:
3.3 Beziehung der beiden Schwestern zueinander
4. Funktion der beiden Charaktere
5. Schluss
6. Literaturverzeichnis
1. Einleitung
Die „Zärtlichen Schwestern“ von Christian Fürchtegott Gellert erschien 1747 im Zeitalter der Aufklärung und ist der Empfindsamkeitsströmung zuzuordnen. Im Mittelpunkt dieser Strömung steht der Versuch, mithilfe der Vernunft auch Empfindungen klären zu können. Höchstes Ziel des Daseins sei eine Erlangung moralischer Zufriedenheit, welche entstünde, wenn man sich durch „gute Affekte“ (Sympathie, Freundschaft, Liebe etc.) leiten ließe.[1]
Als rührendes Lustspiel liegt das Stück an der Grenze zwischen Komödie und Tragödie. Gellert beschrieb das Ziel hinsichtlich dieser Grenzüberschreitung seines Werkes folgendermaßen:
„Abschilderungen guter Personen [..] zeigen uns das Gerechte, das Schöne und Löbliche. Jene schrecken von den Lastern ab, diese feuern zu der Tugend an und ermuntern die Zuschauer, ihr zu folgen.“[2]
Inwieweit diese intendierte Funktion des Autors bei den Protagonistinnen Lottchen und Julchen herausgestellt werden kann, soll Gegenstand der folgenden Ausführungen sein. Schließlich soll im Weiteren zu erarbeiten sein, ob eine Notwendigkeit darin besteht, dass das äußerst tugendhafte Lottchen ohne Partner ausgeht.
2. Inhalt
Dieses rührende Lustspiel ist geprägt durch Diskurse der Figuren über Tugendhaftigkeit und weniger durch Aktionen. Lottchen und Julchen, die Töchter des verwitweten Cleons, sollen beide den Bund der Ehe eingehen. Während Julchen zunächst von der Vorstellung der Ehe mit Herrn Damis abgeschreckt ist, weil sie glaubt dadurch ihre Freiheit zu verlieren, muss Lottchen ihrem Liebhaber Siegmund versagen. Dieser kann aufgrund von Wirrungen um das Erbe der Muhme der beiden Schwestern seiner Moral nicht standhalten und wird aus Vermögensgründen zur Untreue verlockt.
Den einzigen Handlungsstrang bildet eine Intrige: Julchen soll sich ihrer Gefühle zu Damis bewusst werden, indem dieser ihr weniger von der Liebe, sondern von der ihr so lieben Freiheit erzählt. Zudem soll Siegmund auch um sie werben, was zu Verwirrungen und letztlich zur Erkenntnis ihrerseits führen soll.[3]
3. Die Schwestern
3.1 Vorstellung der Figur ‚Lottchen’:
Lottchen ist die ältere Tochter einer bürgerlichen Familie. Ihre Mutter ist schon verstorben und so lebt sie mit ihrem Vater Cleon und ihrer Schwester Julchen zusammen. Lottchen ist sehr tugendhaft. Sie stellt sich stets als redlich, treu und selbstlos dar. Sie schätzt sich selbst als einen Menschen, der nicht das Glück anderer beneidet und auch zur Menschenliebe geneigt ist, ein (II/8, S.40). Von diesen positiven Aspekten ist auch ihre Fremdwirkung bestimmt. Alle anderen Figuren sehen in ihr ebenso ein ‚edles Herz’. Besondere Hochachtung und Gunst kommt ihr vom Vater entgegen. Schon im ersten Auftritt gibt dieser an, dass seine „Goldtochter“ (I/1, S.6) zwar nicht so hübsch wie die Jüngere, doch aber sehr einsichtig und schlau sei, obwohl sie nicht studiert habe (I/1, S.5). Cleon möchte sie auch weiterhin im musikalischen und sprachlichen Bereich fördern.
Lottchen wird als eine Art Ideal gezeigt, als ein Mädchen ohne Fehler. Einzig ist zu tadeln, dass sie in gewissen Situationen zu gutgläubig agiert und auf ihre Menschenliebe beharrt, was man fast schon als naive Züge bezeichnen kann (III/7, S.67f.).
Ihre Beziehung zu ihrem Liebhaber Siegmund ist durch vorbildhafte Diskurse zur Tugendhaftigkeit geprägt. Ihre Liebe zueinander zeigt sich nicht in körperlicher Zuneigung. Siegmund rechnet seinem Lottchen hoch an, dass sie ihr Interesse an ihm trotz seines Vermögensverlustes nicht verloren hat. Das Mädchen selbst gibt an, dass sie nicht gemein liebe, sondern äußerst redlich. (III/20, S.85). Im Gegensatz zu dieser Wahrnehmung steht jedoch ihre Erkenntnis, dass in Situationen, die von wahrer Liebe geprägt sind, das Wort ‚Liebe’ von keinem der Partner gesagt werden muss (II/5, S.37).
3.2 Vorstellung der Figur ‚Julchen’:
Julchen ist die jüngere Tochter Cleons. Sie vollzieht in gewissem Maße einen Wandel im Stück, welcher jedoch durch eine Intrige erzwungen wird.[4] Will sie zunächst ihre Freiheit voll und ganz bewahren und sich keinesfalls schon dem Bund der Ehe hingeben, so wird sie durch eine Intrige doch umgestimmt. Sie bemerkt endlich, dass sie sich zu Damis, einem stattlichen tugendhaften Herrn mit Vermögen, hingezogen fühlt. Bis es aber zu dieser Einsicht kommt, pocht Julchen regelrecht auf ihr Recht auf freundschaftliche Vertrautheit. Sie will keine Liebesbeziehung und kann den Ratschlägen des Magisters, welcher der Bruder Cleons ist, nichts abgewinnen. Anstatt sich seinen Worten zu öffnen, bleibt sie bei ihrer Meinung, dass es zwischen Menschen noch etwas Anderes geben muss als entweder Hass oder Liebe. Wenn sie sich zu einem ehelichen Bund entschlösse, dann würde sie ungelehrt lieben wollen und die Liebe nicht als Pflicht ansehen müssen. Dieses Beharren auf Freiheit führt dazu, dass sie gewissermaßen dem lasterhaften Charakter der Typenkomödie entspreche.[5]
[...]
[1] Schweikle, Metzler Literatur Lexikon (1990), S.122
[2] http://www.literaturwissenschaft-online.uni-kiel.de/veranstaltungen/vorlesungen/literatur18/04Vorlesung18Jh0607.pdf S.46
[3] Gellert, Die Zärtlichen Schwestern (1747); I/4, S.11f.
Im Folgenden zitiere ich im Text mit Angabe des Aufzugs, des Auftritts und der Seitenzahl.
[4] Gellert, Die Zärtlichen Schwestern (1747), Nachwort; S.151
[5] ebd.
- Citation du texte
- Michèle Eichberg (Auteur), 2009, Figurencharakteristik der beiden "Zärtlichen Schwestern" im Hinblick auf die Funktion der Charaktere, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/270584