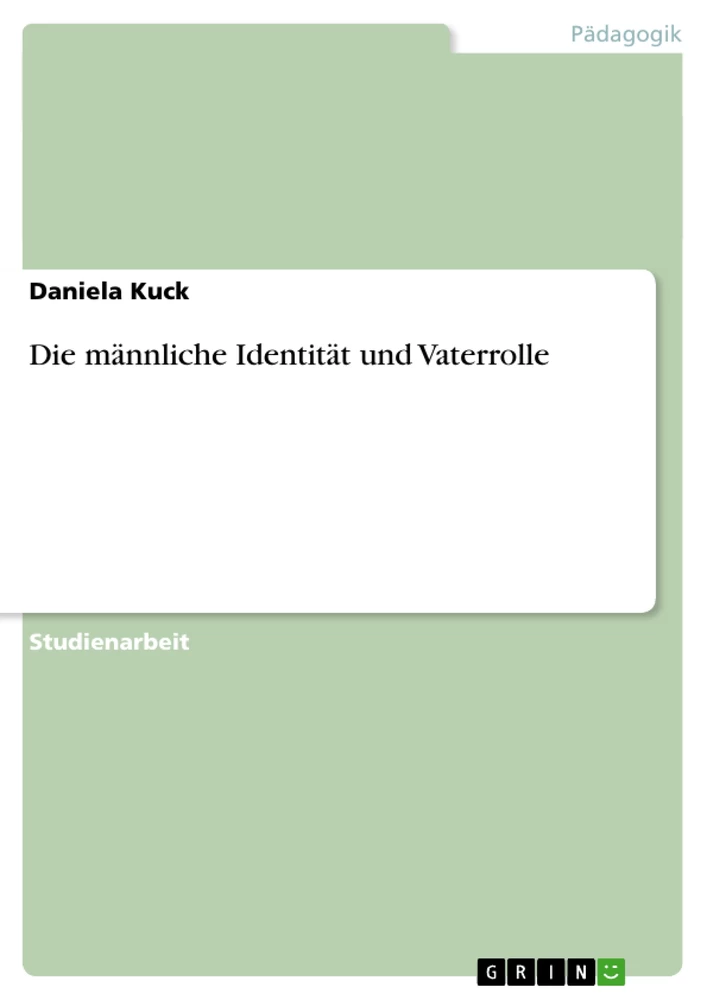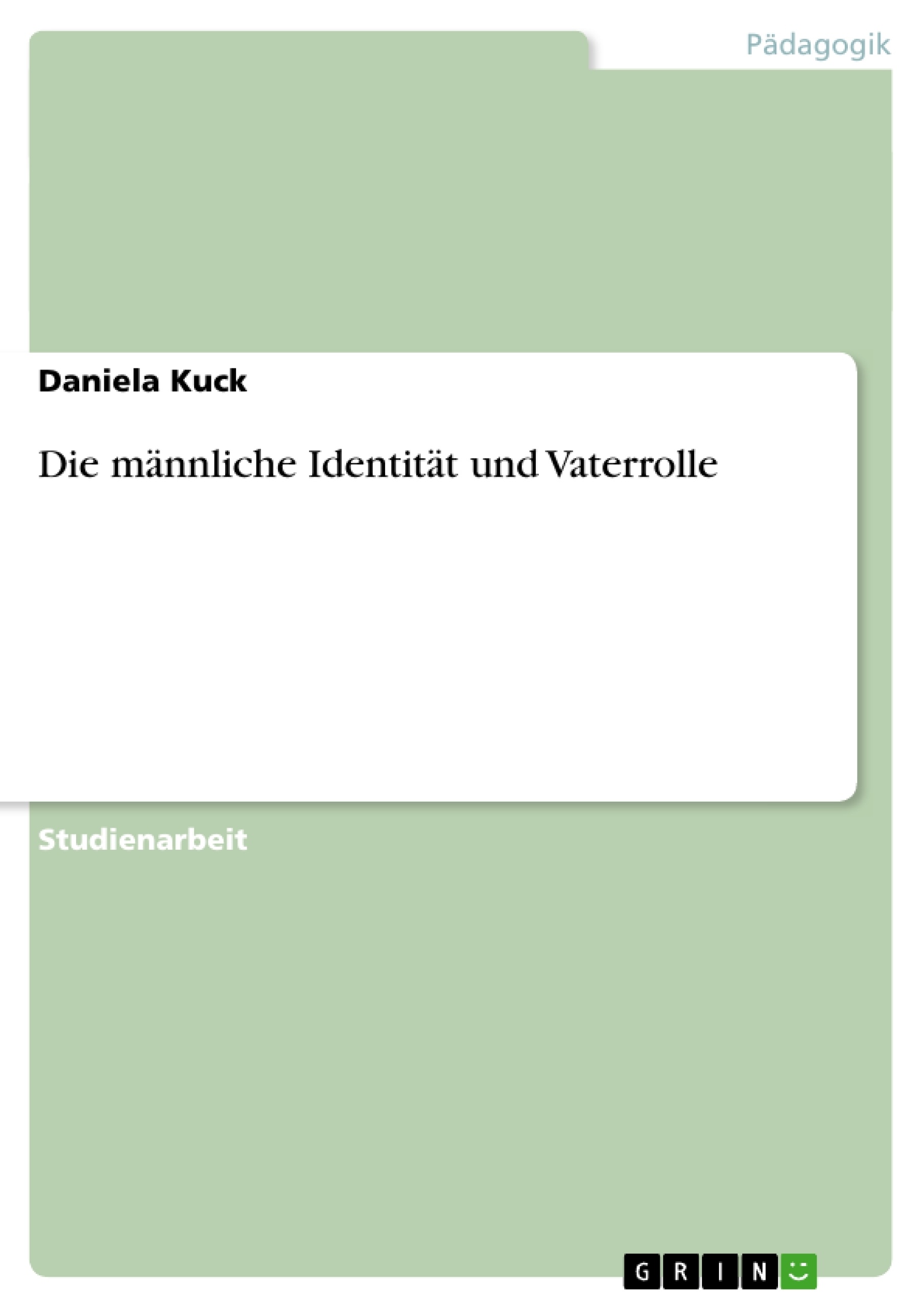Emanzipation, Gleichberechtigung der Frauen, schulische Förderung der Mädchen. All diese Themen standen in den letzten Jahren im Vordergrund. Bei allen geht es fast ausschließlich um Frauen und Mädchen. Doch wo bleiben die Jungen/Männer/Väter? Wer beleuchtet ihre Probleme, Bedürfnisse und Wünsche? Väter werden unterschätzt, mit Erwartungen überfordert und oft gemaßregelt. Jungen erfahren wenig Förderung, stehen immer hinter den mustergültigen Mädchen und gelten meist nur als Störenfriede. Wie vielschichtig und facettenreich die männliche Identität ist, soll im Folgenden aufgezeigt werden.
INHALTSVERZEICHNIS
1 Einleitung
2 Was sind Identität und soziale Rollen?
3 Die Vaterrolle im Wandel der Zeit
4 Die „neuen“ Väter
5 Die verschiedenen Vater-Rollen
6 Jungen in Kitas
7 Jungen besser fördern
8 Schlusswort
9 Literaturverzeichnis
1 Einleitung
Emanzipation, Gleichberechtigung der Frauen, schulische Förderung der Mädchen. All diese Themen standen in den letzten Jahren im Vordergrund. Bei allen geht es fast ausschließlich um Frauen und Mädchen. Doch wo bleiben die Jungen/Männer/Väter? Wer beleuchtet ihre Probleme, Bedürfnisse und Wünsche? Väter werden unterschätzt, mit Erwartungen überfordert und oft gemaßregelt. Jungen erfahren wenig Förderung, stehen immer hinter den mustergültigen Mädchen und gelten meist nur als Störenfriede. Wie vielschichtig und facettenreich die männliche Identität ist, soll im Folgenden aufgezeigt werden.
2. Was sind Identität und soziale Rollen?
Wenn man sich die Frage nach seiner eigenen Identität stellt, kommt man nicht umher, sich zu fragen "Wer bin ich?" und "Wer bist du?". Doch für Identität gibt es keine konkrete Definition, denn die kann unterschiedlich verstanden werden. Man kann sie als habituelle Prägung, Selbstbild, soziale Rolle, performative Leistung oder als konstruierte Erzählung verstehen (vgl. Jörissen 2010). Diese Aufzählungen lassen erkennen, dass die eigene Identität nicht nur einen selbst betrifft, sondern auch das kulturelle soziale Umfeld der entsprechenden Person. Eine gefestigte Identität gibt Sicherheit, Vollkommenheit und ein Zugehörigkeitsgefühl.
Doch was genau macht die Identität aus? Sind es die Freunde, die Sprache, der Beruf, die Wohnung, die Religion, die Kinder oder ein Haus? Wer bin ich, wie sehe ich mich selbst und wie sehen mich die anderen? Habe ich meine Identität schon gefunden und hat sie sich eventuell verändert? Meist erhalten wir die Antworten auf unsere Fragen, indem wir uns mit anderen vergleichen. "Wer sich die Frage nach der Identität stellt, wird feststellen, dass sein Selbstbild der Veränderung und Entwicklung unterliegt, dass es immer auch anders sein könnte, und dass es einen Unterschied macht, ob ich mich selbst im Spiegel, oder aus dem Blickwinkel der anderen betrachte. Identität ist somit ein Differenzierungs- und Vermittlungsbegriff in einem: Er signalisiert die internen Unterschiede im Selbst wie die externen Differenzen zwischen sich und dem anderen und er verweist auf die Leistungen, die zu erbringen sind, um ein gewisses Maß an internen, d.h. selbstbezüglichen wie externen, d.h. sozialen Integrationen aufrechtzuerhalten" (Jörissen 2010).
Identität ist also als nicht so leicht zu bewältigende Aufgabe zu verstehen, denn sie muss ständig aufrechterhalten, gefestigt, bewahrt, aufgebaut und verteidigt werden (vgl. Jörissen 2010).
Eng mit der Identität verbunden ist der Begriff der sozialen Rolle. Soziale Rollen sind nach Dahrendorf an das Verhalten der Träger von Positionen geknüpfte Erwartungen in einer gegebenen Gesellschaft. Das Vorhandensein von Rollen dient also als Anhaltspunkt. Der Rolleninhaber weiß, was von ihm erwartet wird und auch was er von den anderen erwarten kann. Doch warum verhalten sich die Inhaber der Rollen dementsprechend? "Dahrendorf führte deshalb den Begriff der 'Bezugsgruppe' (reference group) ein, worunter er solche Gruppen, bzw. die Rollen-Sender versteht, die auf das Verhalten des Rollenträgers einwirken können und die den Rollenträger positiv oder negative zu sanktionieren vermögen, was nach Dahrendorf konformes Verhalten bedingt" (vgl. Nave-Herz 2006). Diese Sanktionen können beispielsweise Mobbing, Auslachen, Beschimpfungen oder ein einfaches Kopfschütteln beinhalten. Trotzdem bleibt das Problem der unterschiedlichen Auslegung der Rollen-erwartungen.
Die Vater- und Mutterrolle sind zwei Beispiele für soziale Rollen. Die Begriffe Mutter und Vater stellen zunächst nur eine biologische Tatsache dar, ähnlich wie Mann und Frau. Dieser biologische Tatbestand gibt den Mitmenschen jedoch eine Rechtfertigung, diese Rolle näher zu differenzieren und geschlechtsspezifische Unterschiede auszuweiten.
Auch wenn sich die Vaterrolle, wie später noch näher ausgeführt wird, im Laufe der Zeit doch verändert hat, so hat es die Mutterrolle nicht.
3 Die Vaterrolle im Wandel der Zeit
Forscher gehen davon aus, dass die Menschen in der Steinzeit den Zusammenhang zwischen Geschlechtsverkehr und der Geburt von Kindern schlichtweg nicht erkannten. Somit kam auch den Männern keine besondere Rolle zu, denn den Frauen allein gab die Verantwortung dafür, Kinder zu zeugen und auszutragen. Auch im alten Rom wurde den Frauen und Müttern Milde und Nähe, den Männern hingegen Distanz, Härte und Autorität zugestanden.
[...]
Häufig gestellte Fragen
Wie hat sich die Vaterrolle historisch verändert?
Von der Steinzeit (unbekannte biologische Vaterschaft) über das römische Ideal der Härte bis hin zum modernen Konzept der "neuen Väter", die emotional präsent sind.
Was versteht man unter "neuen Vätern"?
Väter, die sich aktiv an der Erziehung und Hausarbeit beteiligen, eine emotionale Bindung zu ihren Kindern suchen und die klassische Ernährerrolle hinterfragen.
Warum werden Jungen in Kitas oft als "Störenfriede" wahrgenommen?
Die Arbeit thematisiert, dass Jungen oft weniger Förderung erfahren und ihr Bewegungsdrang in weiblich geprägten Erziehungsumfeldern häufig negativ sanktioniert wird.
Wie definiert Dahrendorf "soziale Rollen"?
Soziale Rollen sind Bündel von Erwartungen, die an den Inhaber einer Position geknüpft sind und durch positive oder negative Sanktionen abgesichert werden.
Was ist das Ziel einer besseren Jungenförderung?
Jungen sollen in ihren spezifischen Bedürfnissen ernst genommen werden, um eine gefestigte männliche Identität jenseits von Klischees oder Stigmatisierung zu entwickeln.
- Arbeit zitieren
- Daniela Kuck (Autor:in), 2012, Die männliche Identität und Vaterrolle, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/270669