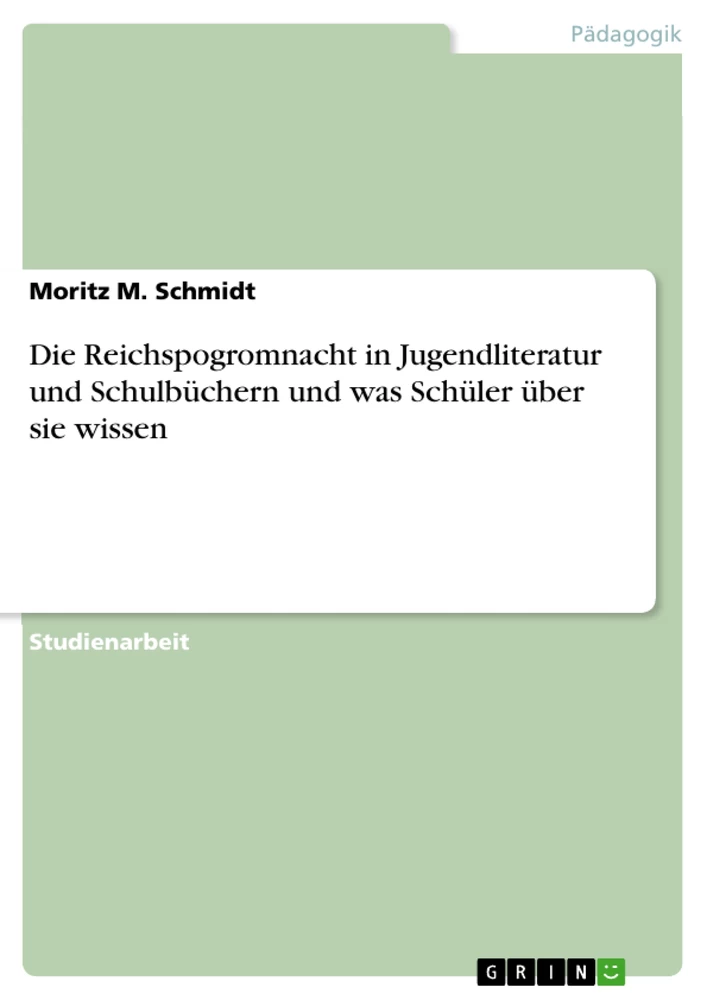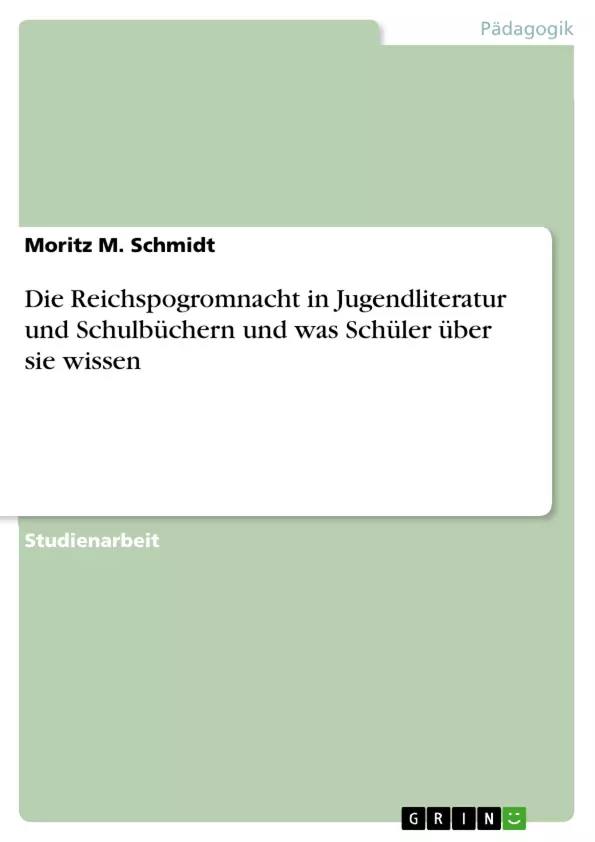Legenden im Schulunterricht? Muss denn so etwas überhaupt sein? Sollte nicht gerade der
Geschichtsunterricht den Schülerinnen und Schülern abgeschlossene, geschichtliche Fakten
präsentieren, ohne irgendwelche Mythen und Legenden heranzuziehen? Nein, sagt der
Didaktiker Hans-Jürgen Pandel, denn „Fiktionen, Mythen, Legenden und
Wissenschaftswissen vermischen sich zu einer Einheit, die wir ‚Geschichtskultur’ nennen.“
Vor allem in Spielfilmen sind Kombinationen aus Fiktion und Realität zu finden. „Die
Unterscheidung von Wirklichkeit und Fiktion gehört zu den Elementarbeständen unseres
Alltagswissens.“ Den Schülerinnen und Schülern muss somit gezeigt werden, was fiktiv und
was real ist. Darüber hinaus bietet es einen Blick in die jeweilige Zeit an. Nicht nur die
Perspektive „Wie war es wirklich?“, sondern „Wie haben es die Menschen damals erlebt?“
kann somit eingenommen werden. Denn: „Geschichte ist (...) nicht allein vergangene
Wirklichkeit. Geschichte ist vor allem das Bild, das sich Menschen von vergangener
Wirklichkeit machen.“ Legenden und Mythen bilden eine Säule des Kulturellen
Gedächtnisses von Jan Assmann, auf das sich Nationalgeschichte stützt.
Ein wesentliches Argument für Pandel ist, dass die Schülerinnen und Schüler durch die
Bearbeitung von kontrafaktischer Geschichte, ihr Gattungslernen verbessern und ausbauen.
Dies ist ein wesentlicher Baustein des geschichtlichen Lernens. Beispielhaft für die
Verwendung von Legenden im Geschichtsunterricht ist die Inszenierung und
Darstellungsweise der Reichspogromnacht.
Als erstes werden die faktischen Abläufe der Reichspogromnacht skizziert. Im Anschluss
folgt eine Re- und Dekonstruktion der Legende, die zu Zeiten des nationalsozialistischen
Regimes besagte, dass die deutschen Bürger und nicht NS-Funktionäre die Verwüstungen und
Zerstörungen zu jener Zeit begangen hätten.
Der zweite Teil der vorliegenden Arbeit behandelt die Darstellung der Reichspogromnacht in
zwei von mir ausgewählten Schulbüchern. Hierbei soll gezeigt werden, ob die Schulbücher
auch auf die Legendenbildung eingehen und wie hinreichend sie die Reichspogromnacht
behandeln.
Drittens wird versucht zu klären, inwieweit es möglich ist, Abschnitte aus Jugendbüchern in
das Unterrichtsthema zu integrieren. Dabei soll der Frage nachgegangen werden, ob sie besser
außer Acht gelassen werden oder ob sie eine völlig neue Sichtweise bieten, bzw. ob sie die
Fakten der Reichspogromnacht abdecken...
Gliederung
1 Die Legende der Reichspogromnacht im Schulunterricht
2 Was am 9. November 1938 geschah - eine provokativ faktische Darstellung
3 Rekonstruktion der Legende
4 Dekonstruktion der Legende
5 Untersuchung der Behandlung der Reichspogromnacht in ausgewahlten Schulbuchern
5.1 Tabellarischer Vergleich der zwei fur die Realschule empfohlenen Schulbucher
5.2 Begrundung der getroffenen Schulbuchauswahl
6 Untersuchung der moglichen Einbindung von Jugendbuchern in den Unterricht zum Thema Reichspogromnacht
7 Betrachtung der durchgefuhrten Schulerinterviews
8 Fazit
9 Literaturverzeichnis
Häufig gestellte Fragen
Warum sollten Legenden im Geschichtsunterricht behandelt werden?
Laut Hans-Jürgen Pandel vermischen sich Fiktionen und Fakten zur Geschichtskultur. Die Auseinandersetzung damit hilft Schülern, zwischen Wirklichkeit und Fiktion zu unterscheiden.
Welche Legende zur Reichspogromnacht wird in der Arbeit dekonstruiert?
Es wird die NS-Legende untersucht, nach der deutsche Bürger und nicht NS-Funktionäre die Zerstörungen am 9. November 1938 begangen hätten.
Wie werden Schulbücher in dieser Studie analysiert?
Die Arbeit vergleicht zwei Realschul-Lehrbücher daraufhin, ob sie die Legendenbildung zur Reichspogromnacht thematisieren und die Fakten hinreichend abdecken.
Können Jugendbücher den Geschichtsunterricht ergänzen?
Ja, die Arbeit prüft, ob Jugendbücher neue Sichtweisen bieten und die emotionalen Erlebnisse der Menschen damals besser vermitteln können als reine Faktendarstellungen.
Was ist das "Kulturelle Gedächtnis" nach Jan Assmann?
Es ist ein Speicher für Mythen und Legenden, auf den sich die Nationalgeschichte stützt und der das Bild einer Gesellschaft von ihrer Vergangenheit prägt.
- Citation du texte
- Moritz M. Schmidt (Auteur), 2013, Die Reichspogromnacht in Jugendliteratur und Schulbüchern und was Schüler über sie wissen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/270672